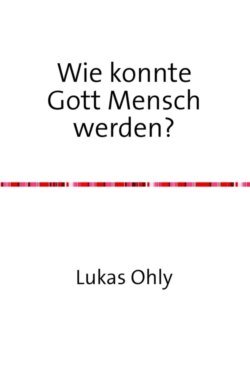Читать книгу Wie konnte Gott Mensch werden? - Lukas Ohly - Страница 5
Kommentar und Weiterführung
ОглавлениеMit dem folgenden Vorschlag möchte ich die Prosopon-Einheit bei Nestorius phänomenologisch untermauern. Nun ist der Quellbestand bei Nestorius nicht umfangreich genug, um zu belegen, dass Nestorius wirklich so gedacht hat, wie ich das nun entwickle. Allerdings schließt der Quellbestand meinen Vorschlag auch nicht aus. Das Prosopon als Gesicht zu verstehen, bedeutet phänomenologisch, dass beim Anblick Christi beide Naturen begegnen, obwohl begrifflich ausgeschlossen ist, dass eine Entität beide Naturen zugleich haben kann. Christus hat keine zwei Gesichter. Im Anblick seines Gesichts sind seine Naturen ununterscheidbar vereint. Wird das Gesicht phänomenologisch begriffen, so tritt es einem Gegenüber in Erscheinung. Das Gesicht begegnet einem anderen Menschen. Niemand kann sich selbst ins Gesicht sehen, es sei denn dass er sich in einem Spiegel als Gegenüber projiziert. Das Gesicht ist also phänomenologisch auf ein Gegenüber angewiesen, um in Erscheinung zu treten. In dieser Beschreibung ereignet sich also die Prosopon-Einheit in Begegnung: Sie ist, indem sie sich ereignet, und sie ereignet sich, indem sie jemandem begegnet. Dies bestätigt nochmals die obige Beobachtung, dass sich bei Nestorius offenbar die Einheit Christi außerhalb der göttlichen Natur vollzieht. Sie vollzieht sich nämlich bereits außerhalb des Gesichts als Entität. Denn das Gesicht ist phänomenologisch immer schon ein extravertierter Gegenstand: Es tritt nur in Begegnung auf. Ist also das Gesicht die Einheit der Naturen, so ereignet sich die Einheit außerhalb dieses Gegenstandes „Gesicht“, weil dieser Gegenstand als Phänomen immer schon „außerhalb seiner selbst“ ist. Die Begegnung des Gesichts kann nicht von seiner Gegenständlichkeit abstrahiert werden.
Mit dieser Darstellung erledigt sich zugleich das Problem, dass die Einheit der beiden Naturen nur eine scheinbare sei. Denn das Wesen eines Gesichts ist phänomenologisch in seiner Erscheinung zu finden. Seine Erscheinung ist wesentlich. Sieht man dagegen von der Begegnung des Gesichts ab, so kann man allenfalls unwesentliche Eigenschaften von ihm bestimmen (zum Beispiel die Hautfarbe) oder solche, die es nicht hinreichend bestimmen (zum Beispiel dass es ein materieller Gegenstand ist, dass es schwer ist o.ä.). Ob es sich phänomenologisch bei diesen Eigenschaften wirklich um Eigenschaften des Gesichts handelt, lässt sich aber wiederum nicht belegen, solange man sich nicht auf die Begegnungssituation des Gesichts rückbezieht: Die Hautfarbe ist nicht bestimmbar, solange das Gesicht niemandem begegnet. Und ob ein Gesicht wirklich „materiell“ ist und nicht vielmehr geistig, kann ohne Begegnungssituation bestritten werden, ganz zu schweigen von der phänomenologisch sogar zweifelhaften Behauptung, dass das Gesicht „schwer“ sei. Das Gesicht hat nur unter der abstrakten Voraussetzung ein Gewicht, dass es ein materieller Gegenstand ist. Aber phänomenologisch erscheint das Gewicht des Gesichts nirgends. Allenfalls geistig ist es gewichtig, nämlich in der Begegnung.
Im Gesicht fällt also die Differenz zwischen Wesen und Erscheinung: Das Gesicht ist wesentlich Erscheinung, ohne dabei „nur“ Schein zu sein. Bestimmt man die Einheit Christi über die Einheit seines Gesichts, so beschreibt man das Wesen der Erscheinung und gibt ihr eine theologisch wesentliche Bedeutung. Die Einheit Christi ist also nicht „nur“ Erscheinung, sondern sie ist überhaupt nur wesentlich, weil sie Erscheinung ist. Das Wesen der Einheit Christi ist Erscheinung. Sie ist ein Geschehen „pro nobis“, nämlich für die Menschen, die dem Gesicht Christi begegnen. Vielleicht hat Nestorius das gemeint, wenn er zwischen Geburt und Menschwerdung unterschied und daran erinnert, „daß dieselben heiligen Väter im Zusammenhang mit dem Heilsplan und dem Heilswirken (oikonomia) Gottes nicht von einer Geburt, sondern von einer Menschwerdung sprechen“ (230). Das Wort Menschwerdung heißt griechisch „Enanthropesis“, was wiederum „einen Menschen annehmen“ heißen kann. Nestorius sucht nach einem Modell der Beziehungsaufnahme anstelle einer objektiven Einheit auf der Ebene der Gegenständlichkeit. Zudem vollzieht sich diese Annahme eines Menschen „im Zusammenhang mit dem Heilsplan und dem Heilswirken“, also im Zusammenhang mit der Geschichte Gottes mit den Menschen. Sowohl das griechische Wort oikonomia, das ebenso „Tätigkeit“ oder „Wirken“ heißen kann, als auch dynamis (Kraft, Macht; hier irritierend mit „Heilsplan“ übersetzt) haben prozesshafte Bedeutungen. Sie sind, was sie sind, im Vollzug im Hinblick auf ein Gegenüber. Nestorius’ christologisches Modell besitzt also einige Anzeichen dafür, dass er eine dynamische Erklärung sucht, anstatt die Lösung auf der Ebene ontologischer Kategorien zu finden. Dennoch verliert er ontologische Kategorien nicht aus dem Blick, wie die Verklammerung von Wesen und Erscheinung im Gesicht zeigt. Nestorius deutet das Phänomen des Gesichts in seiner Wesenheit an, übersteigt allerdings dabei die klassische Ontologie seiner Zeit, die das Wesen einer Entität immer nur in ihr selbst zu finden wusste.
Ist dieser Verdacht berechtigt, dass Nestorius eine Abneigung gegen begriffssystematische Lösungen hat, um ein historisch kontingentes Ereignis zu beschreiben, dann könnte auch das zweite Werkzeug rehabilitiert werden. Das Gemeinsame von Gottheit und Menschheit sind weder einfach nur die Bezeichnungen oder Namensgebungen, noch die allgemeinen Gemeinsamkeiten der Naturen. Die Einheit über eine solche Schnittmenge zu erweisen, widerspricht nämlich Nestorius’ Heuristik der Prosoponeinheit. Als das Gemeinsame kann dann vielmehr gelten, was sich in der Begegnung mit dem Gesicht Christi überhaupt erst herausstellt, das Gemeinsame im Begegnungsereignis. Im Prosopon erscheint die Einheit Christi, des eingeborenen Sohnes. Die gemeinsamen Eigenschaften der Naturen lassen sich von hier aus erst retrospektiv bestimmen, nämlich unter Voraussetzung der erschienenen Einheit in Christus. Wenn Nestorius Christus als „Name“ bestimmt, so muss es sich nicht um eine willkürliche Namensbestimmung handeln. Sie kann vielmehr reagieren auf das Phänomen, das sich im Gesicht Christi bildet. Der Name Christus würde dann nur dieses Phänomen benennen.
Lässt sich auch das erste Werkzeug rehabilitieren? Ich habe die Gefahr beschrieben, dass Christus durch die Differenz von Gottheit und Gott zu einem Nebengott werden kann, der nur in einem geringeren Grad Gottheit ist als die göttliche Natur. Durch die hier durchgeführte phänomenologische Darstellung kann man auch ein anderes Bild entwerfen: Da unter den klassischen ontologischen Kategorien die Einheit der beiden Naturen in Christus nicht darstellbar ist, wechselt Nestorius die Perspektive: Die Gottheit wird für die Beschreibung der Einheit in Christus nicht zugrunde gelegt, da sie eine Abstraktion darstellt. Vielmehr wird phänomenologisch die Einheit zugrunde gelegt, die erst retrospektiv die Differenzierung der göttlichen und menschlichen Natur vornehmen lässt. Es lässt sich also nicht ontologisch die Einheit Christi als eine Zusammensetzung zweier gegensätzlicher Naturen bestimmen. Vielmehr wird genau umgekehrt die erschienene Einheit im Gesicht Christi erfahren und ausgehend von ihr die Differenz der beiden Naturen retrospektiv bestimmt. Christus ist dann deswegen kein Nebengott, weil es keine Gottheit an sich gibt, ohne dass sie sich personifiziert. Die Gottheit ist immer schon göttliche Natur in Gott. So zitiert Nestorius das Nicaenum und fügt dabei den Naturbegriff hinzu: Christus ist der „aus Gott Vater der Natur nach gezeugte eingeborene Sohn“ (228f.). Es entspricht also das Sohnsein der göttlichen Natur, so dass es eine solche nicht unabhängig von ihrer Personifizierung gibt.
Mit der phänomenologischen Interpretation entgeht Nestorius den Schwächen und Aporien, denen er bei einer ontologischen Interpretation ausgesetzt wäre. Ob er wirklich eine solche phänomenologische Intuition hatte, lässt sich allerdings bei dem schmalen Quellenbestand nicht ermitteln. Dieser lässt eine solche Interpretation zu, die wiederum eine leistungsstarke Erklärungskraft für das christologische Problem bietet: Das Wesen der Einheit Christi liegt in seiner Erscheinung und damit außerhalb seiner selbst, ohne dabei aber etwas Drittes oder eine doketistische Gestalt oder ein Mischwesen zu werden. Die beiden Naturen widersprechen sich, aber es ist kein Widerspruch, dass in einem Gesicht beides zugleich erscheint, ohne dass es sich in dieser Erscheinung voneinander abgrenzen lässt.
Zwei Rückfragen bringen dieses Erklärungsmodell dennoch ins Schwanken. Beide Fragen haben etwas miteinander zu tun. Wenn Prosopon wirklich Gesicht bedeuten und die Einheit Christi in seiner facialen Erscheinung begründet sein soll, stellt sich zum einen die Frage, warum Christus nicht von allen Menschen erkannt wurden, die ihm begegneten. Woran haben die Jünger oder die ersten Christen die Einheit Christi gesehen, wenn offenbar andere in ihm einen Gotteslästerer oder Menschen ohne Würde gesehen haben? Müsste nicht die Einheit des Gesichts beide Naturen als Evidenz erscheinen lassen und nicht nur als Möglichkeit?
Zum zweiten stellt sich die Frage, wie Glaubende heute die Einheit Christi erfahren können, obwohl sie ihn nicht mehr sehen und ihn nicht mehr „nach dem Fleisch kennen“ (2.Kor.5,16). Das Problem besteht nicht darin, dass unter diesen Umständen die Einheit Christi ein bloßes Postulat bleiben würde. Vielmehr würde sie nicht mehr bestehen, sobald sie nicht mehr erscheinen würde. Denn wenn zutrifft, dass das Wesen der Einheit Christi ausschließlich in der Erscheinung seines Gesichts gegeben ist, dann ist dieses Wesen nicht mehr realisiert, sobald es nicht mehr erscheint.
Auf das zweite Problem könnte immerhin phänomenologisch reagiert werden, indem das Gesicht immer die Erfahrung der Gottheit in sich schließt. Emanuel Levinas hat das Gesicht als Erfahrung des Unendlichen beschrieben, das sich nicht aus eigenen Vorstellungen extrapolieren lässt. Um die Erfahrung des Unendlichen zu machen und den Gedanken des Unendlichen zu denken, muss es im Gesicht des Anderen begegnen.[15] Levinas beschrieb über das Phänomen des Gesichts den Anderen als messianischen Menschen.[16] Da Nestorius Christus als Name für dieses Ereignis einsetzt, ließe sich seine Christologie prinzipiell auf alle Menschen übertragen. Will man die Exklusivität Christi wahren, so könnte man diese Struktur der Begegnung mit Christus bezeichnen. Christus wäre dann zwar nicht mehr ein Mensch, aber doch in einem Menschen. Das verträgt sich mit der Beobachtung, dass Nestorius auch den Namen „Gott“ auf Mose, Kyrus und andere biblische Figuren gelten lassen kann.
Auf die erste Frage, warum Christus zu Lebzeiten nicht von jedermann erkannt wurde, könnte man als Antwort vorschlagen, dass zwar jeder die Einheit aus Gottheit und Menschheit erkannt hatte, aber etliche Zeitgenossen diese Einheit geleugnet hatten. Hierfür ließen sich in der Tat biblische Zitate anführen, etwa Jesu Wort über die Unvergebbarkeit der Sünde gegen den heiligen Geist (Mt.12,31–32) oder auch sein Gespräch mit Nikodemus, in dem Jesus die Erfahrbarkeit des Evangeliums unterstreicht (Joh.3,11–12). Eine solche These, dass alle Zeitgenossen eigentlich Christus erkannt hatten, wäre allerdings spekulativ, wenn sie nicht über eine allgemeine Struktur der Christusbegegnung untermauert wird. Erst eine solche allgemeine Struktur gibt die Antwort auf die zweite Frage.
Ausgehend von der schmalen Quellenlage des Nestorius lässt sich daher eine Christologie entfalten, die eine erfahrungsbetonte Lösung auf das Problem der zwei Naturen in Christus bietet. Grillmeier betont, dass Nestorius das Erfordernis höher einschätzte als andere seiner Zeit, eine Lösung auf das Problem der substanzialen Einheit von geistigen Wesen zu finden.[17] Eine solche Lösung scheint Nestorius nicht den klassischen ontologischen Kategorien zuzutrauen. Damit war er in der Problemwahrnehmung seiner Zeit voraus – und vielleicht auch in der Lösung.