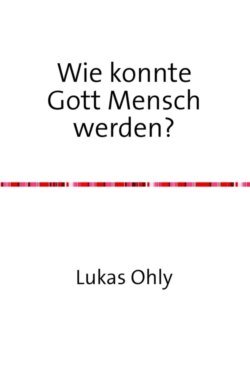Читать книгу Wie konnte Gott Mensch werden? - Lukas Ohly - Страница 11
Kommentar und Weiterführung
ОглавлениеDas genus maiestaticum ist ein Modell, das aus Luthers Ubiquitätsgedanken hervorgegangen ist. Die Ubiquität wiederum war Luthers Modell, um die Personeneinheit der beiden Naturen in Christus möglichst konsequent durchhalten zu können. Wenn Christus im Abendmahl gegenwärtig ist und wenn er in Personalunion beider Naturen besteht, dann ist er auch in seiner menschlichen Natur im Abendmahl gegenwärtig. Ansonsten würde man seine persönliche Gegenwart von den Naturen ablösen oder die zwei Naturen auf eine reduzieren. Deshalb bedarf es in der Tat eines Modells, das diese Anforderung erfüllt. Nur wenn man keine Realpräsenz Christi im Abendmahl behauptet, entfällt eine entsprechende Anforderung.
Ist aber die Realpräsenz auf das genus maiestaticum festgelegt? Zunächst erfordert die Realpräsenz beim Abendmahl nicht, dass Christus an allen Orten sein kann. Die Ubiquität kann zwar die Realpräsenz erklären, ist aber selbst begründungsbedürftig. Das genus maiestaticum versucht, diese Begründung zu geben. Wird damit aber nicht zu viel verlangt, wenn es doch zunächst nur darum geht, dass Christus beim Abendmahl präsent ist? Könnte also die Realpräsenz Christi auch ohne genus maiestaticum begründet werden?
Darauf kann eine ökumenische Antwort gegeben werden, die die Anliegen sowohl der Lutheraner als auch der Reformierten zugleich berücksichtigt. Man könnte die Prämisse fallen lassen, dass der Ausdruck „Christi Leib“ ausschließlich eine menschliche Eigenschaft beschreibt. Interessanterweise sind sich Reformierte und Lutheraner darin einig, dass sie für Gott keine Leiblichkeit zugrunde legen. Für sie bedeutet „Leib“ ausschließlich eine Eigenschaft der menschlichen Natur. Nun kann man aber unter „Leib“ das Vollzugsorgan eines Subjekts verstehen. Dieses Vollzugsorgan ist sowohl in sich als auch außer sich: Es verbindet sich mit Anderem durch seinen Vollzug. Dann hat auch Gott einen Leib. Ingolf Dalferth hat dieses Vollzugsorgan Gottes, durch das er mit anderem in Beziehung tritt[40], mit dem Heiligen Geist identifiziert.[41] Folglich wäre Gottes Leib im Wirken des Heiligen Geistes präsent. Damit lässt sich ein wesentliches Anliegen der reformierten Christologie einbringen. Nach Zwingli ereignet sich die Gnade allein im Heiligen Geist, der selbst kein Vehikel brauche, um seine Kraft wirken zu lassen.[42] Wir werden im nächsten Kapitel sehen, dass auch Calvin eine pneumatologische Lösung an die Stelle des genus maiestaticum setzt. Einigkeit hätte darüber erzielt werden können, dass der Geist das Vollzugsorgan Gottes ist, wenn es etwa heißt, dass der Geist vom Vater und vom Sohn „ausgeht“ und dem Fleisch in Christus „mitgeteilt“ wird (1041f.). Wenn Christus in den Einsetzungsworten des Abendmahls sagt: „Das ist mein Leib“, so spricht er vom göttlichen Leib, also vom Heiligen Geist. Es ist dann der Geist, der im Abendmahl ausgeteilt wird. Das hätte nicht nur ein interkonfessioneller Kompromiss zwischen Lutheranern und Reformierten sein können, der der Terminologie beider Richtungen gerecht wird. Es wäre auch für das Luthertum eine Möglichkeit, die Realpräsenz Christi zu begreifen, ohne ein überlastetes Konzept der Ubiquität und mit ihr das genus maiestaticum vertreten zu müssen.
Zwei Folgeprobleme hätten allerdings die Lutheraner dann zu lösen. Zum einen wäre offen, wie das „Blut“ im Kelchwort zu verstehen ist. Hat Gott auch ein eigenes Blut? – Zum anderen droht das Abendmahlsverständnis wegzukippen, wonach Leib und Blut Christi „nicht allein geistlich“, sondern „mündlich“ (799) empfangen werde. Wie kann der Heilige Geist geschmeckt werden?
Das erste Problem ließe sich relativ leicht lösen: Unter „Blut“ kann nämlich die menschliche Natur verstanden werden, wenn es heißt: „Das ist mein Blut des Bundes“ (Mt. 26,28; Mk.14,24) oder gar „der neue Bund in meinem Blut“ (Lk. 22,20; 1.Kor. 11,25). Das Blut der menschlichen Natur Christi ist dann nur im Gedächtnis an die Knechtsgestalt anwesend, die geschehen und nun abgelegt ist. Der neue Bund ist besiegelt worden durch das menschliche Blut Christi, das in Knechtsgestalt vergossen worden ist. Nicht das Blut muss dazu anwesend sein, sondern der Bund Gottes mit den Gläubigen ist gegenwärtig. Entsprechend könnte die Formel „mein Blut des Bundes“ die Präsenz des Bundes herausstellen und nicht die Präsenz des Blutes Christi. Das ist deswegen möglich, weil sich in dieser Formel auf „Blut“ zwei Genitive beziehen: „mein“ und „des Bundes“. Es muss sich also nicht um „mein Blut“ handeln, sondern um das „Blut des Bundes“, der von Gott („mein“) eingesetzt worden ist.
Das zweite Problem, wie Leib und Blut Christi „mündlich“ empfangen werden, wenn der Leib der Geist ist und das Blut die abgelegte Knechtsgestalt, bedarf dagegen einer genaueren Prüfung. Denn die Lutheraner weisen ja die römisch-katholische Transsubstantiationslehre zurück, wonach sich Brot und Wein in den Leib und das Blut Christi verwandeln. Schon Luther hat bekannt: „Ich glaube, daß Brot und Wein bleiben“ (H 226). Im Sakrament empfangen wir die Vergebung der Sünden „darum, daß die Wort da stehen“ (H 228). „Nicht am Brot und Wein, nicht am Leibe und Blut Christi, sondern am Wort“ (ebd.). Das Wort ist daher das Verbindungsstück, das die Identifikation zwischen Brot und Leib überhaupt erst erreicht.[43] Zwar weist Luther zurück, dass das Brot den Leib Christi nur „bedeute“ (ebd.). Und doch wird die Identifikation nur vermittelt durch das Wort. Wie in der katholischen Messe Brot und Leib Christi durch die Wandlung vermittelt wird, so wird sie im lutherischen Verständnis durch das Wort vermittelt. Das Wort ist das Vorzeichen, das überhaupt erst das Gleichheitszeichen wirkt. An dieser Stelle besteht ein Vorrang des Bedeutens vor dem Sein: Brot und Wein bedeuten das auf sinnliche Weise, was das Wort sagt. In diesem Bedeutungsrahmen aber sind Brot und Wein der Leib und das Blut Christi.
Wenn nun Christi Leib „mündlich“ empfangen wird, so wird Gottes Leib „mündlich“ empfangen, aber nicht unvermittelt, sondern durch das Wort. Ebenso wird nicht Jesu Blut getrunken, sondern der Bund Gottes geschmeckt, dessen Bedeutung im Wort gegeben wird.
Nach meinem Eindruck ist also die Realpräsenz Christi nicht auf das genus maiestaticum festgelegt. Es ist der Geist, der auch vom Sohn ausgeht und deshalb der Geist Christi ist, der im Abendmahl anwesend ist und in Brot und Wein geschmeckt wird. Anstelle der Übereignung der göttlichen Eigenschaften auf die menschliche Natur kann eine trinitätstheologische Antwort gegeben werden, wie der Leib Christi im Abendmahl präsent ist. Wird dagegen am genus maiestaticum festgehalten, so muss ein ontologisches Zwischenstück zwischen beiden Naturen gefunden werden, das beide vermittelt, ohne dass sie fusionieren. Dieses ontologische Zwischenstück habe ich in der Konkordienformel mit dem Begriff der Knechtsgestalt ausgemacht. Die Knechtsgestalt muss dabei keine eigene Natur oder Kategorie sein, wohl aber etwas ontologisch Eigenes. In meiner Weiterinterpretation ist sie ein geschichtlicher Effekt der Gemeinschaft beider Naturen. Weil die menschliche Natur nicht sterblich und unsterblich zugleich sein kann, ereignet sich unter geschichtlichen Bedingungen die Knechtsgestalt als die Darstellung dieses Widerspruchs. Gerade darin liegt die Knechtsgestalt, dass sich Christus unter irdischen Bedingungen nicht entfalten kann als der, der er ist. In seiner Erhöhung dagegen ist der Widerspruch aufgelöst, dass die erhöhte menschliche Natur unsterblich ist, obwohl sie gestorben ist. Die Eigenschaften der menschlichen Natur sind zwar vergangen, aber dennoch geschehen. Sie werden nicht dadurch rückgängig gemacht, dass die menschliche Natur nun vollständig von den übereigneten Eigenschaften der göttlichen Natur Gebrauch macht.
Abschließend möchte ich den Erklärungswert einer Communicatio Idiomatum überhaupt untersuchen, also vor allem in den beiden Genera, die zwischen Lutheranern und Reformierten unumstritten sind. Das Chalcedonense hat die Aufgabe umrissen, wie die Einheit Christi in seinen zwei Naturen zu bestimmen ist, ohne diese Aufgabe selbst übernommen zu haben. Erfüllt die Lehre von der Communicatio Idiomatum die Anforderungen des Chalcedonense? Und ist sie ontologisch adäquat? Die Communicatio Idiomatum ist der Versuch, der Personalunion der zwei Naturen gerecht zu werden und beide Naturen dabei unvermischt und ungetrennt sein zu lassen. Das Anliegen von Chalcedon ist damit sichtbar aufgegriffen worden. Die beiden unumstrittenen Genera finden jeweils in der Person das Integral der beiden Naturen. Nur beim genus maiestaticum wird dieser Weg durchbrochen. Schon darum wirkt es wie ein Fremdkörper in die Lehre der Communicatio Idiomatum.
Fraglich ist allerdings, ob die Communicatio Idiomatum mehr sein kann als eine bloße Zuschreibung von Eigenschaften im Sinne einer Sprachregelung. Oder verbindet sie auch einen ontologischen Anspruch? Beim genus maiestaticum haben wir gesehen, dass ontologische Interessen dabei leitend waren, es zu vertreten oder zurückzuweisen. Ist das auch bei den anderen Genera der Fall? Sowohl das genus idiomaticum als auch das genus apotelesmaticum schreiben den Naturen Eigenschaften zu, während sie zugleich zurückweisen, dass die Naturen diese Eigenschaften besitzen. Sie haben sie nur vermittelt über die Personeinheit. Die göttliche Natur kann nicht leiden, hat aber vermittelt über die Person Christi gelitten. Wird hier nicht ein Widerspruch vertreten, sobald ein ontologischer Anspruch vertreten wird? Als bloße Zuschreibung (1028) oder gar als hermeneutische Regel für das Verständnis biblischer Texte mag sich eine solche Paradoxie noch eignen.[44] Man müsste sich aber dann zugleich der Sache nach enthalten oder sogar inhaltliche Gehalte ontologisch zurückweisen, die hermeneutisch empfohlen werden.
Immerhin beziehen sich hermeneutische Regeln insofern auf ontologische Sachverhalte, als sie festlegen, wie etwas nicht gemeint ist. Die Communicatio Idiomatum legt hermeneutisch den ontologischen Anspruch fest, dass die beiden Naturen in Christus zu keinem Zeitpunkt seit seiner Zeugung getrennt voneinander wirken. Das Wirken einer Natur mit ihren spezifischen Eigenschaften auf die Person Christi hat immer auch Folgen für die andere Natur, weil beide persönlich miteinander verbunden sind.
Was die Communicatio Idiomatum aber offen lässt, ist die Frage, ob diese Folgen persönlicher oder natürlicher Art sind. Um diesen Unterschied zu verdeutlichen, soll das folgende Beispiel herangezogen werden: Ich kann meine Arme heben, aber nicht meine Leber. Beide haben also verschiedene Eigenschaften und sind insofern von unterschiedlicher Natur. Diese Körperteile sind aber persönlich miteinander verbunden, so dass das Wirken des einen Körperteils vermittelt über die Personeinheit auch Folgen für das andere Körperteil hat. Das Heben der Arme muss keine natürlichen Konsequenzen für die Leber haben. Wenn aber die Leber so schwer erkrankt ist, dass ich daran sterbe, dann können sich auch meine Arme nicht mehr heben. Das Wirken der Leber hat in diesem Fall also natürliche Konsequenzen für die Arme. – Umgekehrt können meine Armbewegungen aus persönlichen Gründen vollzogen werden: Ich melde mich etwa, um mich mitzuteilen, oder ich hantiere mit den Armen, um eine Handlung auszuführen, die nur für meine Person Sinn macht, nicht aber für meine Arme. In diesem Fall hat die Armbewegung persönliche Folgen für meine Leber: Meine Armbewegung verändert etwa meinen persönlichen oder sozialen Status: Ich werde drangenommen, wenn ich mich melde, oder aufgrund meiner Armbewegung erfahre ich Anerkennung. Die Leber hat die Handlung zwar nicht ausgeführt, aber die persönliche Äußerung und die Konsequenzen, die sie nach sich zieht, beziehen meine Gesamtintegration ein, zu der auch meine Leber gehört. Diese persönliche Gesamtintegration wird aber vermittelt über Ziele und Mittel, die über beide Körperteile hinausgehen und von ihnen nicht einmal erfasst werden. –
Entsprechend könnte die göttliche oder die menschliche Natur durch das Wirken der jeweils anderen entweder natürlich oder auch persönlich getroffen werden. Eine natürliche Konsequenz für die andere Natur liegt dann vor, wenn die Existenz der Person durch das Wirken einer Natur stabilisiert oder gefährdet wird. Bei Jesus hätte dies allenfalls bei der Zeugung, Lebenserhaltung oder bei seinem Tod der Fall sein können.[45] Denn das natürliche Wirken einer Natur, die nur das natürliche Sosein der Person betrifft, hat nicht einmal vermittelt über die Personeneinheit Einfluss auf die andere Natur: Ein regelmäßiges Hanteltraining muss keinen Einfluss auf die Eigenschaften der Leber haben[46], eine falsche Handbewegung im Straßenverkehr kann dagegen lebensgefährlich sein und damit auch die Leber zerstören. Dies gilt erst recht für das Verhältnis der beiden Naturen Christi, die ausschließlich vermittelt über die Personeneinheit miteinander verbunden sind, ohne sich in ihren Eigenschaften zu beeinflussen – mit Ausnahme des strittigen genus maiestaticum, das ich hier ausklammere. Nun gilt aber, dass die Person Christi mit der zweiten Person der Trinität identisch ist und folglich schon vor Annahme der menschlichen Natur ewig existiert. Dadurch ist die menschliche Natur von ihrem Beginn an durch das Wirken der göttlichen Natur beeinflusst. Ihre Existenz ist aufgrund der Personeneinheit zu keinem Zeitpunkt unabhängig vom Wirken der göttlichen Natur gewesen. Welche Konsequenz aber hat der Tod Christi für die göttliche Natur? Zwar kann die göttliche Natur nicht sterben, aber die zweite Person der Trinität ist sterblich. (Sonst wäre sein Tod nur scheinbar gewesen, wie es der Doketismus vertritt.) Mit dem Tod der Person Christi zerbricht folglich das Integral der beiden Naturen: Die göttliche Natur ist zwar weiterhin „an sich“ unsterblich – so wie auch die Leber bei einem Verkehrsunfall im „an sich“ gesunden Zustand sterben kann –, aber sie verliert ihren Bezug zu derjenigen Person, auf die sie sich richten soll. Die göttliche Natur wird also in ihren Eigenschaften von der menschlichen Natur nicht gemindert. Und doch hat der Tod durch die menschliche Natur auch natürliche Konsequenzen für die göttliche Natur.
Die Wirkung einer Natur kann auch eine persönliche Konsequenz für die jeweils andere Natur haben. Die Erniedrigung Christi wird in der Konkordienformel als Erniedrigung der Person beschrieben, die seine göttliche Natur einschließt (812). Indem er nämlich seine Gottheit im Stand der Erniedrigung nicht abgelegt hat (ebd.), hat die Erniedrigung eine persönliche Konsequenz für die göttliche Natur. Sie fügt ihr eine neue Eigenschaft hinzu, die sie aber von sich aus nicht hat und auch nicht natürlich annimmt. Eine persönliche Konsequenz der Wirkung einer Natur liegt vor, wenn diese Konsequenz für die Person Sinn macht, nicht aber für die Natur. Der Sinn liegt dann also „außerhalb“ der Natur, weil Personen ekstatisch sind und ihr Wesen außerhalb ihrer selbst finden.[47] Der Sinn einer persönlichen Handlung bezieht Horizonte außerhalb der Person ein – wie Ziele, Zeit, Zeichengebrauch (Kommunikation), Gegenstände. Werden diese Horizonte erreicht oder verfehlt, so hat das persönliche Konsequenzen, und damit auch Konsequenzen für die Naturen, ohne dass die Naturen davon natürlich angetastet werden.
Bei Luther ist bereits die Person Christi unsterblich und sterblich zugleich (H 54). Das liegt daran, dass die Eigenschaften beider Naturen auf die Person übertragen werden. Das führt zwar zu einem Widerspruch, der aber abgemildert werden kann, und zwar dann, wenn er kein natürlicher Widerspruch ist, sondern ein persönlicher. Löst man also Luthers Paradoxie über die persönliche Konsequenz der Naturen, so wäre es für die ekstatische Beziehung Christi von Belang, dass er unsterblich und sterblich zugleich ist. Der Abbruch seiner ekstatischen Beziehung zu Gott und zur Welt hätte gerade einen persönlichen Sinn für Christus. Dieser Widerspruch hätte zugleich persönliche Konsequenzen für die Naturen, würde sie aber in natürlicher Hinsicht unangetastet lassen. Der Widerspruch ist persönlich bedeutsam – etwa soteriologisch –, wird aber von keiner der beiden Naturen erfasst. Dennoch sind sie von diesem Widerspruch betroffen, aber im Sinne einer persönlichen Konsequenz.
Die Unterscheidung, ob das Wirken der Naturen für die jeweils andere natürliche oder persönliche Konsequenzen hat, ist entscheidend, um etwa den Status der menschlichen Natur im Stand der Erhöhung zu bestimmen. Kurz gefragt: Ist die menschliche Natur persönlich oder natürlich erhöht? Wenn sie natürlich erhöht ist, dann sitzt sein menschlicher Leib zur Rechten Gottes. Wenn sie dagegen persönlich erhöht ist, so kann der Leib begraben sein und nimmt dann die persönliche Konsequenz der Erhöhung nicht an. Mir scheint, dass genau diese Differenz die reformierte und die lutherische Position voneinander unterscheidet. Und das wiederum heißt, dass sie auch in den scheinbar unstrittigen Genera der Communicatio Idiomatum unterschiedliche Auffassungen haben. Während die reformierte Position dem Wirken der Naturen nur persönliche Konsequenzen für die jeweils andere Natur einräumt, beeinflussen sich zwar die Naturen für die lutherische Position auch nur vermittelt über die Person Christi, aber doch so, dass beide natürliche Konsequenzen davontragen. Nach dem genus maiestaticum soll zwar nicht die göttliche Natur eine menschliche Eigenschaft erhalten, sondern nur die menschliche die göttlichen. Wenn aber die Konkordienformel darauf beharrt, dass auch die Gottheit in Christus erniedrigt wurde, so geht diese Kritik an der reformierten Position über die Verteidigung des genus maiestaticum hinaus: Dann hat die Erniedrigung nämlich auch natürliche Konsequenzen für die göttliche Natur. Sie soll zwar nicht das Sosein der göttlichen Natur antasten, verändert aber sein Dasein in der Person Christi zu einer nur fragilen Integrität.
Hierfür könnte die entdeckte dritte Kategorie der Konkordienformel, die „Knechtsgestalt“, eine entscheidende vermittelnde Rolle spielen. Luthers beabsichtigter Widerspruch, dass die Person Christi sterblich und unsterblich zugleich ist, könnte nach der Konkordienformel ontologisch so verstanden werden: Zwar hat der Tod Christi Folgen für die göttliche Natur, weil sie dann nicht mehr persönlich integriert ist. Aber die Unsterblichkeit der Person Christi hat ebenso Folgen für die menschliche Natur, die damit auch im Tod Christi mit ihm persönlich integriert bleibt. Erst im Stand der Erhöhung wird dieser Widerspruch der natürlichen Konsequenz natürlich aufgehoben, weil dann auch die menschliche Natur unsterblich sein wird. Im Stand der „zweiten“ Erhöhung (nach der Himmelfahrt) wird damit auch die Fragilität aufgehoben, mit der die göttliche und die menschliche Natur in Christus integriert sind.