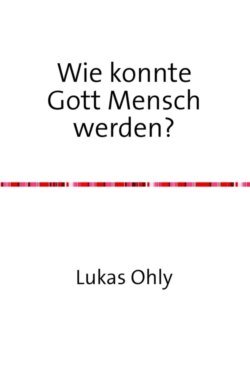Читать книгу Wie konnte Gott Mensch werden? - Lukas Ohly - Страница 7
Kommentar und Weiterführung
ОглавлениеOben hatte ich festgestellt, dass sich die Natur des Sohnes zur göttlichen Natur verhält wie ein Einzelding zu seiner Art. Nehmen wir nun dasselbe an im Verhältnis des Sohnes Gottes zur menschlichen Natur: Auch die menschliche Natur ist ja ein Artbegriff. Ist der Sohn Gottes ein Einzelding, das zur Art der menschlichen Natur gehört? Ich habe oben festgestellt, dass alles, was von der Art ausgesagt werden kann, auch von allen Einzeldingen dieser Art ausgesagt werden kann. Somit müsste alles, was von der menschlichen Natur ausgesagt werden kann, auch von der Natur des Sohnes Gottes ausgesagt werden können, wenn denn der Sohn Gottes wirklich Mensch geworden ist. Dann nämlich wäre er ein Einzelding der Art der menschlichen Natur. Cyrill scheint dies zuzugestehen, allerdings erst vom Zeitpunkt der Menschwerdung an: Dass Christus gehungert oder geschlafen habe, das könne dem göttlichen Wort nicht zugeschrieben werden, „bevor es in die Entäußerung hinabgestiegen war“ (175). „Dem menschgewordenen und entäußerten Worte aber vermögen sie keinerlei Schimpf einzutragen“ (ebd.). Denn er hat sie „sich selbst“ zugerechnet (ebd.[29]). Ansonsten bleibt Cyrill aber zögerlich und drückt abgeschwächt aus, dass Christus mit menschlichem Fleisch „umkleidet“ gewesen sei (187), so dass die menschliche Natur ihm äußerlich bleibt. Er war zwar „zusammen“ Gott und Mensch (ebd.[30]), aber so, „daß die Menschwerdung ihm unbestritten die Möglichkeit gibt, dem Fleische nach zu leiden, der Gottheit nach aber nicht zu leiden“ (ebd.).
Sobald aber die menschliche Natur als Art verstanden wird, zu der auch der Sohn Gottes gehört, entstehen haltlose Aporien. Da dem Einzelding alles zugeschrieben werden kann, was auch seiner Art zugeschrieben werden kann, so enthält die Natur des Sohnes Widersprüche. Diese Widersprüche liegen darin begründet, dass der Sohn Gottes dann nämlich zwei Arten zugehört, deren Naturen sich gegenseitig ausschließen. Christus ist dann nämlich nach seiner Natur unwandelbar und wandelbar, leidensunfähig und leidensfähig. Deshalb kann die menschliche Natur nicht als Artbegriff für die Natur des Sohnes Gottes verwendet werden.
Ist vielleicht die Umkehrung denkbar, dass also die menschliche Natur wie eine Unterart zur Natur des Sohnes Gottes gehört? In diesem Fall müsste alles, was von der Natur des Sohnes Gottes ausgesagt werden kann, auch von der menschlichen Natur ausgesagt werden. Das überzeugt aber ebenso wenig, weil der Sohn Gottes zur Art der Gottheit gehört, die wiederum unwandelbar und leidensunfähig ist, was für die menschliche Natur nicht gilt.
Somit bleiben nur folgende Alternativen:
1. Die menschliche Natur und die Natur des Sohnes liegen zwar auf verschiedenen ontologischen Ebenen, haben aber nichts miteinander zu tun. In diesem Fall freilich lässt sich auch nicht mehr sagen, dass der Sohn Gottes wahrer Mensch ist.
2. Die menschliche Natur und die Natur des Sohnes liegen auf derselben ontologischen Ebene. Beide gehören ihrerseits zwar verschiedenen Arten zu, bilden aber nichtsdestotrotz eine Einheit. Cyrill verwendet hierfür die Analogie von Leib und Seele, die beide zwar unterschiedlichen Arten zugehören – der Leib ist materiell, die Seele geistig –, aber „zusammen“ eine Einheit bilden (143). Somit scheint Cyrill sich für diese Option zu entscheiden.
Die Gefahr an dieser zweiten Erklärung liegt zwar darin, dass Christus dann ein Drittes zu werden droht, das weder Gott noch Mensch ist. Denn ebenso bilden Leib und Seele zwar den Menschen, ohne aber selbst ein Mensch zu sein. Diese Gefahr scheint aber gebannt werden zu können. Denn Christus ist sehr wohl Mensch und Gott, aber nicht menschliche oder göttliche Natur. Beide, die menschliche und die göttliche Natur bilden zusammen Christus, ohne aber Christus zu sein. Ebenso wie Leib und Seele immerhin menschlich sind, also zum Menschen gehören, gehören die göttliche und menschliche Natur zu Christus. Christus hat also beides, eine menschliche und eine göttliche Natur, aber er ist nicht beides. Denn die Natur ist die Allgemeinheit, die Art von Einzeldingen, Christus ist aber keine Art, sondern Individuum. Somit kann er Mensch und Gott sein, ohne die menschliche oder göttliche Natur zu sein. Er kann jedoch nur Mensch und Gott sein, weil die menschliche und die göttliche Natur beide zu ihm gehören. Mensch und Gott verhalten sich zur menschlichen und göttlichen Natur wie das Einzelding zur Art. Nur stehen die Natur des Sohnes und die menschliche Natur nicht in einem Verhältnis von Art und Unterart oder umgekehrt.
In dieser Lösung wäre also auf der individuellen Ebene etwas erfüllt, was auf der Ebene der Naturen ausgeschlossen wäre. Das wiederum ist nicht ungewöhnlich, gilt doch nach diesem Arten-Schema, dass nicht alles, was von der unteren Ebene ausgesagt werden kann, von der oberen Ebene ausgesagt werden kann. Nehmen wir folgenden Beispielsatz: „Männer können keine Kinder gebären, aber Frauen schon.“ Zwar gehören Frauen und Männer zur Art der Menschen; aber dennoch können nicht die Eigenschaften von Männern und Frauen auf die Art übertragen werden, weil sonst der folgende Widerspruch entsteht: „Menschen können keine Kinder gebären, aber Menschen schon.“ Auf diese Weise scheint Cyrill durch sein Arten-Schema das Problem lösen wollen, dass Christus Gott und Mensch ist, aber sowohl die göttliche als auch die menschliche Natur diese Konjunktion ausschließen.
Beseitigt ist damit allerdings das christologische Problem noch nicht. Denn da Cyrill bisher mit der Natur des Sohnes argumentiert hat, entsteht der Widerspruch nicht erst, wenn man auf die höhere Ebene springt, sondern bereits auf der Ebene der Natur des Sohnes Gottes: Christus ist leidensfähig und leidensunfähig nach seiner Natur. Der Unterschied zum Beispiel von Männern und Frauen liegt darin, dass nicht zwei Unterarten zu einer Art gehören, sondern dass ein und dasselbe Individuum zwei Arten zugeordnet wird, die sich beide ausschließen. Somit tritt der Widerspruch bereits auf der Ebene auf, in der von Christus als Individuum gesprochen wird.
Um dieses Problem zu lösen, müssen einige Eigenschaften, die Cyrill bisher der Gottheit zugeschrieben worden sind, einzelnen Hypostasen zugeschrieben werden. Anders lässt sich etwa der Widerspruch nicht auflösen, dass Christus leidensfähig und leidensunfähig ist. Die Eigenschaft, nicht leidensfähig zu sein, könnte etwa nur dem Vater zugeschrieben werden. In der Konsequenz würde von der Gottheit gelten, dass sie leidensunfähig oder leidensfähig ist. Man tut Gott keine Gewalt an, wenn man diese Korrektur einzieht. Die Eigenschaft, leidensunfähig zu sein, wird zwar nicht mehr auf die göttliche Natur bezogen, wohl aber auf Gott, nämlich Gott den Vater. Für Christus nach der Menschwerdung gilt aber nun, dass er leidensfähig ist. Rein aus logischen Gründen kann er nicht außerdem leidensunfähig sein. Deshalb kann die Leidensunfähigkeit keine Eigenschaft der göttlichen Natur sein. Folglich besteht ein Widerspruch in dem Satz, „daß die Menschwerdung ihm (dem Eingeborenen, L.O.) unbestritten die Möglichkeit gibt, dem Fleische nach zu leiden, der Gottheit nach aber nicht zu leiden“ (187). Reformulieren wir nun die Eigenschaft der Gottheit so, dass sie leidensunfähig oder leidensfähig ist, so kann dasselbe auch vom eingeborenen Sohn ausgesagt werden. Denn aufgrund des Gesetzes der Addition, das bereits oben zur Anwendung kam, gilt für den leidensfähigen Christus, dass er leidensfähig oder leidensunfähig ist. Nun hatte ich soeben festgestellt, dass nicht alles, was von der unteren Ebene ausgesagt wird, auch von der oberen Ebene ausgesagt werden kann. Nachdem aber der Eingeborene Mensch und damit leidensfähig geworden ist, trifft auf ihn zu, was auf die Gottheit zutreffen kann, aber nicht muss. In umgekehrter Richtung lässt sich aber streng deduzieren: Auf Christus trifft zu, was auf die Gottheit zutrifft, nämlich dass sie leidensunfähig oder leidensfähig ist.
Mit diesem Vorschlag schließen sich aber auch nicht mehr die göttliche und die menschliche Natur aus. Sie sind zwar verschieden, aber dennoch kann es Individuen geben, auf die beide Naturen zutreffen. „Mia Physis“ ist zwar ein Widerspruch, nicht aber „Mia Hypostasis“. Die Natur des Sohnes bildet daher die Brücke für zwei Naturen, für die nicht gilt, dass das, was von der einen Natur ausgesagt werden kann, auch von der anderen Natur ausgesagt werden kann. Denn wenn von der menschlichen Natur ausgesagt werden kann, dass sie leidensfähig ist, dann kann dasselbe nicht von der göttlichen Natur ausgesagt werden kann, nur weil sie leidensfähig oder leidensunfähig ist. Allenfalls kann nun alles, was von der göttlichen Natur ausgesagt wird, nun auch von der menschlichen Natur ausgesagt werden. Wenn die menschliche Natur leidensfähig ist, so ist ja auch wahr, dass sie leidensfähig oder leidensunfähig ist. Christus exemplifiziert damit, dass die menschliche Natur eine Unterart der göttlichen Natur ist und Christus ein Individuum der menschlichen Unterart. Jetzt kann die menschliche Natur als Art des Sohnes Gottes fungieren, weil die Disjunktionen in der Gottheit die menschliche Natur in ihrer Art ermöglichen. Dadurch entstehen auch nicht mehr die Widersprüche, dass Christus wandelbar und unwandelbar ist, weil zur Gottheit nicht einfach nur Eigenschaften gehören, sondern disjunktive Eigenschaften.
Es ist zuzugestehen, dass dies eine Weiterführung ist, die Cyrill so nicht vertreten hat, und zwar vermutlich aus theologischen Gründen nicht. Die Differenz zwischen göttlicher und menschlicher Natur hat er als Gegensatz zum Stehen gebracht. Allerdings habe ich seinen heuristischen Ansatz verwendet, das christologische Problem dadurch zu lösen, dass man die Bezüge auf verschiedene ontologische Ebenen verteilt: Die Natur des Sohnes ist etwas anderes als die Natur der Gottheit, und auf sie treffen auch andere Eigenschaften zu. Theologisch ist die Position unhintergehbar, dass zwischen der göttlichen und der menschlichen Natur ein Unterschied besteht. Aber erst wenn man aus dieser Differenz einen Gegensatz konstruiert, entstehen die Aporien des christologische Problems. Eine Alternative besteht darin, beide Naturen kategorial zu unterscheiden, indem man sie auf zwei unterschiedliche ontologische Ebenen bringt. Genau das war der Ansatz Cyrills, der hier konsequent zu Ende geführt worden ist. Dabei habe ich auch Eigenschaften auf die trinitarischen Personen neu angeordnet, die bisher bei Cyrill der göttlichen Natur zugeordnet waren. Solche Neuanordnungen zu vollziehen und damit kategoriale Neustrukturierungen vorzunehmen, war gerade die Innovation in Cyrills Ansatz. Er hat nur nicht seinen Ansatz konsequent zu Ende verfolgt und behält dadurch die Aporien, dass von Christus alles auszusagen ist, was von seinen beiden Naturen gilt, obwohl sich beide Naturen gegenseitig ausschließen.
Akzeptiert man diesen Neuansatz, so wird die menschliche Natur eine Unterart der göttlichen Natur. Beide unterscheiden sich dadurch, dass sie auf verschiedenen ontologischen Ebenen stehen, so dass nicht alles, was von der unteren Ebene ausgesagt werden kann, auch von der oberen Ebene ausgesagt werden kann. Manche Aussagen auf der unteren Ebene führen sogar in Widersprüche, wenn sie auf die obere Ebene transformiert werden. Dies habe ich bereits mit dem obigen Beispielsatz gezeigt: „Männer können keine Kinder gebären, Frauen aber schon.“ Man kann zwar den Satz so transformieren: „Es gibt Menschen, die keine Kinder gebären können, und es gibt Menschen, die Kinder gebären können.“ Aber in diesem Fall redet man nicht von der Art, sondern von Exemplaren dieser Art. Es ist nicht einmal so, dass alles, was von der unteren Ebene ausgesagt wird, von der oberen Ebene wenigstens als Möglichkeit ausgesagt werden kann. Dies wäre etwa der Fall, wenn man artinterne Vergleiche heranzieht. Aus dem Satz: „Uschi ist kleiner als Günter“ lässt sich nicht ableiten: „Der Mensch kann kleiner sein als der Mensch.“ Allenfalls lässt sich die Disjunktion aussagen: „Der Mensch ist kleiner als der Mensch oder nicht.“ In diesem Fall verändert man aber die Eigenschaft, die wiederum auf Individuen anwendbar ist, aber etwas anderes aussagt, nämlich: „Uschi ist kleiner als sie selbst oder nicht.“ Es bleibt also dabei: Die Eigenschaften von der unteren ontologischen Ebene ist nicht auf die obere Ebene übertragbar, sondern kann dabei sogar zu Widersprüchen führen.
Diese Schlussfolgerung ist wichtig aus theologischen Gründen: Denn auch wenn nach der bisherigen Skizze die menschliche Natur eine Unterart der göttlichen Natur ist, folgt nicht, dass Gott möglicherweise ein Sünder ist, wenn der Mensch zum Sünder wird. Dass Gott sündigt, wäre ein logischer Widerspruch, der Gott von sich selbst trennen würde, während die Sünde beim Menschen ein faktischer Widerspruch ist, der den Menschen von Gott trennt. Die kategoriale Differenz zwischen Gott und Mensch muss also keinen ontologischen Gegensatz zwischen beiden Naturen voraussetzen, um dennoch zu behaupten, dass der Mensch Sünder ist, Gott aber nicht einmal der Möglichkeit nach Sünder werden kann.
Meine hier vorgeschlagene Lösung war allerdings nur möglich, weil sie ein Grundproblem zugelassen hat, das bereits in Cyrills Ansatz liegt und theologisch fragwürdig ist. Wir hatten oben festgestellt, dass sich bei Cyrill die Gottheit zu Gott dem Sohn verhält wie die Art zum Individuum. Folglich gehört zur Gottheit die Eigenschaft, Vater oder Sohn oder Geist zu sein. Dies ist aber eine deutliche Abweichung vom trinitarischen Bekenntnis, dass Gott Vater und Sohn und Geist ist. Anstelle einer trinitarischen Einheit der Gottheit legt Cyrill somit einen Modalismus zugrunde, wonach Gott immer nur in einer der drei Personen erscheint, aber nie zusammen. Diese Konsequenz ist unvermeidlich, sobald Gottheit und die trinitarischen Hypostasen unterschieden werden wie Art und Individuen. Der Ansatzpunkt Cyrills ist die Unterscheidung der göttlichen Natur von der Natur des Sohnes Gottes: „Er war vielmehr als Gott gleichewig mit dem zeugenden Vater und aus ihm der Natur nach in unaussprechlicher Weise geboren“ (116): Zur Natur des Sohnes gehört das Geborensein, während zur Natur des Vaters das Zeugen des Sohnes gehört (B 226). Die Naturen Gottes und die göttliche Natur (Gottheit) werden also auf unterschiedlichen ontologischen Ebenen verhandelt. Hätte Cyrill dagegen die Gottheit bestimmt als „Vater und Sohn und Geist“, so hätte die Natur des Sohnes nicht als Exemplar einer Art aufgefasst werden können. Denn vom Sohn lässt sich nicht aussagen, dass er „Vater und Sohn und Geist“ ist. Es trifft also dann nicht alles auf den Sohn zu, was auf die göttliche Natur zutrifft. Der Modalismus ist daher eine unausweichliche Konsequenz, wenn man Cyrills Ansatz befolgt.
Mit dem Modalismus allerdings entstehen erhebliche theologische Probleme: Entweder sind die göttlichen Hypostasen nur Erscheinungen der Gottheit. In diesem Fall haben sie keine eigene Natur, weil sie nichts Reales sind, sondern nur Erscheinungen.[31] Oder aber es gibt drei Götter, zwar nie gleichzeitig, aber abwechselnd nacheinander. Das widerspricht dem Bekenntnis von Nicäa-Konstantinopel, wonach die göttlichen Personen wesensgleich der eine Gott sind. Cyrills Ansatz ist aus diesen Gründen von vornherein theologisch aporetisch. Seine philosophische Heuristik fasziniert zwar und scheint zunächst zu Klärungen zu führen. Konsequent lassen sich diese Klärungen aber auch nur mit einem erheblichen Aufwand herbeiführen, bei denen auch die Eigenschaften der göttlichen Natur auf einzelne göttliche Personen verlagert werden müssen. Der theologische Umbau, den Cyrills Ansatz erzwingt, scheint mir daher aufwändiger und theologisch unstimmiger zu sein als der, den man im Anschluss an Nestorius durchführen kann.