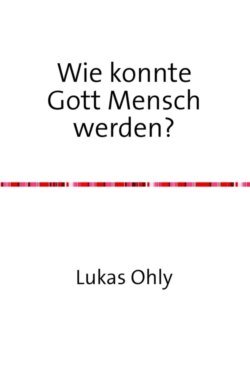Читать книгу Wie konnte Gott Mensch werden? - Lukas Ohly - Страница 3
Einleitung
ОглавлениеBestimmt hätte Gott auch einfach irgendjemanden von den Toten auferwecken können. Spätestens zu diesem Zeitpunkt käme aber die Frage auf, wie viel von seinem Menschsein dann noch übrig geblieben wäre. Dieselbe Frage reicht ins Leben dieses Menschen, sobald seine Auferweckung in Zusammenhang zu seinem Leben steht. Wenn es dieser Mensch gewesen ist, der aus Nazareth kam, einige Jahre um den See Genezareth herumstrich, um dort das Reich Gottes anzusagen – und der dann schließlich von Gott auferweckt wurde, dann wird der Zusammenhang fraglich zwischen seinem Menschsein und dem, was durch seine Auferweckung von seinem Menschsein übrig geblieben wäre. In einer zeitlichen Abfolge lässt sich dieser Zusammenhang nicht darstellen: Denn nehmen wir einmal an, dieser Mensch wäre bis zu seinem Tod ein Mensch gewesen und nach seiner Auferweckung zu einem anderen Wesen verwandelt worden. Welche ontologische Basis besteht dann noch, in beiden Stadien von demselben Wesen zu sprechen? Selbst eine Referenztheorie, die auf einen und denselben Gegenstand referiert[1], ohne dabei auf seine Eigenschaften Bezug zu nehmen, führt hier nicht weiter. Denn dazu müssten zumindest die faktischen Bedingungen, unter denen wir einen Gegenstand erstmalig identifizieren, auf alle kontrafaktischen Situationen zutreffen, in denen wir noch von ihm reden und auf ihn referieren.[2] Dann wäre also dieser Auferweckte immer schon ein anderes Wesen gewesen. Und das heißt, dass er entweder nie ein Mensch war (Doketismus) oder dass er eine Art Zwitterwesen zwischen Mensch und Übermensch ist.
Nehmen wir dagegen an, es sei einem Menschen möglich, von den Toten aufzuerstehen. Dabei sei nicht eine Rückkehr ins irdische Leben gemeint, sondern eine Existenzweise, die mit den traditionellen Begriffen „Himmelfahrt“ und „Sitzen zur Rechten des Vaters“ verknüpft ist. Immerhin nehmen Christen an, dass sie auch einmal von den Toten auferstehen werden. Dann besitzen Menschen also mögliche Eigenschaften, die sie zurzeit noch nicht realisieren können aufgrund ihrer spezifischen menschlichen Natur. Verändert sich dann nicht ihre Natur, sobald sie von den Toten auferstehen? Wenn sie sich aber nicht verändern soll und dennoch die Auferstehung für die menschliche Fortexistenz nach dem Tod wesentlich ist, so muss eine naturinterne Differenz unterstellt werden: Es verträgt sich dann mit der menschlichen Natur, dass sie Eigenschaften annehmen kann, die sie verändern, ohne dass sie dabei eine andere Natur wird. In diesem Fall muss die Identität der Menschen durch etwas sichergestellt werden, das nicht ihre Natur allein sicherstellen kann, aber doch mit ihr vereinbar ist. Diese Strategie verfolgt die christliche Zweinaturenlehre.
Die Zweinaturenlehre ist das ontologische Zentrum des christlichen Glaubens. Sie erschöpft sich nicht nur in der Frage, wie Jesus sowohl Gott als auch Mensch sein konnte. Denn wie wir eben gesehen haben, schließen zentrale Motive des christlichen Glaubens ein Wirklichkeitsverständnis ein, in dem auch unser Menschsein auf dem Spiel steht. Die Aussage, dass Gott Mensch wurde, ist zwar nicht der historische Ausgangspunkt des christlichen Glaubens, sondern die Erfahrung der Auferstehung Jesu von den Toten. Es ist aber folgerichtig, das Verhältnis seines Menschseins mit seinen Eigenschaften zu reflektieren, die seit seiner Auferstehung hinzugekommen sind. Dass Gott Mensch wurde, reflektiert also in geltungslogischer Hinsicht das Erste, während die Auferstehung Jesu dann das Zweite ist.
Damit ist aber nur das Problem formuliert und noch nicht gelöst. Wie Gott Mensch werden konnte, ohne beides zu relativieren oder in einem Dritten („Zwitter“) aufzuheben, ist die entscheidende Herausforderung der christlichen Ontologie. Es geht um nichts weniger als um das Zusammensein Gottes bei den Menschen: Wie kann Gott bei seiner Schöpfung sein, ohne selbst zum Geschöpf zu werden? Wie kann er Mensch werden, ohne seine Gottheit aufzugeben? Dieses Problem werde ich im Fortgang das „Problem der Zweinaturenlehre“, das „Zweinaturenproblem“ oder das „christologische Problem“ nennen.
In diesem Buch habe ich 16 theologische Modelle zur Zweinaturenlehre konstruktiv dargestellt. Ich lasse es also nicht dabei bewenden, diese Modelle nachzuerzählen. Vielmehr benutze ich sie als Werkzeuge, um das Herzstück der Ontologie des christlichen Glaubens zu entfalten. Insofern werden meine Interpretationen manchem Leser etwas kühn vorkommen. Ich bohre tief, um Aufschluss über das Wirklichkeitsverständnis des christlichen Glaubens zu bekommen, das in diesen Modellen zum Ausdruck gebracht wird. Jedes Modell wird daher etwa in gleichen Anteilen einen schwerpunktmäßig referierenden Abschnitt und eine kritische Weiterführung enthalten. Doch selbst diese Abschnitte sind nicht methodisch klar getrennt, sondern geben nur eine Tendenz meiner Interpretationsarbeit wieder. Theologische Fortgeschrittene werden teilweise andere Schlüsse ziehen, als ich es tue. Falls es so ist, so handelt es sich auf meiner Seite um ein produktives Missverstehen der Sache wegen. Nicht primär der jeweilige Autor soll zu seinem Recht kommen, sondern die Sache, die er meint.[3]
Dieses Buch ist zugleich mit einer hohen Wertschätzung für die geistigen Werke der behandelten Autoren verbunden. Ich teile sie nicht ein in orthodoxe und häretische Autoren und fühle mich in der Interpretation einer bestimmten konfessionellen Prägung aus methodischen Gründen nicht verbunden. Glücklicherweise sind die Zeiten überwunden, in denen Theologen mit ihrem Denken riskierten, auf dem Scheiterhaufen zu landen. Diese sachliche Entkrampfung führt dazu, dass sie auf Augenhöhe zueinander behandelt werden können. Zugleich kann spielerisch mit ihren Gedanken umgegangen werden. Die Auseinandersetzung mit jedem einzelnen Autor war für mich außerordentlich fruchtbar, weil ich das Wahrheitsinteresse jedes einzelnen Modells stark gespürt habe. Deshalb habe ich stets in meiner Weiterführung versucht, das jeweilige Modell so weiterzuentwickeln, dass es so stark wie möglich wird und das Problem der Zweinaturenlehre möglichst umfassend löst. Diese Weiterführungen sollen jeweils meine Wertschätzung für die Autoren bezeugen. Deshalb werde ich versuchen, aus ihren eigenen Modellressourcen schlüssige Fortentwicklungen zu generieren. Ich halte Theologie für Modellierungsarbeit[4], weswegen ich frei, spielerisch und konstruktiv mit theologischen Lehrentwicklungen umgehe.
Bei der Auswahl der Autoren liegt der klare Schwerpunkt in der Modellentwicklung der deutschsprachigen evangelischen Theologie des 20. Jahrhunderts. Die übrigen Autoren oder die Konzilsentscheidung von Chalcedon sind dagegen vor allem aus hermeneutischen Gründen ausgewählt worden, um eine grobe Linie zur methodischen Herangehensweise zu ziehen, wie sie die Theologie im 20. Jahrhundert prägt. Paradigmatisch für die christologische Lehrentwicklung war der sogenannte nestorianische Streit zwischen dem Bischof von Konstantinopel Nestorius und dem alexandrinischen Bischof Cyrill im 5. Jahrhundert. In der Folge führte er zum zentralen christologischen Dogma von Chalcedon im Jahr 451. Diese drei Modelle werden jedoch weitgehend für sich untersucht, ohne auf den kirchengeschichtlichen und politischen Kontext einzugehen. Auf diese Weise soll jedes Modell vorbehaltlos auf seine Stärken hin untersucht werden.
Eine zweite zentrale theologiegeschichtliche Auseinandersetzung zeigt sich in den innerreformatorischen Meinungsverschiedenheiten zur Präsenz Christi beim Abendmahl. Ihnen liegt zwar das gemeinsame Modell der Communicatio Idiomatum zugrunde, das im entsprechenden Kapitel auch als hermeneutische Folie der Christologie untersucht und gewürdigt werden soll. Lutheraner und Reformierte brachten darüber hinaus unterschiedliche Innovationen ein, die eine eingehende Untersuchung wert sind. Zuletzt rundet der Blick auf Friedrich Schleiermachers christologischen Ansatz aus dem 19. Jahrhundert den historischen Ausflug ab. Schleiermachers Ansatz ist im ausgehenden 20. Jahrhundert vor allem von Dietrich Korsch aufgenommen und weiterentwickelt worden.
Dieses Buch soll als Lehr- und Arbeitsbuch zur eigenen intensiveren Beschäftigung mit den Primärtexten einladen. Deshalb habe ich weitgehend auf den Verweis von Sekundärliteratur verzichtet. Am ehesten bringe ich ihn in der Darstellung der altkirchlichen Texte ein, da es sich zum einen um fremdsprachige Texte handelt, die oft ungenau übersetzt sind (bei Cyrill) oder nur sehr fragmentarisch vorliegen (bei Nestorius). Sekundärliteratur hat hier eine korrektive Funktion und wird auch nur darauf beschränkt. Ansonsten aber möchte ich meine Interpretation an den Primärtexten direkt vornehmen, um den Lesern den Einstieg zu erleichtern, ihre Beobachtungen direkt an den Texten abzugleichen, ohne vorher ein Gestrüpp von Sekundärverweisen abgehen zu müssen. – Für die intensivere Beschäftigung mit den Autoren findet sich hin und wieder ein Exkurs über die literarische Abhängigkeit eines Modells von bestimmten philosophischen Richtungen – dies trifft vor allem auf meine Darstellung von Paul Tillich und Hermann Deuser zu. Solche Exkurse sollen Denkfiguren leichter nachvollziehbar machen und Anschlusspunkte für eine vertiefende Beschäftigung setzen, sind aber ansonsten für die Erstbegegnung mit den Texten entbehrlich.
Am Anfang jedes Kapitels stelle ich einen oder zwei Literaturtipps voran, in denen sich die Leser „aus erster Hand“ über das jeweilige christologische Modell informieren können. Dabei wird auffallen, dass ich jeweils nur relativ kurze Abschnitte als zentrale Textstellen vorschlage. Zwar habe ich die vorgeschlagene Textauswahl auf die wichtigsten Passagen komprimiert, um den Lesern eine schnelle Übersicht in der Primärliteratur zu erleichtern. Dennoch überrascht, dass sich die neuzeitlichen Autoren – Schleiermacher eingeschlossen – mit dem Zentrum des christlichen Wirklichkeitsverständnisses nicht annähernd intensiv beschäftigen wie noch die Theologie bis ins Zeitalter der Reformation. Das ist ein überraschender Befund, der darauf hindeutet, dass die Probleme neuzeitlicher christologischer Lehrbildung anders gelagert erscheinen und man von der Zweinaturenlehre weniger Lösungspotenzial für diese Probleme erwartet. Fragt man etwa nach dem Sinn des Kreuzestodes, so wird in erster Linie das Theodizeeproblem berührt. Fragt man nach der Möglichkeit von Auferstehung, so werden anthropologische und/oder naturwissenschaftliche Fragen gestellt. Allerdings zeigen die behandelten Autoren, dass ihr methodischer Weg auch Konsequenzen für die Auffassung der Zweinaturenproblematik hat. Ich stelle deshalb die umgekehrte These auf, dass eine konsequente Bearbeitung des Zweinaturenproblems auch Horizonte eröffnet, wie das Kreuz Christi theologisch zu entschlüsseln ist und wie seine Auferstehung von den Toten möglich ist.
Zitatangaben aus den Quellen, denen die vorgeschlagenen Textpassagen entnommen sind, werden im Haupttext erscheinen, während die übrige Literatur wie üblich als Anmerkungen aufgeführt werden.
Als Lehr- und Arbeitsbuch ist dieses Buch nicht darauf angelegt, dass es kontinuierlich in eine Richtung gelesen wird. Ich selbst habe die Kapitel nicht in der chronologischen Reihenfolge geschrieben, wie sie jetzt vorliegen. Die Leser können sich ihre „Rosinen rauspicken“. Sie können sich sowohl auf die Autoren konzentrieren, die sie besonders interessieren, als auch sich entscheiden, ob sie ausschließlich referierende Abschnitte lesen möchten oder ein jeweiliges Gesamtkapitel. Kundige Leser werden bei ihrer Lektüre ihren Schwerpunkt in meiner konstruktiven Weiterführung setzen. Das Buch gibt keine fertigen Antworten, sondern gibt einen Werkstattbericht für eine Arbeit, die es wert ist, fortgesetzt zu werden.[5]