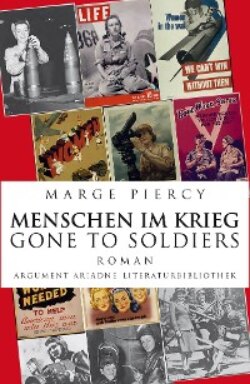Читать книгу Menschen im Krieg – Gone to Soldiers - Marge Piercy - Страница 14
An einem kalten Sonntag
ОглавлениеLady Hamilton, das war der Film, den sich Bernice und Mrs. Augustine am Sonntagnachmittag ansahen, wobei sie sich eine Schachtel kandierten Puffmais teilten, für den Mrs. Augustine eine Schwäche hatte. Mrs. Augustine war die Frau von Professor Emil Augustine, der Chemie unterrichtete. Sie war eine kleine, rundliche Frau, die an leichter Arthritis und schrecklichen Hühneraugen litt, so dass sie nur langsam und unter Schmerzen lief, aber sie hatte immer versucht, ein Auge auf den Haushalt nebenan zu haben, seit Viola gestorben oder, wie Mrs. Augustine es ausdrückte, hinübergegangen war.
Mrs. Augustine glaubte an die Reinkarnation, denn, so erklärte sie Bernice, das sei so unvergleichlich viel fröhlicher als Himmel und Hölle der Christen. Das hinderte sie nicht daran, die episkopalen Gottesdienste zu besuchen, in Begleitung ihres Mannes, der sich nicht für Mrs. Augustines abseitigere Ansichten interessierte. Mrs. Augustine schnitt Zeitungsartikel über Menschen aus, die meinten, sich an frühere Leben zu erinnern. Die meisten der Befragten waren ägyptische Prinzessinnen gewesen, die Kaiserin von Russland, die Pawlowa oder Lord Byron, aber Mrs. Augustine konnte sich das Leben als Leuchtturmwärter vor der Küste von Maine um 1840 ins Gedächtnis rufen. Sie war zu sehr der Flasche zugetan gewesen und hatte sich deshalb auf den Felsen ihres Inselchens zu Tode gestürzt, aber ansonsten war das Leben angenehm gewesen, und sie hatte sich nie einsam gefühlt. Bernice dachte im Stillen, wenn sie ihr Leben mit dem spröden Emil zu verbringen hätte, dann mochte ein Dasein als Leuchtturmwärter eine angenehme Alternative darstellen.
Vivien Leigh war zauberhaft und Laurence Olivier schön anzuschauen, aber sie ertappte sich dabei, dass ihre Gedanken von dem Ehebruch abschweiften. Ihr fiel ein Porträt von Lord Nelson ein – war es in der Londoner Nationalgalerie gewesen? Einer von den Tagen, an denen sie Touristen im Zuckeltrab durch drei Museen führten und Jeff sich heiser redete.
Der Professor übernahm die Führung, wenn Schlösser und Denkmäler auf dem Programm standen, eine Aufteilung, die nicht immer säuberlich eingehalten wurde. Sie erinnerte sich an den Sommer von 1939, der letzte Sommer, in dem sie des Professors Schützlinge durch Europa gescheucht hatten. Für einen Augenblick roch sie Salz und aufgeheizten Stein. Ihre Arme waren dunkel von der Mittelmeersonne, indes sie einen kurzen Urlaub vom Urlaub ihrer Schützlinge genoss, süße gestohlene Zeit, um selbst Touristin zu spielen.
Jeff und sie hatten am Hafen von Thessaloniki gesessen, Retsina getrunken und die süßlich schmeckenden kleinen Muscheln roh gegessen (wovon sie ihren Touristen stets abrieten), gefolgt von gebratenen kleinen Tintenfischen, Kalamarakia. Ihre Reisegesellschaft besichtigte die Hagia Sophia und andere wichtige Kirchen in der Altstadt. Der Professor hatte eine Schwäche für die mit beschwörendem Ernst dreinschauenden byzantinischen Heiligen, die seinen Kindern abging. Jeff und der Professor hatten täglich die Zeitungen verfolgt, aus Angst, vom Kriegsausbruch überrascht zu werden, aber sie hatten ihr Schiff bestiegen und waren mitten auf dem Atlantik, als die Deutschen in Polen einfielen. Dieses Jahr im April, nachdem die griechische Armee die Italiener über den Herbst und den Winter hinweg abgewehrt hatte, waren die Deutschen mit ihren Panzertruppen angerückt, hatten die Griechen niedergewalzt und die verfügbaren britischen Streitkräfte überrollt. Ob sie Griechenland je wiedersah?
Nach dem Film ging das Licht an, und die Leute standen auf. Bernice zog gerade die Reißverschlüsse der Gummigaloschen über ihren Schnürschuhen zu, als sie sah, dass Mr. Berg, der korpulente alte Herr, der das Filmtheater betrieb, auf der Bühne stand und ein Mikrophon hielt, dessen Schnur ein Platzanweiser auszurollen versuchte.
»Ich habe eine Durchsage, meine Damen und Herren!«, verkündete er mit Stentorstimme, zu aufgeregt, um abzuwarten, bis das Mikrophon eingestöpselt war. Er schritt auf die Vorbühne, auf der sonst Varieté dargeboten wurde. »Ich habe eine wichtige Durchsage. Im Radio ist durchgegeben worden, dass die Marine in Honolulu angegriffen wird. Ich wiederhole, die Marine der Vereinigten Staaten wird angegriffen.«
Mrs. Augustine sagte: »Gott sei Dank ist Emil zu alt für die Front.«
Als Bernice ins Haus kam, hatte der Professor sein Arbeitszimmer verlassen und saß im Wohnzimmer vor der Westinghouse-Radiotruhe, deren Türen geöffnet, deren Skala erleuchtet und deren Lautsprecher voll aufgedreht waren.
»Im Bentham gab es eine Durchsage.« Bernice setzte sich in ihren gewohnten Sessel. »Ist Krieg?«
»Mit Japan, nehme ich an. Jetzt muss er den Krieg erklären.«
»Hat der Präsident schon über Rundfunk gesprochen?«
»Noch nicht.«
Bernice starrte auf das Glimmen der Radioskala. Sie hatte, bevor sie ging, einen Schmorbraten in den Herd getan, bei kleiner Flamme. Der Professor jedoch sah sie über den Brillenrand hinweg erwartungsvoll an. »Wann werden wir essen?«
Das war keine ernst gemeinte Frage, da sie am Sonntag immer um halb sieben aßen, doch sie übersetzte sich ihr als: Was sitzt du im Wohnzimmer herum, wo der Tisch noch nicht gedeckt ist und die letzten Handgriffe zur Zubereitung meiner Mahlzeit fehlen? Sie ging langsam in die Küche und stellte überrascht fest, dass sie sich leicht euphorisch fühlte, fast schwindelig. Sie drehte sofort das kleine Radio auf dem Küchenbüfett an.
Major George Fielding Eliot, Columbias Militärexperte, analysierte die Ereignisse mit forscher Stimme. »Die Japaner scheinen zum Angriff überzugehen, um amerikanische Operationen im Fernen Osten zu verzögern. Vor eine Situation gestellt, in der es für sie offenbar keinen anderen Ausweg als den Krieg gab, haben die Japaner den größten amerikanischen Pazifik-Marinestützpunkt in Pearl Harbour auf der Insel Oahu der Hawaii-Inseln angegriffen. Dieser Angriff erfolgt aus der Luft und kann nur von Flugzeugträgern kommen, da die Japaner über keine Stützpunkte nahe genug bei den Inseln verfügen, um landgestützte Luftangriffe vortragen zu können.«
Sie erinnerte sich an einen Abend, an dem Zach Jeff besucht hatte. Tagsüber hatte Zach seine Aeronca eingeflogen, für Bernice ein Vorgeschmack des Himmels. Sie erfuhr, Zach lebte von seiner Frau getrennt, obwohl sie ein Kind erwartete. In jenem Monat war Amelia Earhart auf einer Teilstrecke ihres Fluges rund um die Erde bei den Marshall-Inseln verschollen. Zach beharrte darauf, sie sei von den Japanern abgeschossen worden, weil sie Aufklärungsflüge für Roosevelt gemacht habe, der eigens für sie eine Behelfsbahn auf Howard Island bauen ließ. Jeff und Zach reizten Bernice bis aufs Blut, weil beide ganz sachlich erörterten, was ihr als Verlust naheging. Sie hatte in der Überzeugung gelebt, ihrem Idol eines Tages zu begegnen, ein Foto von ihr aus der Zeitung geschnitten und sich an die Wand gehängt, zwischen Jeffs frühe und neuere Landschaften.
Das Radio redete neunmalklug in ihre Träumerei. »Die Japaner sind ein sehr großes Risiko eingegangen, ihre Flugzeugträger in die Reichweite unserer äußerst leistungsstarken Marineaufklärungsbomber und unserer auf der Insel Oahu stationierten Langstreckenbomber gebracht zu haben. Ein Risiko, das sich nur als verzweifelte Maßnahme interpretieren lässt, die zum Verlust am Angriff beteiligter Flugzeugträger führen kann, die allerdings auch unsere Pazifikflotte auf ihrem Weg in den Westpazifik aufhalten und damit den Japanern wichtige Zeitgewinne für Operationen im Fernen Osten verschaffen kann.«
Durch die forsche, selbstsichere Stimme klangen die Nachrichten halbwegs beruhigend. Der Major hätte die Anweisungen des Trainers in einem Baseballspiel beschreiben können oder auch ihre eigenen Gedankengänge, wenn sie mit ihrem Vater Schach spielte. Sie schämte sich ihrer Hochstimmung. Vielleicht bedeuteten diese Ereignisse gar nicht unbedingt Krieg; vielleicht trat der Krieg in Form von ebensolchen gebieterischen Männerstimmen in ihr Leben, die ferne Ursachen und Wirkungen erläuterten: ein Unglück zwar, aber weniger bedrückend als die Weltwirtschaftskrise.
Zeit, den Blumenkohl aufzusetzen und die Soße zu bereiten.
Oscar hatte recht, das spanische Restaurant war gut. Louise bestellte Paella und Oscar eine Zarzuela de maresco: Riesengarnelen, Hummer, Venus- und Miesmuscheln in einer knoblauch- und safrangewürzten Tomatensauce. Sie bedauerte, das nicht auch bestellt zu haben, obwohl ihre Paella hervorragend war. Typisch Oscar, genau zu wissen, was man am besten bestellte. Er war kein versnobter Feinschmecker, doch schien er stets die richtige Wahl durch die Poren zu wittern, vielleicht, weil er neugierig war und keine Scheu hatte, den Kellner zu fragen, was das Paar am Nebentisch aß. Das hatte ihnen über die Jahre zu einigen denkwürdigen Mahlzeiten verholfen, die meisten davon gut, manche einfach nur denkwürdig wie ihr Verzehr von Seeigeln in einem chinesischen Restaurant.
Sie begannen mit einem Glas trockenem Sherry, dann teilten sie sich eine Flasche weißen Rioja. Oscar redete über sein Projekt der Flüchtlingsbefragung. Louise hatte gute Antennen. Sie beobachtete sein Gesicht, als sie bemerkte: »Ich könnte mir vorstellen, dass viele von diesen Auskünften für den Geheimdienst interessant sind? Ich gehe davon aus, die Regierung ist zu der Einsicht fähig, dass wir früher oder später in diesen Krieg hineingezogen werden?«
»Hmmm«, sagte Oscar. »Möchtest du noch mal von meiner Zarzuela kosten? Ich sehe, du beäugst sie mit gewissem Interesse.«
»Deine Zarzuela, also wirklich, Oscar.« Sie bediente sich. Sie hatte die Antwort, aber nur teilweise. Für wen genau arbeitete er?
»Ich hätte nichts gegen eine Kostprobe von deiner, überhaupt nichts. Es ist lange her.«
»Schämst du dich gar nicht, Oscar, du versuchst, mich zu verführen, um meine Frage nicht zu beantworten. Was sie letztendlich beantwortet.«
»Dich zu verführen steht a priori auf dem Programm. Zumindest der Versuch. Früher gelang mir das.« Er schenkte ihr Glas wieder voll. »Hat sich dein Herz gänzlich gegen mich verhärtet?« Er versuchte, seelenvoll dreinzuschauen, wirkte aber nur jungenhaft, was vollauf genügte.
»Du hast dir doch nicht eingebildet, ich ginge mit meinem Exmann in ein Hotel?«
»Dafür sind wir zu kultiviert, und außerdem haben wir beide gemütliche, geräumige Wohnungen. Ich denke öfter an dich, als du weißt, Louie. Öfter, als du glaubst.«
»Das stimmt wahrscheinlich.« Ihrer festen Überzeugung nach war sie diejenige, die ständig über Oscar nachgrübelte, doch sie hegte keinerlei Absicht, das einzugestehen.
»Ein kalter, windiger Sonntag. Wie könnte man ihn besser nutzen? Ich habe einen phantastischen Oloroso, den mir ein Freund mitgebracht hat.«
»Ich dachte, du hast Madeleine inthronisiert, die derzeitige Gebieterin deines Herzens.«
»Louie, du hast das immer überschätzt. Ich kam ihr gerade recht, ein alter Freund in einem neuen Land. Sie ist bei der University of California in Los Angeles untergekommen. Mit Hilfe des psychoanalytischen Netzwerks.«
»Eins möchte ich wissen. Wer wurde überdrüssig, du oder Madeleine?«
»Louie, New York wimmelt von geflüchteten Psychoanalytikern. Madeleine konnte hier nicht Fuß fassen. Los Angeles ist für sie nicht fremder als New York, und ihr wurde ein Lehrauftrag angeboten. Sie wird sich dort einrichten und bald eine eigene Praxis haben.«
Sie konnte bei Oscar nicht die leisesten Anzeichen von gebrochenem Herzen ausmachen. Er schien die nachrichtendienstliche Verbindung, die er mit Informationen fütterte, eher verbergen zu müssen als das, was von seiner Beziehung zu Madeleine Blufeld blieb, blonde, elegante Österreicherin und einer der Gründe für ihre Scheidung, aus Louises Sicht. Zweifellos sagte er ihr die Wahrheit, wie er sie sah; Madeleine musste um ihres beruflichen Fortkommens willen in den Westen gehen und Oscar nicht. Zweifellos rechnete er darauf, wieder mit Madeleine anzubandeln, wenn sie gelegentlich nach New York kam. Zweifellos rechnete er auf ein romantisches Tête-à-Tête, sollten die Umstände ihn nach Südkalifornien führen. Oscar mochte keine endgültigen Abschiede.
»Du siehst dermaßen entzückend aus, Louie, selbst wenn ich nicht die ganze Woche an dich gedacht hätte, dich so am Tisch zu sehen wie ein Strauß roter Rosen würde schon genügen, meine Gedanken an dich zu fesseln.« Oscar machte nicht viele Komplimente. Zweifellos merkte er – obwohl er wahrscheinlich nie verstanden hätte, warum –, dass die Erwähnung von Madeleine die Stimmung, um die er sich bemühte, etwas gedämpft hatte. Oscar war auf seine unkonventionelle Art ein sentimentaler Mensch, und sie musste davon ausgehen, dass er es durchaus passend fand, einen Teil ihres ehemaligen Hochzeitstages im Bett zu verbringen.
Das Problem dabei war, sie fand ihn trotz aller abstrakten Empörung immer noch überwältigend attraktiv. Er schien Hitze zu verströmen. Seine dunklen Augen strahlten sie an, er beugte die breiten Schultern über den Tisch, und seine großen, wohlgeformten Hände, auf deren Rücken und Fingergliedern üppiges Haar wuchs wie ein gepflegter schwarzer Rasen, näherten sich über die Tischplatte, gestikulierten, schenkten ständig Wein nach, reichten ihr Häppchen, beanspruchten Platz, rückten vor. Ach, was soll’s, dachte Louise, warum nicht? Madeleine ist über alle Berge, und ich kann mir beim besten Willen nicht viel Verlangen nach Dennis abringen. Ich werde nicht zulassen, dass ich das ernst nehme. Ich werde nicht zulassen, dass ich verletzt werde. Diesmal nicht. Ich werde ihn so nehmen, wie Männer Frauen nehmen, und dann nach Hause fahren, mich mit Dennis zu einem netten, kultivierten und ziemlich langweiligen Abend treffen und morgen schon früh an die Arbeit gehen. Warum nicht? Sie war zufrieden mit sich, richtig rücksichtslos entschieden zu haben. Vielleicht war das die eigentliche Errungenschaft einer Geschiedenen, die Freiheit zu spontanen ruchlosen Entscheidungen, zu der Entscheidung, etwas zu genießen und dann davonzuspazieren.
Der Kellner, der sie anfangs umhegt hatte, war dann für weite Strecken des Mahles verschwunden. Jetzt, als Oscar die Rechnung verlangte, redete er unvermittelt auf ihn ein. »Während Sie hier sitzen, verkündet das Radio, dass Sie sich im Krieg befinden. Jawohl, Ihr Land.«
»Was ist denn?« Louise beugte sich vor. »Haben wir Deutschland den Krieg erklärt?« Ihr fiel plötzlich ein, dass dies spanische Flüchtlinge waren; sie hatten ihren Krieg gegen die Mächte des Bösen und der Reaktion geführt; den Krieg, der ihrer Generation gezeigt hatte, dass ein Volk das Recht und die Zahlen auf seiner Seite haben und doch verlieren konnte. Auch die Demokratie konnte im Krieg scheitern.
»Die Japaner haben Ihr Honolulu bombardiert. John Cameron Swayze hat es im Radio gesagt, während Sie hier saßen. Sie sagen, es geht auch jetzt noch weiter.«
»Honolulu?«, wiederholte Oscar. »Das muss ein Irrtum sein. Warum sollten sie Honolulu bombardieren? Das ist wie ein Angriff auf Miami Beach.«
»Es tut mir leid für Ihre Leute in Honolulu. Bombardiert werden, das macht einem Angst, auch wenn man tapfer ist. Man kann nichts tun. Die Bomben fallen runter wie Regen, und man kann ihnen nicht entkommen.« Der Kellner schüttelte Oscar feierlich die Hand. »Ich wünsche diesem Land Glück in seinem Krieg. Aber Sie haben das Geld, um Panzer und Flugzeuge zu kaufen. Das fehlte uns.«
Oscar gab ein Riesentrinkgeld, und sie stolperten auf die Straße. Er winkte einem Taxi. »Nein, Oscar, ich fahre zu mir. Ich möchte nach Hause zu Kay und erfahren, was wirklich vorgeht. Nochmals danke für den netten Nachmittag.« Sie nahm seine Hand und gab ihm einen festen Händedruck. »Bis bald.«
Oscar war zu baff, um zu widersprechen, obwohl sein Mund auf- und zuging und er die Hand ausstreckte, als wollte er sie hindern, ins Taxi zu steigen. Er war ebenfalls verwirrt von den Nachrichten und ungeduldig, das Radio anzustellen. Er wandte sich um und suchte den heranströmenden Verkehr nach einem weiteren Taxi ab. Als ihres abfuhr, sah sie ihn rasch die Vierzehnte Straße entlanggehen und zu seiner Wohnung in der Vierten West eilen.
»Es ist nicht Honolulu, es ist der Marinestützpunkt in Pearl Harbour«, sagte der Taxifahrer. »Ein Dolchstoß in den Rücken. Aber die von der Marine, das sind große Kämpfer, die haben den Japsen bestimmt Saures gegeben. Der Horde kleiner gelber Affen. Die Wichse, in die die heute reingelatscht sind, so was haben die noch nicht gesehen.«
Louise fühlte sich, als sei sie in allerletzter Sekunde vor einer Torheit bewahrt worden, ein viktorianisches Mägdelein, das vor dem aalglatten Schurken gerettet wurde, doch sie bedauerte ihre Rettung. Auch wenn sie sich wenig Illusionen über Oscars Angebot machte, war sie sich bewusst, dass tief in ihr Wunschvorstellungen kreisten, empfindlich wie tropische Fische mit hauchdünnen Schwanzschleppen, an denen andere Fische nur allzu gern geknabbert hätten. Wunschvorstellungen, so hirnlos wie Guppys, und sie nahm sich vor, sie im Dunkel ihres Rückenmarks niederzuhalten, wo sie hingehörten. Doch noch, als sie durch die Stadt zu ihrer Tochter und der Nachrichtenquelle und dem Telefon fuhr, das inzwischen bestimmt klingelte, bedauerte sie, dass der Kellner davon angefangen und es nicht ihnen überlassen hatte, es zu entdecken, nachdem sie einander wiederentdeckt hatten.
Murray rief Ruthie am frühen Abend an. »Irgendwie kann ich nicht stillsitzen«, sagte er. »Vielleicht können wir einen Spaziergang machen, einen kurzen? Ich weiß, du hast Hausaufgaben. Ich ja auch.«
Ruthie konnte ihn kaum verstehen, so laut dröhnte das Radio hinter ihr und genauso laut schmetterte das Radio hinter ihm in seinem Haus. Sie wusste, eigentlich musste sie zu Hause bleiben und lernen, aber sie war zu aufgewühlt. »Komm doch gleich vorbei«, sagte sie leise. »Ich kann nicht lange weg. Wir können einen Kaffee trinken gehen.«
Naomi trug Boston Blackie herum wie eine Babypuppe. Sie fragte: »Die Japaner, sind die wie die Deutschen?«
»Sie sind Teil der Achse. Sie sind unsere Feinde.«
»Aber hassen sie auch die Juden?«
Ruthie verwuschelte Naomis Lockenhaar. »Ich glaube, die wissen gar nicht, wer die Juden sind, Naomi.«
»Dann sind sie vielleicht nicht so schlimm.«
»Schsch!« Ruthie tippte Naomi mit dem Finger auf die Lippen. »Sag das zu keinem sonst. Nie.«
»Ich versprech’s«, sagte Naomi. »Ich weiß ja, wenn sie Bomben abwerfen, ist es egal, ob du jüdisch bist oder nicht. Sogar die Kühe werden verbrannt und liegen tot neben der Straße. Sogar die Hunde werden totgebombt.«
Murray kam innerhalb von vierzig Minuten, da er sich den alten Dodge seines Vaters geliehen hatte. Als sie ihn in seiner karierten Mütze und dem alten Tweedmantel in der Tür stehen sah, hatte sie wieder dieses Gefühl von Unbefangenheit. Er stand ein wenig scheu da, mit krummen Schultern, und lächelte sie an. Sie führte ihn so kurz ins Haus, wie sie nur konnte. Als sie etwas sagen wollte, winkte Duvey ab. Alle drängten sich um das Wohnzimmerradio.
»Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass Guam wahrscheinlich unter Angriff steht. Die Kabelgesellschaft gibt an, dass ihre Leitungen unterbrochen sind. Die Japaner haben die praktisch wehrlose Stadt Schanghai überfallen. Berichten zufolge haben sie das Hafenviertel um die berühmte Bund, die Uferstraße, bombardiert. Sie sollen ein britisches Kanonenboot versenkt und das amerikanische Kanonenboot Wake gekapert haben, das als Funkstation für das amerikanische Konsulat fungierte. Sie haben ferner das International Settlement besetzt. Das bedeutet, dass etwa dreitausend Amerikaner festsitzen.«
»Aus Washington kündigt das Rekrutierungsbüro der US-Marine an, dass alle Rekrutierungsstellen morgen früh ab acht Uhr geöffnet sein werden.«
Draußen auf der Straße gingen sie trotz des kalten Nieselregens langsam. Ohne zu überlegen, ohne die Entscheidung zu bedenken, gab sie ihm ihre Hand, und er steckte sie in seine Manteltasche, um sie ohne Handschuhe halten zu können. »Ich frage mich, ob ich zur Marine gehen soll«, sagte Murray. »Meine Mutter ist dagegen, aber ich kann mir kaum denken, dass irgendeine Mutter dafür ist. Ich war noch nie in meinem Leben auf einem Schiff. Du?«
»Nur auf dem Dampfer nach Bob Lo. Ich bin am Ende des achten Schuljahres mal mit der Klasse hingefahren, und die Gewerkschaft von meinem Vater hat da mal ein Picknick veranstaltet.«
»Hast du Angst?« Er hielt ihre Hand fester.
»Ja. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Ein Teil meiner Familie ist jetzt seit zwei Jahren im Krieg –«
»Verwandte in Polen?«
»Einige in Polen und welche in Frankreich.«
Murray grinste. »Ich habe noch nie französische Juden kennengelernt.«
»Zwei von den Schwestern meiner Mutter sind nach Paris gezogen. Meine Mutter stammt ursprünglich aus Polen und hat meine Oma rübergeholt.«
»Meine Eltern reden nie über ihre Familie in Europa. Sie wollen so sehr wie richtige Amerikaner sein, sie mögen nicht mal meine Fragen beantworten.«
»Sie reden nie Jiddisch?«
»Nie. Ich wusste gar nicht, dass sie es überhaupt können, bis ich einmal gehört habe, wie meine Mutter es in einem Laden benutzte, als sie um eine Manteländerung feilschte.«
»Ich finde es wichtig, ein Gefühl dafür zu haben, wo man herkommt.« Sie wollte noch nichts von Naomi sagen, die all die Verwandten, denen sie nie begegnet war, für sie real und lebendig machte. Naomi hatte nicht mit Murray gesprochen, und bei dem Gewusel und Chaos zu Hause war sie ihm wahrscheinlich entgangen, das kleine Mädchen mit dem krausen Haar, den hellbraunen Augen und dem herzförmigen Gesicht, das ihn wie eine eifersüchtige Katze wütend anstarrte.
»Ich weiß nicht.« Murray runzelte die Stirn. »Ich sehe manchmal die chassidischen Burschen mit den Schläfenlocken und den komischen Kleidern, und ich kann mich mit ihnen nicht mehr identifizieren als mit Eskimos oder Südseeinsulanern. Ich habe das Gefühl, sie sind aus dem Mittelalter. Ich lebe im Detroit des Jahres 1941, und sie leben immer noch im Minsk des Jahres 1841. Sie sind mir peinlich.«
»Aber es gibt eine Verbindung. Ich bin ebenso jüdisch wie sie, aber auf meine Art. Das habe ich von meiner Großmutter und meiner Mutter gelernt, und das möchte ich weitergeben.«
»Denkst du oft daran zu heiraten?«
Ruthie lachte auf. »Ach, Murray, unter all denen, die während der Depression aufgewachsen sind wie wir, kennst du da irgendwen, der ganz jung heiraten und eine Familie gründen will? Jedenfalls nicht die von uns, die ein kleines bisschen mehr wollen, als unsere Eltern haben. Ich sehe bei meinem Bruder Arty und seiner Frau Sharon, wie es sie am Boden hält, schon zwei Kinder zu haben. Mir macht es nichts aus, wenn Arty sagt, ich werde als alte Jungfer enden. Ich will nicht heiraten und ich will keine Kinder haben, bevor ich fünfundzwanzig oder vielleicht sogar dreißig bin!«
»Das ist gut, ich meine, das ist weitblickend von dir. Du schaffst bestimmt deinen Abschluss. Ruthie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Auf der einen Seite möchte ich unbedingt auf der Uni bleiben, denn ich denke, das ist meine einzige Chance, weiterzukommen und einen richtigen Beruf zu lernen. Bei den Sachen, die mir jetzt offenstehen, sitze ich auf der Straße, sobald eine Wirtschaftskrise kommt. Ich möchte eine Arbeit tun, die ich schätze. Aber ich habe auch das Gefühl, ich sollte mich freiwillig zum Militär melden. Dies ist mein Land, und auf unsere Jungs wird bereits geschossen. Außerdem bin ich wahrscheinlich besser dran, wenn ich mich freiwillig melde, als wenn ich warte, bis sie mich einziehen. Was denkst du?«
»Ich denke, das darf ich dir nicht sagen, aber ich werde deine Entscheidung respektieren. Warum wartest du nicht bis Ende der Woche? Alle Brauseköpfe werden hinstürzen, sobald sie aus den Betten kommen. Warum nicht abwarten, was Präsident Roosevelt macht? Ich hörte einen Kommentator sagen, dass es vielleicht nur eine Seeblockade gibt.«
»Ich werde abwarten, bis ich sehe, was wirklich los ist. Ich kann mich immer noch nächste Woche melden. Ich werde durchhalten und weiterackern.« Er blieb mitten auf dem Bürgersteig stehen und beugte sich über sie. Bevor sie Zeit hatte, eine Entscheidung zu formulieren, küsste er sie, dann ließ er sie los. Sie gingen weiter. »Möchtest du ein Soda oder lieber Kaffee? Ein Stück Kuchen oder ein Eis?«
»Trotz der Kälte möchte ich ein Eiscremesoda.« Sie machte sich nicht die Mühe, ihm zu erklären, dass sie Kaffee immer auf dem Herd stehen hatten, aber dass ein Eiscremesoda etwas war, was sie zuletzt im August geschleckt hatte.
Sie fühlte sich betrogen, dass er sie so rasch geküsst hatte, so ruhig, so sachlich, dass sie keine Zeit gehabt hatte, sich darauf vorzubereiten, die Entscheidung zu drehen und zu wenden. Er war jetzt ein Mann, den sie geküsst hatte, einer auf der Liste von vieren, die bis vor fünf Minuten die Liste von dreien gewesen war. Es war zu schnell vorüber gewesen. Aus jahrelanger Beobachtung von Kinoküssen erwartete sie starke Gefühlsregungen von einem Kuss des Mannes, der ihr gefiel. Jetzt zog er womöglich plötzlich in den Krieg, und sie hatte keine Befriedigung und keine wesentlichen Erinnerungen von einem bekommen, der ein Viertel ihrer Erfahrungen mit Männern darstellte. Sie konnte nur hoffen, dass er es nach ihren Sodas auf dem Heimweg noch einmal tun würde, aber bitte nicht auf der Veranda unter der Lampe, wo die ganze Familie durchs Fenster spionierte.
Am Yenching-Institut bewirkte Pearl Harbour kaum eine Unterbrechung des Studiums. Daniel wurde auf dem schnellsten Wege zum Marinehafen in Charlestown gebracht, zusammen mit den übrigen Programmteilnehmern, die bis dahin Zivilisten gewesen waren. Nun wurden sie in aller Eile eingezogen. Offensichtlich hatten die Ärzte in ihrem Fall besondere Anweisungen bekommen, denn niemand wurde zurückgestellt, ganz gleich, wie alt und in welcher körperlichen Verfassung er war. Dann wurden sie in Bussen zu ihren Kursen zurückgefahren. Sie verloren nicht mal einen ganzen Tag, um in die Marine einzutreten.
Er hatte genug Geschichten über die Gräueltaten der Nazis in Europa und der Japaner in China gehört, um sich der Notwendigkeit des Krieges konkret bewusst zu sein. Trotzdem fühlte er sich merkwürdig, als für seine Uniform Maß genommen wurde. Er war nun ein Matrose, der seine einzigen Schiffskenntnisse als Passagier auf der Fahrt über den Pazifik gewonnen hatte. Plötzlich war er Fähnrich zur See Balaban. Er kam sich in seiner neuen Uniform wie ein Betrüger vor.
Ihn erstaunte, dass die Marine sich hatte überraschen lassen, wo sich die Situation im Pazifik doch ganz offensichtlich auf einen Krieg hin zugespitzt hatte. Manchmal vertrat er die Ansicht, die Entwicklung zum Krieg hätte begonnen, als amerikanische Kriegsschiffe unter Admiral Perry Japan 1854 zur Öffnung zwangen; doch näher lag, dass es das Ölembargo war, das den Krieg unvermeidlich machte. Die Marine musste den Einsatz der japanischen Armee in China beobachtet haben, dennoch gestand sie ihr nicht zu, eine schlagkräftige, moderne Kriegsmaschine zu sein. Die Amerikaner hatten einfach nicht geglaubt, dass die Japaner sie angreifen würden, denn schließlich waren sie Weiße und die Japaner nicht, und außerdem hielten sie sich selbst für einen Meter achtzig groß, die Japaner dagegen für klein, und kleine Männer lassen sich für gewöhnlich nicht auf den Nahkampf mit großen Männern ein. Er hatte schon festgestellt, dass in der Verteidigungsmythologie, die die Denkweise der Militärs prägte, solch primitives Denken zuweilen an die erste Stelle trat.
Er war in Sorge um Onkel Nat Balaban in Schanghai, besonders angesichts der Nachricht, dass die Japaner die Stadt bombardierten und ins International Settlement einmarschierten; aber Onkel Nat wohnte in Hongkew, das seit Jahren als Klein-Tokio bekannt war. Er hatte immer allen Gelder gezahlt, die Gelder verlangten, allen Seiten, allen Gruppierungen, und sich vor jedermann verneigt. Daniel hielt die Überlebenschancen seines Onkels für recht gut. Seine eigenen gaben ihm mehr Rätsel auf. Er musste doch eine Art Seeschulung erhalten, aber irgendwie schien das nicht vorgesehen. Und wenn man ihn dann eines Tages mit sehr guten Japanischkenntnissen, aber unfähig, den Bug vom Heck zu unterscheiden, auf ein Schiff abkommandierte, würde er wieder einmal die Zielscheibe aller Witze, der Außenseiter sein.
Das jetzt war ein ganz anderer Krieg, dachte Naomi, der in die falsche Richtung zeigte. Ihr war danach, das Radio zu verprügeln und nach allen Erwachsenen der Welt zu treten, die fest entschlossen schienen, mit ihren Kriegen alles kaputtzumachen. Sie hatte gedacht, wenn der Krieg hierherkam, dann der gleiche, in dem ihre Eltern gefangen waren, aber jetzt schien ein ganz anderer anzufangen, mit den Japanern jenseits des komischen anderen Ozeans, der so viel von dem Blau auf dem Globus aufbrauchte.
Sie verließ das Wohnzimmer, wo das Radio dröhnte, um sich auf Ruthies Etagenbett zu legen, das nach Fliederparfüm duftete. Sie drückte ihre Wange in Boston Blackies warme Flanke. Irgendwo lauschten Maman und Rivka ihrem kleinen Radio und hörten von diesem Überfall und sorgten sich um sie. Irgendwo in Südfrankreich lauschte auch Papa.
Sie umklammerte Boston Blackie und grübelte, ob es hier losgehen würde wie in Paris, als die Deutschen kamen. Es hatte nicht lange gedauert, da kannte der Kaufmann Maman nicht mehr, wenn sie in die épicerie ging, und bediente sie zuallerletzt. Auf der Treppe wandten die Nachbarn den Blick ab, wenn Naomi hinaufrannte, bevor das Treppenlicht ausging; auf der Straße spuckten Menschen vor ihr aus; ihre Freundin Agathe spielte nach der Schule nicht mehr mit ihr, denn ihr Vater hatte es verboten. Jeden Moment konnte sich die Welt dir gegenüber ändern, und die, die du immer deine Freundinnen genannt hattest, wandten sich ab und ließen dich allein auf dem Schulhof stehen. Dann gingst du näher zu den anderen Juden, sogar zu der langen, staksigen Yvette, und du und Rivka, ihr hieltet euch bei den Händen und standet zusammen mit den anderen jüdischen Kindern und wartetet, was die anderen sich als Nächstes gegen euch ausdachten.
Sie hörte Schritte, und Ruthies Arm legte sich sanft um ihre Schultern. »Naomi, was fehlt dir? Hast du Angst?«
Sie nickte.
Da riss Ruthie sie in ihre Arme. »Ich habe auch Angst, Naomi. Schreckliche Angst.«
Naomi erwiderte die Umarmung, und plötzlich durchflutete sie heftige Liebe zu ihrer Tante, die eigentlich gar nicht ihre Tante war, sondern ihre Kusine. Etwas in ihr riss sich los, und für einen Augenblick hatte sie ein schlechtes Gewissen gegenüber Maman und Papa und Rivka und Jacqueline, dass sie anfing, jemand anders zu lieben. Ob sie sie je wiedersah? Jemals? Sie hatte Maman und Rivka seit Mai nicht gesehen und Papa seit Juni.
Alle diese Kriege zerschnitten die Welt in blutende Stücke, und niemand konnte hinüber. Aber Ruthie, die wollte sie lieben. Nach dem Krieg, wenn es je ein Danach gab, dann nahm sie vielleicht Ruthie mit zurück, und dann lebte Ruthie auch bei ihnen. »Comme elle est belle, avec ses yeux très verts, et sympathique aussi. Tu as de la chance, petite.« Mamans volltönende Stimme mit dem singenden Tonfall sprach in ihr Ohr, die Stimme, in der immer ein Lachen lag, wie Adern aus dunklen Wirbeln in hellem Marmor. Sie drückte Ruthie noch enger an sich. Sie hielt sich fest.