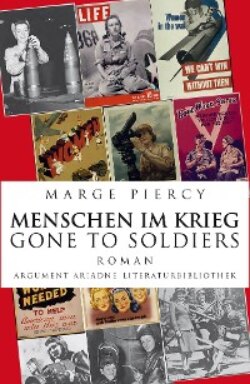Читать книгу Menschen im Krieg – Gone to Soldiers - Marge Piercy - Страница 19
Duvey 1 Viele Stürme kennt das Meer
ОглавлениеDuvey verbrachte die ersten drei Monate 1942 auf der karibischen Tour und war deshalb heilfroh, jetzt die nordatlantische Geleitzug-Route zu schippern. Er war auf Tankern gefahren, jetzt zum Glück nicht mehr. Er hatte fünf Freunde verloren, von denen er wusste, und wahrscheinlich noch mehr, von denen er keine Ahnung hatte. Alle hopsgegangen auf Tankern, vor der Küste torpediert, nah genug, dass man’s vom amerikanischen Festland riechen und den Feuerschein sehen konnte. Cape Hatteras war am schlimmsten, aber die gesamte Küste war tödlich.
Eine Frau in einer Bar erzählte ihm von ihrer Mutter in Vero Beach, wo die Dodgers ihr Winterlager hatten und wo jeden Morgen am Strand Arme, Ohren und Rümpfe ohne Kopf zusammen mit verbogenem Metall angespült wurden. Meistens ging die Tankerbesatzung in einer großen Stichflamme drauf, und vielleicht war das gut so, denn die armen Kerle, die von Bord sprangen – er hatte geholfen, welche davon aus dem Wasser zu fischen. Ihm war lieber, sofort hochzugehen, statt ins flammende Meer zu springen und mit Verbrennungen am ganzen Körper »gerettet« zu werden und langsam im Krankenhaus zu verrecken oder als Schreckgespenst durch Detroit zu humpeln.
Die U-Boote führten Krieg, wie sie Lust hatten, lauerten vor der Küste und spielten vor den Lichtern von Miami, Charleston, Savannah und New York Schießbude mit den Tankern. Die Städte waren nicht mal verdunkelt. Das Leben von Seeleuten war billig. Die Helden waren in der Armee und in der Marine, aber krepieren taten die Seeleute, und wenn irgendwer an Land meinte, der Krieg konnte ohne die Nahrungsmittel, das Öl und den Nachschub von ihren Frachtern gewonnen werden, dann war der so bescheuert, wie er es den meisten schon immer unterstellt hatte. Wenn England durchhalten sollte und wenn die Vereinigten Staaten sich wirksam in den Krieg einschalten sollten, dann mussten die Frachtschiffe ihre Ladung ausliefern.
Er hatte sich entschieden. Er dachte nicht daran, sich vom Militär in die Zwangsjacke stecken zu lassen und jedes Arschloch zu grüßen, das zufällig Annapolis absolviert hatte. Er war immer Malocher gewesen, und er blieb einer. Das war die richtige Kriegsarbeit, wie er sie verstand, und er war es gewohnt, Städte von ihren Hafenvierteln und ihren Nachtseiten zu sehen. Sie hatten sich für ihre Gewerkschaft den Arsch aufgerissen, und jetzt zogen sie zu Gewerkschaftstarifen in den Krieg. Die Nationale Seemännische, eine CIO-Gewerkschaft wie die von Tate, hatte sie von vierzig Dollar im Monat und von Quartieren, die nur für Schweine taugten, auf hundert Dollar im Monat gebracht, und jetzt bekamen sie noch mal hundert Gefahrenzulage. Ein paar Amtsschimmel wollten ihnen die Heuer kürzen, aber erst sollten mal die Schiffseigner ihre riesigen Profite ausspucken, dann ließ sich über Lohnkürzungen reden: Das sagte die Gewerkschaft, und das sagte er.
Wenn er daran dachte, schrieb er rasch einen Brief nach Hause, denn er wollte nicht, dass Mame sich Sorgen machte. Er passte auf, was er schrieb, füllte seine Briefe mit Fragen und Lügengeschichten. Sie dachte, weil er nicht bei der Marine war und nicht kämpfen musste, war er sicher. Besser, sie blieb dabei. Er hatte nicht vor, ihr ein Licht aufzustecken. Er hatte ihr immer Ärger ins Haus gebracht, obwohl er das gar nicht wollte. Als Ältester wusste er, wie schwer das Leben für sie gewesen war.
Er war auf seine Art ein Härtefall, aufgewachsen im tiefsten Keller der Depression, hatte fast alles entbehren müssen, was Spaß machte. Arty sah nicht über seinen Tellerrand raus. Ruthie, die konnte vielleicht was aus sich machen. Die hatte zwar so was Artiges, Redliches an sich, was er zum Kotzen fand, aber sie war ganz in Ordnung und half Mame. Vielleicht kam sie ja sogar irgendwann durchs College, die erste Studierte in der Familie, wenn sie nicht so blöde war zu heiraten. Die Ehe machte kaputt. Frauen fingen an, Kinder zu kriegen, und bald sahen sie aus wie ihre Mütter und konnten nur noch nachplappern, was ihre Mütter mal gesagt hatten. Männer kriegten so was Ausgelaugtes, Gebeugtes, und die Bäuche quollen ihnen über den Hosenbund.
Das war nichts für ihn. Daran hatte er nie auch nur im Traum gedacht. Ihm gefielen Frauen, die er zu Hause nicht vorzeigen konnte. Die einzigen Mädels, die in seinen Augen die Mühe wert waren, das waren die, die es gewohnt waren, sich selber durchzubringen, eine Kellnerin oder eine Barfrau oder eine Maniküre oder eine Nutte, die keinem Zuhälter gehörte, eine, die auf sich aufpasste, damit man sich bei ihr nicht was holte. Das süßeste Mädel, das er je gehabt hatte, war eine Farbige, Delora mit Kupferhaut und langen tollen, tollen Beinen und einem Hintern, den sie nur über die Straße tragen musste, damit die Männer auf die Knie fielen. Aber ein farbiges Mädel zu haben brachte Zoff. Sie konnten fast nirgendwohin was essen oder trinken gehen, ohne dass er mit weißen Wichsern aneinandergeriet oder mit Farbigen, denen es stank, dass er sich mit ihren Frauen einließ, als ob jede Frau der gleichen Hautfarbe ihnen als Gruppe gehörte. Duvey hatte nichts gegen eine Keilerei, aber doch nicht jedes Mal, wenn sie aus dem Haus gingen.
Er war mit Farbigen in der Nachbarschaft aufgewachsen, und er verstand nie, warum die Weißen sich so anstellten. Ein russischer Jude und ein Schwede zum Beispiel, oder ein Schotte und ein Sizilianer, die waren genauso verschieden. Aber jedes Mal, wenn man mit einem reden wollte, der auf dem Gebiet eine Macke hatte, dann fing der an: Wäre es dir vielleicht recht, wenn ein Farbiger deine Schwester heiratet? Als ob alle Schwarzen nichts anderes im Sinn hatten, als jemandes schielende, lahmende Schwester zu heiraten. Klar waren sie neugierig, mit einer Weißen ins Bett zu steigen, genau wie er beim ersten Mal neugierig auf eine Farbige gewesen war, aber danach war es ein bestimmtes Lächeln oder ein Gang oder ein schlagfertiger Spruch, auf den er anbiss.
Detroit hatte viele farbige Einwohner, und es wurden immer noch mehr, weil die Farbigen aus ihrem Sackgassendasein im Süden hochkamen und Arbeit in den Fabriken suchten. Wie bei den Juden waren die Gescheitesten wahrscheinlich die, die es im schwarzen Gegenstück zum Schtetl nicht mehr aushielten und sich was suchten, wo sie vorankamen und anständig verdienten. Die Farbigen in Detroit, das waren oft gescheite, aufgeweckte, fixe Leute, mit dem Bauch voll Wut über die Scheiße, die sie fressen mussten.
Auf der Montauk waren sechs Schwarze, alle unten im Maschinenraum. Sie blieben meistens unter sich, und wenn er ihnen auch guten Tag sagte, falls sie ihm über den Weg liefen, hatte er doch nicht viel mit ihnen zu tun. Außer ihm war noch ein Jude an Bord, der Funker, aber der war Offizier. Wenn der gefragt wurde, ob er Jude war, gab er es zu, aber freiwillig sagte er das nie, nur, wenn er wusste, dass er mit einem Juden redete. Sobald du sagtest, du warst Jude, wollten sie dir ans Leder. Die hielten alle Juden für Matschbacken und Schlappschwänze, und du musstest ein doppelter Kerl sein.
Wenn ihn welche ausfragten, sagte er: »Ich bin aus Detroit, Jack, wo die Autos rassig sind und die Weiber noch rassiger. Wir werden auf Rädern geboren, und wir verlöten den Schnaps wie Benzin.« Dann hatten sie was zum Reinbeißen.
Duveys Spitzname war der steile Dave, wegen seines Erfolgs bei den Weibern im Hafen. Noch auf der Highschool hatte Duvey sich ausklamüsert, Frauen lohnten sich für ihn nur, wenn sie es genauso wollten wie er, und so brauchte man sich nur darüber zu einigen, ob man sich genug mochte und wann und wo, und das Ganze war keine Sache von Gebettel und Gerangel und Versprechungen, für die man sowieso nicht das nötige Kleingeld hatte, Pflaumenpfingsten.
Am 24. April formierte sich der Geleitzug. Sein Schiff war voll mit Weizen, in Montreal gebunkert. Sie waren den St. Lorenz-Strom runtergefahren, hatten dann vor Halifax gewartet, wo der Geleitzug zusammengestellt wurde. Konvoi HX-152 war beeindruckend, als er in der Fahrrinne vorandampfte: vierunddreißig Schiffe unter Geleit von einem alten Zerstörer und drei Korvetten, von denen die Matrosen sagten, sie würden selbst auf nassem Gras dahingleiten wie geschmiert. Der Geleitzug war ein großartiger Anblick, eine Schiffsparade hinaus auf den Atlantik bei leichtem Seegang und sanfter Sonne. US-PBY Catalina-Patrouillenflugzeuge hatten von oben ein Auge drauf. Da waren ein früheres Passagierschiff mit kanadischen Truppen, ein Tanker, ein Haufen alte Trampdampfer unterschiedlichster Registrierung und Nationalität und Seetüchtigkeit, ein schmucker norwegischer Frachter mit eigenen Bordkanonen und Frachterungetüme mit ragenden Ladebäumen.
Die Montauk selber war das neueste Schiff, auf dem er je gefahren war, ein Liberty-Schiff, das erst zweimal draußen gewesen war. Alle Liberty-Schiffe waren langsam, aber ganz in Ordnung, zuverlässig, außer sie wurden mittschiffs getroffen, dann brachen sie auf wie ein Laib Schnittbrot. Die Mannschaftsquartiere waren in den Decksaufbauten, vier Kojen pro Kajüte, für insgesamt vierundvierzig Mann mit den Offizieren. Die Libertys fuhren mit Dampfmaschinen, und die Maschinen waren gut. Es gab sogar gekachelte Duschen für die Mannschaften. Er war auf Schiffen gefahren, wo ein Eimer alles war, was man an Sauberkeit bekam.
Nebel wickelte sie am zweiten Tag ein, bis sie ihre Nachbarn um sich herum nicht mehr sehen konnten. Das Fahren in Geleitzügen fing in der Karibik und auf den Küstenrouten erst an, so dass es für Duvey neu war. Auf den Großen Seen sah man ein anderes Schiff im Detroit River oder in den Schleusen, aber draußen auf den Seen kam man nicht mal in Rufweite. Es war ihm unbehaglich, bei dichtem Nebel in solch einer Herde schwerfälliger Frachter zu dampfen, wo jedes Schiff näher an den anderen war, als er sicher fand. Sie hatten keinen Geleitschutz durch Flugzeuge, die nach U-Booten Ausschau hielten, aber der Tag verging ohne Angriff. Der Nebel schloss sich dick und klamm und dumpfig um sie, die Luft war wie gasförmiges Eis. Zwei der Schiffe entgingen nur knapp einem Zusammenstoß. Eine der Korvetten musste zurückhängen, um Nachzügler einzutreiben.
Ohne Sicherung aus der Luft setzten sie ihren Weg die nächsten vier Tage lang fort, bis Duvey mitten in der Nacht vom 29. auf den 30. April eine Detonation hörte. Sogar durch den Nebel konnte er die Feuersäule sehen, was hieß, dass ein Tanker getroffen war, wahrscheinlich die Fitzpatrick. Er hörte Geschützfeuer. Der Zerstörer belegte das U-Boot mit Wasserbomben, so klang es. Dichter Rauch trieb mit Nebel vermischt über das Wasser. Von dem Petroleumgestank wurde ihm leicht übel. Er hörte eine weitere schwere Detonation. Sein Körper stemmte sich gegen die Wucht der Druckwelle. Jede Minute konnte die Montauk die Nächste sein. Automatisch fasste er nach der zugeknöpften Tasche mit seinen Papieren und seinem Geld in einem zugeknoteten Präser. Wenn er die Torpedos überlebte, dann hatte er sie dabei; wenn nicht und wenn die Leiche an Land gespült wurde, dann konnte er identifiziert werden.
Der Zerstörer meldete ausströmendes Öl von einem getroffenen U-Boot, aber eine halbe Stunde später wurde die Belle Star torpediert. Wrackgeschossen trieb sie ruderlos. Die Montauk musste ihr ausweichen.
Ohne Mond, ohne Sterne, ohne Lichter von einem der Schiffe stampften sie in eine Finsternis aus Rauch von brennenden Schiffen und der verdammten Nebelsuppe. Alle Schiffe schwatzten miteinander, denn hätten sie Funkstille bewahrt, hätten sie einander unweigerlich gerammt. Das hieß, die U-Boote, die in einem der berüchtigten Wolfsrudel operierten, konnten sich auf die Signale einpeilen und ein Schiff nach dem anderen aufs Korn nehmen. Die Korvetten setzten in gischtender Fahrt den U-Booten nach wie Hunde auf Hasenjagd.
Nach kurzer Zeit kreuzte die Montauk durch Wrackteile, Trümmer von dem, was am Tag noch ein Schiff voll lebendiger Seeleute gewesen war. Steuerbord sahen sie verschwommen Feuerschein auf dem Wasser, das Meer selbst stand in Flammen. Männer schrien. Dann sahen sie kleine rote Lichter von Seeleuten im Wasser, die tanzenden Lämpchen an ihren Schwimmwesten. Während eines Angriffs durften sie keine Überlebenden aufnehmen, aber der Kapitän entschied, da sie nicht unter direktem Beschuss standen, holten sie, wen sie konnten.
Die ersten Männer, die sie auffischten, waren im Öl ertrunken, das Öl hatte ihnen die Lungen verklebt, als sie ins Wasser gesprungen waren. Aber dann erwischten sie drei, die noch am Leben waren, grässlich vom Öl verschmiert und geblendet. Einer war auf der einen Seite völlig verbrannt und roch wie ein Rostbraten, aber er lebte. Duvey half freiwillig, den armen Teufeln das Öl abzuschaben.
Auf Anweisung scherte der Kapitän nach backbord und nahm dann wieder Kurs voraus. Sie hörten Salven gedämpfter Unterwasserexplosionen. Wasserbomben. »Das ist der Wabowerfer, mein Junge«, sagte Bootsmann Hogan zu ihm. »Den feuern sie in Salven nach vorn ab. Das ist ihr neues Spielzeug und funktioniert ein ganzes Stück besser als die verdammten Batterien, die sie nach achtern abfeuern mussten.«
Dann sahen sie im düsteren Schein eines brennenden Schiffes ein U-Boot in einer schäumenden Öllache auftauchen. Eine der angreifenden Korvetten rammte es. Das Heck ragte steil aus dem Wasser wie ein kopfstehender Hai, dann verschwand es, und der Ölteppich schloss sich darüber.
Duvey war froh, dass er nicht in U-Booten Dienst tat, ganz egal, wie gefährlich die Handelsmarine war. Ihm war lieber, er starb auf Deck in einem Feuerstoß oder ertrank, als dass er in einer Konservendose wie eine Wanze zerquetscht wurde. Er spürte immer einen Stich Mitleid für die schwarze Truppe unten im Maschinenraum. Wenn das Schiff getroffen wurde, hatten die keine Chance. Die wurden auf der Stelle zerkocht. Oben auf Deck konnte er vielleicht noch springen, und wenn er ein Rettungsboot erwischte, umso besser. Sogar die armen gerösteten Teufel, die sie gerade aus dem Wasser geholt hatten, konnten’s noch schaffen, wenn ihre Verbrennungen nicht zu großflächig waren und wenn sie nicht zu viel Öl geschluckt oder eingeatmet hatten.
Er merkte, seit ungefähr einer Viertelstunde hatte er keine Detonation mehr gehört. Das wollte noch gar nichts heißen, nur, dass die Korvetten und der Zerstörer die U-Boote aus dem Visier verloren hatten und dass die Deutschen abliefen, um auf eine bessere Gelegenheit und bessere Sicht zu warten.
Er hatte gehasst in seinem Leben: meistens Kerle, die ihn fertiggemacht hatten, einen riesigen Polacken, der ihm das Leben auf seinem ersten Schiff zur Hölle gemacht hatte, einen Maat, der versucht hatte, ihn kleinzukriegen, Father Coughlin, der in Detroit aus allen Radios in den katholischen Nachbarhäusern seinen verbalen Dünnschiss gegen die Juden ergoss. Aber nie hatte er jemanden oder etwas mit der scharfen, stählernen Kraft gehasst, mit der er diese arroganten Nazi-Haie hasste, die U-Boote. Sie hatten den Seekrieg damit eröffnet, dass sie ein unbewaffnetes Passagierschiff, die Athenia, versenkten und dann behaupteten, die Engländer selber hätten es zu Propagandazwecken hochgehen lassen. Sie machten sich über unbewaffnete Handelsschiffe her, eine schöne Jagd und eine glückliche Zeit, leichte Beute für die Kommandanten ohne wen, der zurückschoss.
Am nächsten Tag waren sie in der Grönland-Luftlücke, dieser sechshundert Meilen langen Seestrecke, wo die auf Neufundland stationierten Flugzeuge sie nicht mehr erreichen konnten und sie noch nicht unter dem Schutzschild der auf Island stationierten Verbände waren. Außerdem, was nutzte ihnen die Luftsicherung, wenn der Nebel die Flugzeuge Tag für Tag am Boden festhielt?
Aber sie hatten zum ersten Mal Glück. Am Morgen kam schwere Dünung auf, Brecher krachten über die Decks. Der Wind stürmte aus Nord und brachte Schnee. Die Sicht wurde sogar etwas besser, und sie konnten steuerbord die San Martin ausmachen und backbord die Lone Star. Dann wurde der Seegang zu hoch, um irgendwas anderes zu sehen als die nächste Sturzsee. Die Dünung war auf dem Atlantik länger, als er es von den Großen Seen her gewohnt war, und die Wellen waren noch höher, aber schlussendlich trafen sie auch nicht härter. Das Wasser war genauso saukalt und genauso pissnass. Stürme brachen auf dem Michigan und dem Superior Erzkähne in zwei Hälften.
Sie bahnten sich ihren Weg durch eine Eisbergflottille, aber vor den U-Booten waren sie sicher, denn die konnten bei dem Wetter nicht zum Angriff auftauchen. So fuhren sie ihnen davon. Der Konvoi machte nicht viel Fahrt, aber die U-Boote schafften getaucht nur acht Knoten und wurden abgehängt. Vielleicht funkten sie ein anderes Wolfsrudel voraus an, sich auf die Lauer zu legen, aber bei schwerem Wetter war kein Angriff möglich. Obwohl sie von den Brechern tüchtige Prügel bezogen, war es Duvey lieber, in Stücke zerrüttelt zu werden, als unter Beschuss zu geraten, also her mit den Stürmen.
Das Packeis, durch das sie fuhren, war völlig anders, als er sich vorgestellt hatte. Zerklüftet, wild, ein Grand Canyon unheimlicher Eisgestalten, nicht weiß, eher blau und violett und grau und rostbraun. Er hatte auf den Großen Seen viel Eis gesehen, aber das hier sah viel merkwürdiger aus, ragende Klippen, schwimmende Eisschlösser, Albtraumwälder und Märchenstädte aus Eis. Als es schließlich aufklarte, hatten sie ein Schiff verloren, die Eleftheria, die mit Motorschaden hinterherzockelte. In Island war Zwischenstation, da holte sie den Konvoi bestimmt ein.
Vor der Weiterfahrt nach Southampton tankten sie in Island auf, und da hörten sie auch, dass die Eleftheria torpediert und mit allen Mann an Bord gesunken war. Duvey hatte eine gute Zeit, denn er zog sich eine sowjetische Freundin an Land, die das Überleben der Murmansk-Tour feierte. Die Russen hatten Frauen auf ihren Schiffen und wurden von allen darum beneidet. Es gab viele Besuche von Schiff zu Schiff, lange Nächte, Glücksspiel und Geschacher. Von Tommys auf einem Konvoi nach Westen tauschten sie Dosenfleisch und -obst gegen Rum, und so dampfte die Montauk in bester Stimmung nach England.