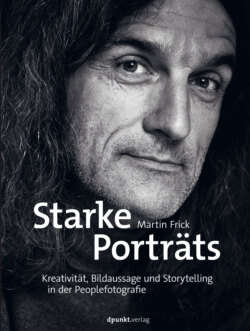Читать книгу Starke Porträts - Martin Frick - Страница 11
ОглавлениеDie drei wichtigsten Fragen in der Porträtfotografie – und wie wir sie beantworten
Menschen zu fotografieren und zu porträtieren, also ihre Wesensmerkmale zum Vorschein zu bringen, ist eine faszinierende Aufgabe. Der Reiz liegt darin, nicht nur über das Gegenüber etwas zu lernen, sondern auch über sich selbst. Denn betrachten wir es philosophisch, erzählt ein Porträt nicht nur etwas über die dargestellte Person und darüber, wie sie sich selbst sehen möchte, sondern genauso über den Fotografen und darüber, wie er die Person sieht. Und ein Porträt erzählt auch etwas über die Qualität der Beziehung, die Protagonist und Fotograf in diesem Moment haben.
Für mein Projekt »next consideration of the world« (https://next.consideration.world) habe ich Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund getroffen, sie interviewt und schließlich porträtiert. Dadurch konnte ich viele unterschiedliche Sichtweisen kennenlernen – beinahe so, als wäre ich selbst in die Länder gereist. Und gleichzeitig haben mir die Begegnungen eine Sichtweise auf meine eigene Heimat erschlossen, die ich sonst nicht bekommen hätte. Die Fotografie ist für mich ein Vehikel geworden, um soziale Zusammenhänge zu erforschen und die Welt zu erkunden. Fotografie ist ein Medium. Sie schränkt uns ein, eröffnet uns Möglichkeiten, kann zur Waffe für eine Sache werden oder zum Werkzeug, um uns selbst (als Fotograf und Künstler) darzustellen. Fotografieren und porträtieren wir andere Menschen, können wir Schönheit zeigen oder Verletzlichkeit, Macht oder Ohnmacht, Würde, Irrsinn und Hoffnung, um nur einige zu nennen. Es kommt allein darauf an, wen wir als Gegenüber haben und was wir daraus machen.
Wenn sich Fotograf und Model zusammen auf eine Reise einlassen, sich gegenseitig inspirieren und eine gemeinsame Sprache entwickeln, entstehen individuelle und authentische Porträts.
Man kann sich fragen, ob das neue Kameramodell oder ein lichtstärkeres Objektiv nicht besser geeignet wären, um schöne Porträts zu machen. Vielleicht geht es aber gar nicht darum, »schöne« Fotos zu machen. Wir wollen in diesem Buch ein wenig über den Tellerrand von Tech-Reviews, Pixelpeeping und den »5 besten Tipps für schöne Porträts« schauen und den Horizont öffnen, hin zu möglichst aussagekräftigen, authentischen und emotionalen Porträts, die auch vor Intimität, schwierigen oder kontroversen Themen nicht zurückschrecken.
Abseits vom Touristentrubel Lissabons hat dieser Schreiner auf ca. 10 qm eine Existenz mit Miniatur-Schränkchen aufgebaut. Nachdem wir ein paar Momente geredet haben, dreht er wieder seine klassische Musik auf und wirft uns raus.
Die drei wichtigsten Fragen in diesem Zusammenhang sind für mich:
•Warum interessiere ich mich für diesen Menschen und seine Geschichte?
•Was interessiert mich an dem Menschen oder an der Situation? Was hat das mit mir selbst zu tun? In was davon könnte sich der Betrachter selbst wiedererkennen oder berührt werden?
•Wie bringe ich dies zum Ausdruck?
Wer sich jetzt an Simon Sineks Buch »Start with Why« erinnert fühlt, liegt nicht ganz falsch. Sinek beschreibt darin, warum es sinnvoll ist, Unternehmenskommunikation auf dem Existenzgrund des Unternehmens aufzubauen und sich dann argumentativ nach außen zu bewegen. Wende ich dieses Prinzip auf den kreativen Prozess in der Fotografie an, finde ich es einfacher, nach dem »Warum« zunächst das »Was« zu beantworten (was ist mein Motiv) und dann erst die Umsetzung (das Wie) anzugehen, während Sinek eine andere Reihenfolge wählt und ein anderes Ziel verfolgt. Aber betrachten wir eins nach dem anderen.
Warum interessiere ich mich für diesen Menschen und dieses Motiv?
Wenn wir im Auftrag eines Kunden Porträts anfertigen, stellt sich die Frage nach dem »Warum« vielleicht nicht – oder sie beantwortet sich von ganz alleine: Geht es um Mitarbeiterporträts, möchte das Unternehmen nach außen sympathisch und kompetent dastehen. Geht es um ein Kampagnen-Motiv, soll die abgebildete Person als Projektionsfläche für den emotionalisierten Nutzen des Produkts stehen (um es mal »unromantisch« auszudrücken). Damit wäre die Frage beantwortet und die Richtung klar. Aber wie sieht es aus, wenn ich an einem freien Fotoprojekt arbeite?
Viele von uns fühlen sich vielleicht dann frei und im Fluss, wenn sie ohne jeden Plan durch eine fremde Stadt schlendern und alles und jeden fotografieren können, je nachdem, was ihnen gerade interessant erscheint. Nur die wenigsten Fotografen werden sich selbst analysieren wollen und sich die Frage nach dem Warum stellen. Ja, es kann sogar ziemlich »abtörnend« sein, sich vor einer Reise oder vor einem Streetfotografie-Trip theoretischen Abhandlungen zu widmen. Warum also halte ich diese Frage trotzdem für so wichtig, dass ich sie ganz an den Anfang stelle?
Oft wissen wir selbst nicht genau, was wir wollen. Genau genommen ist uns sogar nur ein kleiner Anteil unseres Denkens, Fühlens und Handelns bewusst. Gerhard Roth, Biologe und Hirnforscher aus Marburg, schätzt, dass 99 Prozent unserer Gehirnaktivität unbewusst abläuft.1 Vieles von dem, was wir tun, läuft automatisch ab, und das ist auch gut so. Trotzdem – und gerade deshalb – lohnt es sich, in dieses intuitive Denken und Handeln einzutauchen und es zu hinterfragen. Wir schulen damit unseren Blick. Aber das ist nicht alles.
Bei Auftragsarbeiten wie Businessporträts scheint die Aufgabenstellung klar definiert zu sein. Aber auch hier gibt es Ziele und Erwartungen, die vielleicht nicht eindeutig benannt, aber erfüllt werden müssen.
Sind wir uns einmal selbst darüber klar geworden, was wir mit unseren Bildern sichtbar machen möchten, ergeben sich an jeder Ecke spontan neue Gelegenheiten. Mir gefiel der Stil dieser Marktfrau aus dem Maghreb und so kamen wir ins Gespräch und ich konnte ein Porträt mit ihr machen.
Wenn ich etwas unbewusst auf die eine oder andere Art mache, heißt das nicht, dass ich mir – ebenfalls unbewusst – die Frage nach dem Warum nicht schon gestellt und sie beantwortet habe. Vielleicht nicht gerade jetzt, aber irgendwann in meinem Leben habe ich eine Erfahrung gemacht und mir daraus meine Sicht auf die Welt zusammengebastelt.
Als ich in einem Dorf unweit von Marrakesch durch eine Gasse schlenderte, stand eine Frau in der Türe und drängte darauf, dass ich ins Haus kommen sollte. Zuerst war ich mir unsicher, ob sie überhaupt mich meinen konnte und ihren strengen Blick konnte ich auch nicht deuten. Ich habe mich nicht wohlgefühlt, weil ich nicht wusste, worauf ich mich einlassen würde. Und ich spreche nun mal kein Wort Arabisch. Da erschien schon ihr Sohn, der mir ein Lämmchen zeigte, und ich folgte ihnen einfach ins Haus. Es hätte sich als Fehler herausstellen können, aber ich wollte mehr darüber erfahren, wie diese Familie lebt. Und dann teilte sie ihr Frühstück mit mir.
Für uns Europäer sieht eine freundliche Einladung zum Frühstück vielleicht anders aus. Für mich hat die Gastfreundschaft dieser marokkanischen Bauernfamilie einen Einblick in die Seele des Landes eröffnet.
Auch wenn ich in diesem Moment ein flaues Gefühl hatte: Die Entscheidung war gefallen. Später habe ich auch verstanden, warum. Zwar wusste ich zunächst nicht, warum mir diese Leute interessant erschienen – aber ich habe wohl intuitiv gespürt, dass hinter dieser Türe die Sightseeing-Welt der Touristen aufhört und das ursprüngliche Marokko anfängt. Die Gastfreundschaft, die ich dort erleben durfte, hat mir die Augen geöffnet für eine Wirklichkeit, von der ich wusste, dass sie existiert, die ich aber in dieser Form selbst noch nicht erlebt hatte und von der ich mir insgeheim gewünscht hatte, sie näher erforschen zu können. Da habe ich verstanden, dass es das ist, was Fotografie für mich bedeutet: ein Vehikel zur Erforschung unterschiedlicher Wirklichkeiten.
Als Fotograf entwickle ich eine Vorstellung von dem, was ich zeigen und sichtbar machen möchte. Gleichzeitig ist es wichtig, zu verstehen, welche Beweggründe die Person vor meiner Linse hat, damit sich alle Beteiligten wohlfühlen. Aziz präsentiert hier stolz ein neugeborenes Lämmchen.
Es spricht also nichts dagegen, seiner Intuition nachzugeben, und es spricht nichts dagegen, sich über seine Beweggründe klar zu werden, auch wenn sie einem selbst bis dahin vielleicht nicht bewusst waren.
Zurück zu der Frage, in welchem Maße ich mir bewusst sein sollte, warum ich ein Foto oder ein Porträt von und mit einem Menschen machen möchte: Das Wissen hilft mir, mich auf mein Thema zu fokussieren, und ich komme leichter in Kontakt mit Menschen, wenn ich darüber Klarheit habe, was ich mir von ihnen erhoffe.
Während ich in New York studierte, gab uns unser Dozent eine relativ unkonkrete Aufgabe. Er nannte sie schlicht »Sidewalk« (Gehweg). Ich dachte mir dabei: Entweder ich sammle alles zu diesem Thema und mache mich vollkommen verrückt – oder ich gehe konzeptionell an die Sache heran, überlege mir einen Rahmen und konzentriere mich nur noch darauf.
Als ich am nächsten Morgen draußen auf der Straße war, lief ein junger Mann mit einer Sporttasche an mir vorbei, und ich fragte mich, was er wohl darin herumträgt, woher er kommt und wohin er damit will. Während meine Fantasie mit mir durchging (was, wenn da Bündel von Geldscheinen drin sind oder Waffen?), beschäftigte mich die Frage, was wir über Menschen denken, von denen wir nur einen Teil sehen. Daraus entstand die Idee, von jedem Passanten zwei Fotos zu machen – einmal von den Beinen und ein reines Porträt, um später zu erraten, welche Bildpaare zusammengehören. So wurde meine Interpretation der Aufgabe eine Art Memory über die Menschen in New York.
Anders formuliert: Habe ich erst einmal verstanden, was ich eigentlich zeigen möchte und warum ich es zeigen möchte, fällt es mir viel leichter, passende Motive zu finden, auf Menschen zuzugehen, mich auf Begegnungen einzulassen und meine Bildidee umzusetzen.