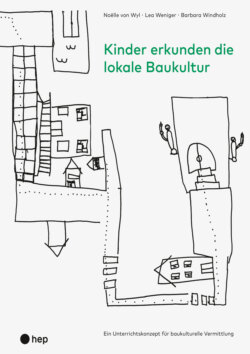Читать книгу Kinder erkunden die lokale Baukultur (E-Book) - Noëlle von Wyl - Страница 10
1.4 Baukulturelle Bildung – Intention und Lerngegenstand
ОглавлениеBaukultur betrifft den Menschen auf vielfältige Art und Weise, denn menschliches Handeln findet grundsätzlich in Innen- oder Aussenräumen statt. Diese werden meist nicht aufmerksam wahrgenommen, sondern eher beiläufig, unbewusst. So wird die gebaute Umgebung in einer Gleichzeitigkeit mit den sich darin aufhaltenden Menschen sowie den Raumqualitäten wie Wetter, Wärme, Geruch und Geräusche erlebt. Solche räumlichen Gesamteindrücke bezeichnet der Psychologe Rainer Schönhammer als «Milieu» oder allgemeinverständlicher als «Atmosphären» (Schönhammer, 2013, S. 293). Nicht nur Gebäude, sondern Personen, Pflanzen und alles, was die Umgebung formt, ist dabei miteinbezogen: «Man spürt sich und das Leben am Ort» (ebd., S. 296). Die vom Menschen geformte Umgebung erfüllt nicht nur funktionale Zwecke, sondern hinterlässt auch emotionale Eindrücke. «Wir geben ihr Form und sie formt uns» (UIA, 2008, zit. in Tschavgova & Feller, 2008, S. 2). Damit ist klar: Baukulturelle Bildung beinhaltet Funktion und Ästhetik. Ein Verständnis dafür, wie sich bestimmte Formen der gebauten Umwelt in ihrer Gestaltung über ihren Bezug zur Nachbarschaft, durch ihre Repräsentationsfunktion und Weiteres bedingen, und die Auseinandersetzung mit diesen Zusammenhängen bilden den Menschen in seinen Wahrnehmungs-, Gestaltungs- und Kommunikationsfähigkeiten.
Den Bezug zur Ästhetik stellt auch Roland Reichenbach (2021) in seiner bildungstheoretischen Annäherung an die baukulturelle Allgemeinbildung her. «Baukulturelle Erfahrungen sind auch ästhetische Erfahrungen. ‹Ästhetische Erfahrungen› ermöglichen ‹einen Zugang zum Wirklichen› (…), hierbei spielen nicht nur die sinnlichen Wahrnehmungen, sondern auch die sinnlichen Vorstellungen die zentrale Rolle» (Reichenbach, 2021, S. 65). Baukulturelle Bildung ermöglicht eine Auseinandersetzung mit den Erscheinungen der gebauten Umwelt, indem der Anblick von Architektur die eigenen ästhetischen Vorstellungen bestätigt oder auch dazu führt, Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Architektur, besonders zeitgenössisches Bauen, ist für Kinder, Jugendliche und selbst für Erwachsene meist nicht auf Anhieb verständlich und wird wohl auch deshalb oft abgelehnt. Gebäude die Architekten und Konstrukteurinnen für bedeutungsvoll halten, sind für Schülerinnen und Schüler – und nicht nur für sie – manchmal erklärungsbedürftig.
Ungewohnte Sichtweisen erfordern eine unvoreingenommene Wahrnehmung und basale Kenntnisse formaler Prinzipien und Gestaltungsgrundlagen. Dazu gehören beispielsweise Formkonzepte und Farbtheorien, Statik und Konstruktion oder Licht und Schattenwirkung, wie sie in diesem Buch praxisnah thematisiert werden. Mithilfe dieses Wissens wird es eher möglich sein, auch ungewohnte Bauwerke und Anlagen zu betrachten, einzuordnen und zu beschreiben.
Betrachtungs- und Gestaltungsfähigkeit setzen eine ästhetische Bildung im Sinne einer sinnlich vermittelten Wahrnehmung kulturell und historisch bedingter Erscheinungen voraus. Dabei ist eine Balance zwischen Theorie und Praxis in der Vermittlung der Grundlagen bedeutsam. Kinder und Jugendliche müssen diese Fähigkeiten in handelnder und verstehender Ganzheit und Gegenseitigkeit erlernen, um die sinnliche Wirkung von Oberflächen, Materialien, Farben und Formen begreifen zu können. Architektur, Kunst und Design sind weder als reine Praxis noch als reine Theorie vermittelbar. Wenn sich Kinder und Jugendliche in Baukultur bilden, bedeutet das daher sowohl intellektuelles Erkennen, emotionales Empfinden als auch gestalterisches Handeln.
Diese Bildungsperspektiven finden sich auch in den Lernzielen, die im Rahmen von Forschungsprojekten der Wüstenrotstiftung[8] für Deutschland definiert wurden. Im Zentrum der baukulturellen Bildung steht dabei die Förderung der Begriffs- und Kommunikationsfähigkeit sowie der Wahrnehmungs- und Gestaltungsfähigkeit von Schülerinnen und Schülern. Das Ziel ist, ein breites und zielstufenspezifisches Verständnis für baukulturelle Belange zu etablieren. Die im Folgenden aufgeführten Lernziele der baukulturellen Bildung beziehen sich auf die Zielformulierung des Union International Education Network UIA sowie die Projekte der Wüstenrotstiftung (Million et al., 2019). Die Autorinnen dieser Publikation formulieren diese wie folgt:
•ein sinnliches Bewusstsein für private und öffentliche Räume entwickeln;
•Sensibilität, Fantasie und eigene ästhetische Vorstellungen bilden;
•gestalterische Fähigkeiten und Fertigkeiten erlernen und anwenden;
•Problemlösungsverfahren kennen und Prozesse erfahren;
•Techniken und Materialien kennen und damit experimentieren;
•Bau- und Handwerksinteresse entwickeln und Handlungen nachvollziehen;
•Ideen und Optionen erforschen, darstellen und umsetzen;
•im Team arbeiten und kreative Lösungswege finden;
•Präsentations- und Argumentationsfähigkeiten entwickeln;
•traditionelles und zeitgenössisches Bauen kennen und schätzen;
•Zusammenhänge zwischen gebauter und natürlicher Umwelt verstehen;
•das Vokabular kennen, um über Baukultur diskutieren zu können;
•Rollen, Rechte und Verantwortlichkeiten von Bauleuten und Öffentlichkeit kennen;
•Baukultur als Aufgabe von Forschung und Entwicklung anerkennen.
Die Vielfalt der Lernziele zeigt es: Die gebaute Umwelt ist nicht nur ein Lebensort, sondern auch ein bedeutender Lernort mit Förderungspotenzial. Kinder und Jugendliche wachsen in städtischen oder ländlichen Umgebungen auf, die aufgrund des demografischen Wandels sowie der technologischen und digitalen Entwicklung in Veränderung begriffen sind. Historisch gewachsene Strukturen und Orte erfahren Umstrukturierungen. Vertraute Treffpunkte, wie Plätze und öffentliche Räume, werden erneuert; Desorientierung unter Jugendlichen und auch Erwachsenen kann die Folge sein. Auch präventive Aspekte im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen und räumlichen Gefüge sprechen dafür, Kinder und Jugendliche für Umweltveränderungen und Umweltgestaltungen zu sensibilisieren und sie, wo immer möglich, auch daran zu beteiligen. Die Qualitätskriterien des Bundesamts für Kultur unterstützen diese Bildungsbestrebungen, denn eine «hohe Baukultur (…) fördert die Verbundenheit mit dem Ort», stärkt die «Identität und Unverwechselbarkeit» und berücksichtigt «das Bedürfnis nach positiver ästhetischer Wertschätzung und einer erfüllenden Beziehung zwischen Menschen und Ort» (BAK, 2021, S. 23). Baukulturelle Bildung fördert somit die Sozialkompetenz im Sinne der Fähigkeit, sich in der Gesellschaft aktiv einzubringen (D-EDK, 2016b, S. 3).