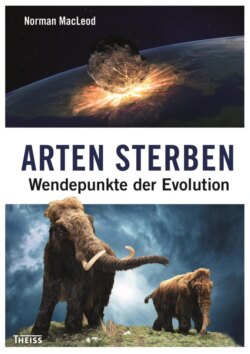Читать книгу Arten sterben - Norman Macleod - Страница 7
Оглавление|8|Der Ammonit Brasilia bradfordensis aus dem mittleren Jura. Dieses Exemplar ist aufgeschnitten worden, sodass seine durch Membranen oder Septa voneinander getrennten inneren Kammern sichtbar sind. Während der Fossilisation wurden einige dieser Kammern komplett, andere nur teilweise mit Sedimenten gefüllt, wieder andere überhaupt nicht. Das Verschwinden der Ammoniten wird gemeinhin mit dem endkreidezeitlichen Massenaussterben verbunden, jedoch ist kürzlich von Ammonitenfossilien aus Dänemark berichtet worden, die aus Sedimenten stammen, welche den endkreidezeitlichen Aussterbehorizont überlagern (also jünger sind).
|9|1 Was bedeutet „Aussterben“?
VOM AUSSTERBEN REDEN WIR, WENN das letzte Individuum einer taxonomischen Gruppe (z.B. einer Art, Gattung oder Familie) stirbt. Meist ist dies das Ergebnis einer über lange Zeit zurückgehenden Zahl von Individuen sowie einer immer weiter abnehmenden geografischen Verbreitung. Ökologen und Demografen benutzen das Wort „Aussterben“ oft im Zusammenhang mit dem Verschwinden einer Gruppe aus einem lokal begrenzten Gebiet oder einer Region. Der korrekte Fachterminus für ein örtlich begrenztes oder regionales Verschwinden ist „lokales Aussterben“. Paläontologen und Umweltschützer hingegen verwenden den Begriff Aussterben gewöhnlich in seiner korrekten fachsprachlichen Bedeutung des weltweiten Verschwindens einer Gruppe. Bei fossilen Befunden ist es allerdings oft schwierig, zu entscheiden, ob es sich bei dem Verschwinden eines Taxons um ein lokales oder globales Aussterben handelt. Dessen ungeachtet spielt das Aussterben eine wichtige Rolle als treibende Kraft hinter vielen natürlichen Prozessen. In der Tat ist das Aussterben zusammen mit den grundlegenden biologischen Prozessen der Adaptation, Selektion und Artbildung fundamental für das Verständnis der Geschichte, Gegenwart und Zukunft unserer natürlichen Umwelt.
Mathematisch betrachtet stirbt eine Gruppe dann aus, wenn die durchschnittliche Geburtenrate der Population über einen so langen Zeitraum unter ihrer durchschnittlichen Sterberate liegt, dass zufällige Schwankungen in den jährlichen Geburten- und Sterberaten die Populationsgröße auf null reduzieren können. Diese Schwankungen werden durch eine Vielfalt voneinander unabhängiger Faktoren verursacht, wie Umweltveränderungen, die Einwanderung von Raubtieren oder Mitbewerbern, die Elimination kritischer Ressourcen (z.B. Nahrung, Schutzräume, Nistplätze) oder das Einschleppen von Krankheiten.
Das Zusammenspiel von Faktoren, die das Aussterben befördern und/ oder verhindern, wird oft mittels mathematischer Modelle erforscht, mit denen für unterschiedlich große Populationen die wahrscheinliche Zeitspanne |10|bis zum Aussterben geschätzt werden kann. Unter der Annahme, dass die Faktoren, die zum Aussterben führen, zufällig und über die Zeit konstant sind, kann die erwartete Dauer bis zum Aussterben einer Gruppe beispielsweise durch die folgende Gleichung simuliert werden:
p0(t) = (dt/1 + bt)i
p0(t) = Wahrscheinlichkeit des Aussterbens
b = Geburtenrate
d = Sterberate
t = Zeitspanne bis zum Aussterben (in Generationen)
i = anfängliche Populationsgröße
Wenn die Extinktionswahrscheinlichkeit auf 95 Prozent und die Geburten- und Sterberaten auf dieselben konstanten Werte (etwa 0,5) gesetzt werden, kann das durch die Gleichung dargestellte System für eine hypothetische Reihe von Populationen unterschiedlicher Größen untersucht werden, indem die Resultate grafisch dargestellt werden (siehe unten). Man beachte, dass ein relativ geringer Anstieg in der Ausgangsgröße der Population eine enorme Auswirkung auf den geschätzten Zeitraum bis zur Extinktion hat. Dieses einfache mathematische Experiment verdeutlicht, dass kleine Populationen (z.B. weniger als 100) innerhalb sehr kurzer Zeitintervalle aussterben können, selbst wenn die Spannbreite der Umweltveränderungen konstant bleibt.
Die unten abgebildete Kurve prognostiziert, dass Arten mit großen Populationen weniger schnell aussterben als Arten mit kleinen Populationen. Entspricht dies tatsächlich den natürlichen Gegebenheiten? Man könnte ein Laborexperiment anstellen, um das Modell zu testen. Jedoch sind Labore per definitionem keine natürliche Umgebung. Glücklicherweise ist dieses Experiment schon unter völlig natürlichen Bedingungen für uns durchgeführt worden – und zwar auf Inseln.
Ergebnisse einer Reihe von Simulationen der Zeitspanne (in Generationen) bis zum Aussterben für verschiedene Populationsgrößen unter der Bedingung, dass Geburten- und Sterberaten bei demselben Wert von 0,5 liegen. Solche Experimente verdeutlichen die Beziehung zwischen der Anfälligkeit gegenüber dem Aussterben und der Populationsgröße.
|11|Die Erforschung von auf Inseln lebenden Arten hat sich als eine unserer besten Informationsquellen erwiesen, was den Prozess des Aussterbens betrifft. Inselspezies existieren nicht nur in kleineren Populationen als kontinentale Arten, sondern ihre Populationsgröße wird zudem durch die Größe der Insel selbst bestimmt. Das Datenmaterial über auf Inseln ausgestorbene Vogelarten bestätigt den erwarteten Zusammenhang. Die überwältigende Mehrheit jener Vogelarten, die nachweislich in den letzten 300 Jahren ausgestorben sind, war auf Inseln bis zur Größe Neuseelands beheimatet.
Diese Beziehung bleibt auch bei Vergleichen zwischen verschiedenen Inseln bestehen. Auf den Kanalinseln vor der kalifornischen Küste starben zwischen 1917 und 1968 bis zu 70 Prozent der Vogelarten aus. Die höchsten Extinktionsraten wurden auf den kleinsten Inseln der Gruppe verzeichnet (70 Prozent) und die niedrigsten Raten (36 Prozent) auf den größten.
Vergleichbare Daten gibt es heute von vielen anderen Inseln auf der ganzen Welt. Auch wenn es einige Zweifel gibt, ob die Zahlen nicht eventuell aufgrund unzureichender historischer Belege und/oder fehlerhafter Stichproben zu hoch eingeschätzt werden, ist doch der Zusammenhang zwischen Populationsgröße und Widerstandsfähigkeit gegen das Aussterben klar. Die meisten Ökologen sind sich darin einig, dass die Populationsgröße der bedeutendste Einzelfaktor bei der Bestimmung der Extinktionsanfälligkeit ist.
Angesichts des unvermeidlichen Schicksals einer jeden Art, einmal auszusterben, ist die Frage berechtigt, ob es zwischen den Arten Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt, die mit ihrer Widerstandsfähigkeit zusammenhängen. Sind die Umweltprozesse, die zum Aussterben führen, völlig zufällig in Anbetracht der artspezifischen Evolutionsgeschichte oder gibt es ein tiefer liegendes Muster, das uns helfen könnte zu erkennen, für welche Arten ein größeres Extinktionsrisiko besteht? Interessanterweise scheinen die Antworten auf diese Frage von dem als maßgeblich betrachteten Zeitrahmen abzuhängen.
In der modernen Welt ist das Gegenteil einer aussterbenden Art eine, deren Populationsgröße zunimmt (und damit meist auch deren geografische Ausbreitung). Da angenommen wird, dass im Grunde alle Arten als relativ kleine Lokalpopulationen beginnen, kann die Zeitspanne zwischen Artenbildung und Aussterben mit einem Entwicklungszyklus verglichen werden, in dem eine Abfolge verschiedener Phasen erkennbar ist. Dieser Taxon-Zyklus ist am umfangreichsten auf Inseln dokumentiert worden, wo der Zeitpunkt des Auftretens und Verschwindens von Arten in bestimmten geografischen Lagen anhand historischer Dokumente nachvollzogen werden kann. Durch die Erstellung von Karten zur geografischen |12|Verbreitung einer Spezies im Verlauf der Zeit können die klassischen Entwicklungsphasen Expansion (Phase I), Differenzierung (Phase II), Fragmentation (Phase III) und Endemisierung (Phase IV) rekonstruiert werden. Für Inselbiota lässt sich dieser Zyklus besonders leicht in Karten festhalten, doch das Konzept kann auch auf kontinentale und sogar marine Habitate angewendet werden.
Geht man vom Taxon-Zyklus aus, scheinen Arten mit einer langen Evolutionsgeschichte im Durchschnitt resistenter gegenüber dem Aussterben zu sein als Arten mit einer kurzen Geschichte. Der Evolutionsbiologe Leigh Van Valen ging in den frühen 1970er-Jahren dieser Frage nach, indem er aus der Fachliteratur über Fossilien die Zeitintervalle heraussuchte, in denen 24.000 fossile Taxa existierten. Van Valen fasste diese Daten in einer Serie von „Überlebenskurven“ zusammen, welche die Verteilung der Lebensdauer verschiedener Arten aufzeigten. Beispiele der Überlebenskurven aus dieser Studie finden sich im Folgenden.
Taxonomische Überlebenskurven für fossile Gattungen von Foraminiferen (links), Muscheln (Mitte) und Säugetieren (rechts). Die Analyse der stratigrafischen Vorkommen vieler fossiler Gruppen deutet darauf hin, dass die evolutionäre Lebensdauer jedes Taxons sehr spezifisch ist, dass jedoch im Laufe langer geologischer Zeitspannen die Aussterbeanfälligkeit nahezu konstant ist (siehe Van Valen 1973).
Beim Vergleich dieser Kurven stellte sich eine Reihe interessanter Tatsachen heraus. Erstens zeigten sich bei unterschiedlichen Typen von Pflanzen und Tieren charakteristische Unterschiede hinsichtlich ihrer Anfälligkeit gegenüber dem Aussterben. Zum Beispiel deuteten Van Valens Datensätze darauf hin, dass die durchschnittliche Lebensdauer einer Muschelart fünf Millionen Jahre beträgt, die einer Säugetierart dagegen nur eine Million Jahre. Es ist völlig unklar, warum diese Unterschiede zwischen Gruppen von Organismen bestehen. Doch dass es sie gibt, steht außer Frage.
Noch überraschender war die Erkenntnis, dass der Anteil an Gattungen und Arten, die in einer bestimmten Zeitspanne aussterben, innerhalb verschiedener höherer taxonomischer Gruppen (Familien und Ordnungen) beinahe konstant zu sein scheint. Van Valens Interpretation zufolge funktioniert die Evolution demnach nicht in der Weise, dass sie langlebigeren Arten eine größere Aussterberesistenz verleihen würde. |13|Schenkt man diesen Untersuchungen Glauben, werden die Arten im Laufe der Zeit durchschnittlich keineswegs besser darin, das Aussterben zu vermeiden. Vielmehr ist über die gesamte Erdgeschichte hinweg in jedem Zeitintervall stets ein fester Anteil von Arten ausgestorben, wenngleich die Zahlen von Gruppe zu Gruppe differieren. Spätere Forscher haben einzelne Aspekte von Van Valens Deutung angezweifelt. Dennoch konnten sich seine grundlegenden Ergebnisse den wiederholten Anfeindungen bemerkenswert gut widersetzen, da sie die Resultate neuerer Forschungen, die von Van Valens Kritikern angeregt wurden, bereits vorausgesagt hatten. Dieser Prozess des Versuchs, die Interpretationen von Kollegen zu widerlegen, indem man ihre Prognosen mit tatsächlichen Beobachtungen vergleicht, bestimmt den Fortschritt der Wissenschaft. Doch um die möglichen Gründe und Auswirkungen von Van Valens Befunden verstehen zu können, müssen wir erst die Rolle des Aussterbens innerhalb der evolutionären Vorgänge verstehen.