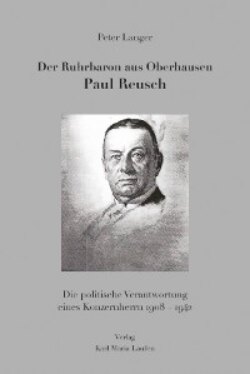Читать книгу Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch - Peter Langer - Страница 11
Wachsende Spannungen mit Gewerkschaften und den Interessenverbänden der Angestellten
ОглавлениеDer neue Generaldirektor Paul Reusch hatte seinen Posten in einer Situation verschärfter Spannungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften angetreten. Die freien Gewerkschaften hatten nach dem großen Streik von 1905 erheblich an Selbstbewusstsein gewonnen und waren deshalb spätestens 1910 nicht mehr bereit, die Reallohnverluste der vorausgegangenen Jahre seit der Hochkonjunktur 1907 hinzunehmen. Die Arbeitgeber der Schwerindustrie versteiften sich jedoch nach 1905 auf einen kompromisslosen Herr-im-Haus-Standpunkt; durch ihre Ablehnung jeglicher Verhandlungen mit den Gewerkschaften versuchten sie, die noch unorganisierten Arbeiter von einem Beitritt zur Gewerkschaft abzuschrecken. Noch vor der nächsten großen Kraftprobe mit den Gewerkschaften im Bergarbeiterstreik von 1912 jedoch ging die GHH unter Reuschs Führung gegen die Verbände der Techniker in die Offensive.
Der wachsende Einfluss der Interessenverbände der Angestellten alarmierte die Arbeitgeber fast noch mehr als das Anwachsen der streikbereiten Gewerkschaften der Arbeiter. Denn die unerschütterliche Gemeinsamkeit der Interessen von „Beamten“ und Werksleitung geriet dadurch ins Wanken. In den Verbänden der Techniker und der kaufmännischen Angestellten regte sich ein neuer Mittelstand; deshalb gab es in den liberalen Parteien große Sympathien für diese Bestrebungen, was die Schwerindustriellen veranlasste, umso härter gegen die unabhängigen Organisationen in ihrem Mittelbau vorzugehen.35
Die GHH erregte im Herbst 1911 durch die Maßregelung organisierter Techniker im Werk Sterkrade landesweit Aufsehen. Seit einer Resolution beim „Gautag“ des Bundes der technisch-industriellen Beamten (Butib) am 28. Mai 1911 in Duisburg stand dieser Verband unter verschärfter Beobachtung, weil seine Mitglieder es in diesem Beschluss abgelehnt hatten, sich als Streikbrecher einsetzen zu lassen. Dies – so der Duisburger Beschluss – sei mit der Standesehre der technisch-industriellen Beamten nicht vereinbar. Noch Monate später auf der Hauptversammlung von „Arbeitnordwest“36 wetterten die Unternehmer gegen diesen Beschluss als Wurzel allen Übels.37 Reuschs Stellvertreter Woltmann schrieb den Werksleitern der GHH in „streng vertraulichen“ Briefen, dass der Butib seitdem „völlig in radikalem Fahrwasser“ schwimme. Beim „Gehaltskampf“ im September 1911 in Berlin werde dies besonders deutlich. Ausdrücklich im Auftrag von Reusch wurden die Werksleiter verpflichtet, festzustellen, wer diesem Verband angehörte, und die Listen mit der Aufschrift „privat“ auf dem Umschlag Woltmann zukommen zu lassen.38
Die Erfassung der Verbandsmitglieder konnte nicht geheim bleiben, was den „Deutschen Techniker-Verband“ zu einem besorgten Brief an den Konzernherrn persönlich veranlasste. Schon der Stil der Anrede lässt erkennen, dass hier niemand „in radikalem Fahrwasser“ agierte: Der Geschäftsführer des Verbandes in Dortmund wandte sich an den „Hochwohlgeboren Herrn Generaldirektor P. Reusch, Königlicher Kommerzienrat“ in der Hoffnung, „bei Ihrem bekannten Wohlwollen den Angestellten gegenüber keine Fehlbitte zu tun“. In den Werken der GHH seien die Angestellten von den Abteilungsdirektoren einzeln vernommen worden, zum Teil seien sie zum Austritt aus dem Techniker-Verband gedrängt worden, „mit der gleichzeitigen Androhung, dass im Weigerungsfalle gekündigt werden würde“. Der Verband glaubte, dass hier ohne Reuschs Kenntnis „übereifrige Vorgesetzte den Staatsbürgerrechten der Angestellten zu nahe getreten sind“, und bat Reusch, Vertretern ihres Vorstandes „gütigst eine Unterredung gewähren zu wollen“.39 Reusch war wohl nicht „gütig“ in dieser Sache. In den Akten findet sich kein Antwortschreiben und auch kein Hinweis auf die höflich erbetene Unterredung, stattdessen ein Schriftstück, in dem ein Beamter in gestochener Sütterlin-Handschrift „ergebenst“ seinen Austritt aus dem Technikerverband mitteilt.40
Abb. 2:Deutscher Techniker-Verband, Geschäftsstelle Rheinland-Westfalen, Dortmund, an Reusch, 24. 10. 1911, in: RWWA 130-3001038/1b
Die angedrohten Entlassungen wurden zu diesem Zeitpunkt bereits eingeleitet. Bei dieser Aktion zeichnete sich Direktor Häbich im Werk Sterkrade durch besondere Härte aus. Dieser hatte in einer Konferenz mit den Abteilungsleitern die Vorgehensweise genau festgelegt. Der Nordwestlichen Gruppe des Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller teilte er konkrete Details mit: Die Verbandsmitglieder würden in Einzelgesprächen „zunächst mündlich dahin belehrt, dass sie durch ihre Berufsverbände irre geleitet und auf den Weg des Klassenkampfes gedrängt würden“. Man ließ ihnen nur die Wahl zwischen dem Austritt aus dem Verband und der Kündigung. Wenn sie sich weigerten, sofort eine Austrittserklärung zu unterschreiben, folgte die Entlassung. Von 44 so behandelten Technikern blieben nur sechs standhaft. Die Namen der Entlassenen wurden, mit Geburtsdatum, Geburtsort und genauer Berufsbezeichnung, dem Arbeitgeberverband mitgeteilt, damit alle Mitgliedsfirmen unterrichtet werden konnten.41 Bei Einstellungen mussten die Bewerber eine schriftliche Erklärung abgeben, dass sie keinem Berufsverband angehörten. Von Seiten der Firma sei, „zur Pflege der Geselligkeit“, die Gründung eines Beamten-Vereins in die Wege zu leiten.42 Die Direktoren ließen also keinen Zweifel daran, dass zwischen betriebsinterner Wohlfahrtspflege und Disziplinierung ein enger Zusammenhang bestand. Es wurde genau Buch geführt, welche Gehaltszahlungen den „ausgesperrten Technikern“ noch zustanden. Gleichzeitig erhielten sie ihre Beiträge zur Pensionskasse zurück vergütet. Alle Schritte der Sterkrader Werksleitung waren mit der Hauptverwaltung der GHH bis in alle Einzelheiten abgestimmt.43 Die GHH ließ also keinen Zweifel daran, dass eine Wiedereinstellung ausgeschlossen war.
Der harte Kurs der GHH stieß selbst in Unternehmerkreisen nicht überall auf Beifall. Reusch berichtete über die Maßnahmen seiner Firma bei einer Sitzung des Gesamtverbandes Deutscher Metallindustrieller in Berlin. Kein Geringerer als sein Unternehmerkollege Borsig kritisierte bei dieser Gelegenheit die Entlassungen als zu weitgehend. Er befürchtete negative Rückwirkungen bei den bevorstehenden Reichstagswahlen. Reusch beharrte aber auf seinem Standpunkt; der „Missstimmung in Beamtenkreisen“ glaubte er durch positive innerbetriebliche Maßnahmen entgegenwirken zu können.44
Die Maßregelung der Angestellten bei der GHH löste einen Sturm der Entrüstung aus. Die „Deutsche Industriebeamten-Zeitung“ erschien am 3. November 1911 mit der Schlagzeile „Der Tag von Sterkrade“ und kommentierte die Ereignisse auf der Titelseite, wie folgt: „Der Tag von Sterkrade ist ein schwarzer Tag in der Angestelltenbewegung. Mit Hilfe eines brutalen Gewissenszwanges hat die Gutehoffnungshütte einer Anzahl Kollegen ihr gesetzlich gewährleistetes Koalitionsrecht abgepresst. … Rücksichtslos, großartig. Bewundernswert, wenn solche Energie einmal für den Fortschritt der Menschen aufgewandt würde; verdammenswert, und alles Edle im Menschen zum Kampfe herausfordernd, wenn, wie hier, von dem Throne eines viele Millionen zählenden Aktienkapitals herunter Menschen, die nichts als ihr bisschen Ehre und Selbstachtung besitzen, auch dieses noch geraubt, die Menschenwürde mit Füßen getreten wird. … Was nun? Was tun?“45 Der Techniker-Verband und der Butib riefen zu großen öffentlichen Protestversammlungen in Köln, Düsseldorf, Elberfeld und Essen, aber auch in weit entfernten Städten wie Hamburg, Breslau oder Nürnberg auf.46
Eine besondere Wirkung versprachen sie sich von der Versammlung in Köln, da dort die Stadtverordnetenwahlen anstanden und das neue Stadtparlament über den Auftrag für den Bau einer neuen Rheinbrücke würde zu entscheiden haben. Bei der Ausschreibung lag die GHH gut im Rennen. Daher bestand bei den Techniker-Verbänden die Hoffnung, „dass die Versammlung die Kandidaten für die Stadtverordnetenwahlen veranlassen wird, ihr Amt von vorneherein mit dem festen Entschlusse anzutreten, der Gutehoffnungshütte, die das Recht ihrer Angestellten so schmählich mit Füßen getreten hat, den Auftrag auf keinen Fall zukommen zu lassen“.47
Für die Versammlung in der Düsseldorfer Tonhalle liegt ein ausführlicher „Stenographischer Bericht“ vor, wobei offen bleiben muss, auf welchem Weg dieses aufschlussreiche Dokument in die Akten der Konzernleitung der GHH gelangte. Der Hauptredner beschrieb die Vorgänge im Werk Sterkrade höchst anschaulich: „Es lässt der Direktor den Vorsitzenden der dortigen Ortsverwaltung des Deutschen Technikerverbandes zu sich kommen und gibt ihm auf, eine gemeinsame Austrittserklärung seiner Mitglieder einzureichen. Dem Vertrauensmann, dem die Mitglieder dieser Gruppe doch anvertraut sind und der ihre Rechte doch zu wahren hat, dem gibt man so kaltlächelnd den Auftrag, sammel mal die Austrittserklärungen deiner Mitglieder ein (Lachen!), die 22 Jahre dem Bunde angehört haben, ältere Leute, Familienväter, die sich freuen, dass sie versorgt sind, durch die Organisation mit dem ganzen Gros der Deutschen Techniker Fühlung zu haben. Für die Mitglieder des Bundes technisch-industrieller Beamten ging es etwas anders zu, für die hatte man hektographisch vervielfältigte Erklärungen ,Sterkrade, den 25. Oktober 1911. Ich verpflichte mich hiermit, sofort meinen Austritt aus dem Bunde anzumelden.’ Gleich für alle hergestellt.“48 Der „Gauleiter“ und andere Verbandsvertreter seien noch am gleichen Tag nach Sterkrade gefahren. „Wir fanden 37 Kollegen vor, die sich in außerordentlich gedrückter Stimmung befanden und sich immer fragten, was könnten wir tun gegen diese übermächtigen Geldmenschen. Nur 50 Minuten war Zeit zum Verhandeln. … Im Übrigen war allen gesagt worden, dass kein Zappeln etwas helfen würde, die Direktion hat es beschlossen und der Vorstand hat es beschlossen und was der Vorstand beschließt, das geschieht. Es ist ein sehr trauriges Kapitel, dass das alles geschieht. … Die Kollegen sahen sich sehr gedrückt gegenseitig an, sie hatten wenig Hoffnung, der Gutehoffnungshütte gegenüber etwas machen zu können.“49 Nachdem die Verbandsvertreter ihre Unterstützung versprochen hatten, wurde in geheimer Abstimmung beschlossen, dem Druck der Betriebsleitung nicht nachzugeben. 31 Unterschriften standen unter einer entsprechenden Erklärung, die die Verbandsvertreter dem Vorstandsvorsitzenden Reusch übergeben wollten. Der jedoch habe es abgelehnt, sie „zu empfangen“.50 Danach fiel einer nach dem anderen um. „Man holte den jüngsten herein. Man schnauzte ihn an, er unterschrieb. … Die Verhältnisse in diesen Werken sind dazu angetan, Charaktere zu fällen, wer einmal in diesem Betriebe gewesen ist, wer einige Jahre Beobachtungen gemacht hat, der weiß, dass dort Charaktere gebrochen wurden, systematisch, planmäßig. Man hat mit den Jüngsten angefangen, man hat ihnen einfach befohlen, sie haben unterschrieben. Sie fühlen sich nicht berufen, Vorkämpfer für andere zu werden. ,Wir setzen Sie einfach auf die schwarze Liste, und Sie werden nie wieder Arbeit finden’ (Pfui!).“51 Besonders hervorgehoben wurde danach sogleich der Mut der Wenigen, die dem Druck standgehalten hatten und sofort entlassen worden waren. Im Spektrum der gewiss nicht gewerkschaftsfreundlichen Schwerindustrie hatte sich die Konzernleitung der GHH mit dieser Aktion als besonders reaktionär profiliert. „Die Herren von der Gutehoffnungshütte vergessen aber … eins, dass nicht alle Betriebe so sind wie die der Gutehoffnungshütte. Dass nicht in allen Betrieben jener Geist umhergeht, der die Menschen, die Angestellten einander gegenüber misstrauisch macht, der es nicht dazu kommen lässt, sich zu verständigen. So sieht es aus. Aber Gott sei Dank nicht überall, und wo sie hinfassen werden mit tückischer Hand, die Geldleute, da werden sie sich das nächste Mal die Finger verbrennen.“52
Weitere Redner prangerten die Vorgehensweise der GHH an. In teilweise sehr pathetischem Stil beriefen sie sich auf die Menschenrechte, verlangten das Eingreifen des Staatsanwaltes zum Schutz des Koalitionsrechtes der Angestellten und forderten immer wieder dazu auf, bei der kommenden Reichstagswahl, Kandidaten zu unterstützen, die für die Rechte der Arbeitnehmer eintraten. Kein Redner ließ sich die Gelegenheit entgehen, durch Wortspiele mit dem Namen der GHH zu punkten: „Es ist ein eigentümliches Wort, das sich die Gutehoffnungshütte genommen hat (Lachen). Gute Hoffnung. Die Hoffnung, die wir hatten, dass es endlich im Deutschen Vaterlande anders gehen sollte mit den Menschenrechten, gerade diese Gutehoffnungshütte hat uns die gute Hoffnung und den Glauben daran gründlich versalzen. … Wem liegt nicht daran einzutreten für Menschenrecht, wem liegt nicht daran, für Staats- und Bürgerrecht einzutreten? Diejenigen, die nicht davon überzeugt sind, dass wir uns unser Recht erkämpfen müssen, können gestrichen werden wie die Umgefallenen von Sterkrade, sie gehen heute als Knechte einher und das in einem Werke, das sich Gutehoffnungshütte nennt.“53 Auch wenn man rhetorische Überspitzungen in Betracht zieht, so drängt sich doch der Eindruck auf, dass in den Betrieben der GHH, und dort wiederum vor allem in Sterkrade, unter Reuschs Führung ein extrem harter Kurs gegen die Arbeitnehmer gefahren wurde. „Sterkrade“ wurde zum Symbol für die kompromisslose Durchsetzung des Herr-im-Haus-Standpunktes: „Was wird aus uns werden, wenn in dem Kampf das Arbeitgebertum Sieger bleibt, das sich den Scherz von Sterkrade geleistet hat. Was wird aus uns werden, wir alle werden Nummern und bleiben Nummern in dem bewegten großen Betrieb, der uns beherrscht. Wird unser Schicksal glücklicher sein, wenn wir willenlos alles mit uns geschehen lassen müssen, was die Großindustrie mit uns vor hat?“54 Ein Redner nach dem anderen kritisierte die extreme Härte des „Arbeitgebertums“ in der GHH, wetterte „gegen das Herrentum von Sterkrade“55, auch gegen Reusch ganz persönlich: „Mag Sterkrade einen Direktor haben, der Kommerzienrat oder wer weiß was ist, wir werden ihm zeigen, dass unsere Organisation stark ist.“56 Niemand jedoch rief zum Umsturz des wirtschaftlichen und politischen Systems auf. Im Gegenteil: Es sollte im Rahmen des bestehenden Systems bei der Vergabe von Staatsaufträgen Druck ausgeübt werden: „Ich frage Sie, wie stellen sie sich dazu, soll der Bau der neuen Rheinbrücke [in Köln] der Gutehoffnungshütte übertragen werden?“57
Es muss noch einmal daran erinnert werden, dass diese Reden nicht von Arbeitern oder Gewerkschaftsführern gehalten wurden. Dies waren keine marxistisch orientierten Sozialdemokraten, sondern Vertreter des „neuen Mittelstandes“. Sie waren nicht auf Umsturz aus, sondern wollten, wie gerade die Vorgehensweise in Köln zeigt, die vorhandenen halb-demokratischen Institutionen auf legalem Wege nutzen. Ihre Kritik und Strategie war also ganz „systemimmanent“. Reusch war offenbar unfähig, dies zu erkennen. Er sah sich, wie er wenig später in selbstgefälligem Ton bemerkte, im Kampf mit umstürzlerischen Reichsfeinden.
Die Zeitungen der Region und darüber hinaus berichteten ausführlich über die Kundgebungen. Der Arbeitgeberverband seinerseits registrierte aufmerksam, welchen Widerhall der Konflikt in der Öffentlichkeit fand. Reusch wich trotz der schlechten Presse jedoch keinen Millimeter von seiner harten Position ab; er bestand darauf, dass auch Beamte mit langfristigen Verträgen zu entlassen seien.58 Gleichzeitig versuchte der Arbeitgeber-Verband, seine Sicht der Dinge in die Presse zu lancieren, was sich jedoch selbst bei Industrie-abhängigen Blättern als schwierig erwies. Der Geschäftsführer von „Arbeitnordwest“ schickte Reusch deshalb zur Entschuldigung die Abschrift eines Schreibens, in dem der Chefredakteur der „Rheinisch-Westfälischen Korrespondenz“ die Probleme erläuterte: „Der Fall der Gutehoffnungshütte contra Bund technisch-industrieller Beamten hat die öffentliche Meinung sehr erregt.“ Bei der Kundgebung in der Tonhalle in Düsseldorf habe sich der Reichstagsabgeordnete Haberland von der SPD „rückhaltlos auf die Seite der Techniker gestellt“. Unter denen, die ihm „lebhaft zustimmten“, seien „nicht etwa nur kleine Techniker, sondern auch sehr angesehene Ingenieure und Betriebsführer in großer Zahl“ gewesen. „Würden nun nationalliberale und konservative Blätter im gegenwärtigen Augenblick gegen den Bund technisch-industrieller Beamten und gegen das Koalitionsrecht der Techniker und Ingenieure Stellung nehmen, so würde die direkte Folge die sein, dass auch diese bedeutsamen Kreise des Mittelstandes … bei den bevorstehenden Wahlen in Scharen der Sozialdemokratie zugeführt werden.“59 Daher sei die Redaktion einstimmig der Meinung gewesen, dass die „Rheinisch-Westfälische Korrespondenz“ den Artikel der Arbeitgeber nicht veröffentlichen sollte.
Reusch aber wich keinen Jota zurück. Er nahm die Öffentlichkeitsarbeit nun eben selbst in die Hand. Der Kölner Oberbürgermeister Wallraf erhielt eine 11-seitige Darstellung des Standpunktes der GHH. Der „Kölnischen Zeitung“ schickte Reusch persönlich einen 7-seitigen Artikel über den Techniker-Verband: „Ich nehme an, dass die ,Kölnische Zeitung’ das ,audiatur et altera pars’ in der Techniker-Bewegung nicht übersehen wird.“60 Wegen des Auftrages für die neue Rheinbrücke war die Kölner Presse für die GHH besonders wichtig. In der Öffentlichkeit wurde vermutet, dass bei der Stadtverwaltung in Köln die „Neigung besteht, die starke wirtschaftliche Macht der Stadt bei einer großen Auftragserteilung (ein Brückenbau, um den die Gutehoffnungshütte-Sterkrade konkurriert) für die Arbeitnehmer in die Waagschale zu werfen.“61
Ganz offen verlangten die Interessenverbände der Angestellten, „dass in den Lieferungsverträgen der Stadt Cöln eine Bestimmung aufgenommen wird, wonach bei Vergebung von Arbeiten nur solche Firmen berücksichtigt werden, die das Koalitionsrecht der Angestellten und Arbeiter achten; ferner bei der Vergebung der zu erbauenden neuen Rheinbrücke die Gutehoffnungshütte in Sterkrade nicht zu berücksichtigen.“62 Die Technikerverbände beriefen sich auf ein Gesetz, das schon 1869 alle Koalitionsverbote aufgehoben habe. Es liege deshalb „ein öffentliches Interesse vor …, eine derartige Herrenmoral, wie sie von der Gutehoffnungshütte bestätigt worden ist, als unsittlich zu brandmarken. Die Proteste der Öffentlichkeit bleiben auf Arbeitgeber vom Schlage der Leiter der Gutehoffnungshütte und auf Werke von dieser Größe so lange ohne Eindruck, dass [sic!] ihnen die Missbilligung ihres Verhaltens nicht an der Stelle fühlbar gemacht wird, wo sie am empfindlichsten sind, nämlich an ihrem Gewinn.“63
Reusch schickte den Direktoren Häbich (Sterkrade) und Woltmann, seinem Stellvertreter, sofort eine Abschrift dieser Eingabe und ordnete an, „sämtlichen Stadtverordneten von Cöln in einer ruhig und sachlich gehaltenen Zuschrift die Verhältnisse auseinander[zu]setzen“. Unsachlich waren natürlich nur Reuschs Gegner: „Auf die Tatsache, dass das Gros der Techniker die maßlose Agitation und Verhetzung selbst auf das allerschärfste verurteilt“ sei besonders hinzuweisen. Bei den Techniker-Organisationen hätten „die sozialdemokratischen Tendenzen … Oberwasser bekommen“.64 Sozialdemokratische Tendenzen – dies war ins Reuschs Augen die schlimmste Sünde.
Wenige Tage später ging das Erwiderungsschreiben der GHH an 52 Kölner Stadtverordnete, zwölf Beigeordnete – u. a. an den Beigeordneten Konrad Adenauer – und an den Oberbürgermeister. Es enthielt keinerlei Signale der Kompromissbereitschaft, es enthüllte vielmehr erneut die gewerkschaftsfeindliche Gedankenwelt, in der die Konzernleitung der GHH offenbar stärker als andere Unternehmer gefangen war. Die Techniker seien „die Vertrauensleute des Unternehmers im Verkehr mit der Arbeiterschaft. Gleiten diese Vertrauensleute in das Fahrwasser des zielbewussten Klassenkampfes, so ist damit die Fortdauer des ganzen Betriebes überhaupt in Frage gestellt. Es ist daher einfach Pflicht des Unternehmers, Verbände, welche die Techniker durch systematische Verhetzung aus Vertrauensleuten zu Gegnern der Betriebsleitung machen wollen, energisch zu bekämpfen.“ Der Unternehmer dürfe nicht „untätig zusehen, dass die in seinem Betriebe beschäftigten Beamten Verbänden angehören, die nicht davor zurückschrecken, durch Anwendung der allerschroffsten Kampfesmittel wie Ausstand und Verhängung der Sperre ein ganzes Werk zum Stillstand zu bringen und damit die Arbeiter erwerbslos zu machen.“ Als Beleg wird auf den Beschluss verwiesen, in dem die Techniker es abgelehnt hatten, sich als Streikbrecher einsetzen zu lassen. Der GHH gehe es nicht „um einen Angriff auf die Koalitionsfreiheit, sondern um die rechtzeitige Abwehr gefährlicher Ausschreitungen in der deutschen Techniker-Bewegung und um den Schutz der größeren Mehrzahl unserer Beamten gegen den Koalitionszwang und den Gewerkschaftsterrorismus.“ Im Schatten des Kölner Doms erschien der preußisch-protestantischen Konzernleitung am Ende des Appells auch der Hinweis auf einen Artikel in der katholischen „Oberhausener Volkszeitung“ angebracht, in dem die „katholischen Techniker und ihre evangelischen Kollegen“ vor dem Butib gewarnt wurden.65 Die „Kölnische Zeitung“, die in den Dezembertagen davor den Arbeitgebern und den Technikerverbänden auf der Titelseite viel Raum gegeben hatte, widmete Reuschs Eingabe an die Kölner Stadtverordneten nur eine kurze Notiz.66
Alle Mühen waren vergebens. Am Bau der Dombrücke (Eisenbahn- und Straßenbrücke), die 1911 endgültig dem Verkehr übergeben worden war, war die GHH beteiligt. Bei der Deutzer Brücke – um die drehte sich der Streit – erhielten nach zweimaligem Wettbewerb MAN (Werk Gustavsburg) und die Klöckner-Humboldt AG den Zuschlag für die Stahlarbeiten. Für die Stadt Köln federführend war dabei der Beigeordnete Adenauer. Die Bauarbeiten an der Deutzer Brücke begannen 1913. Am 15. Juli 1915 wurde sie dem Verkehr übergeben.67
In der liberalen Presse blies Reusch der Wind ins Gesicht, selbst industriefreundliche Blätter neigten zur Zurückhaltung, im Kreise der Unternehmer aber fand sein harter Kurs an einigen Stellen sofort Nachahmer. Im Bezirk der Nordwestlichen Gruppe des VdESI machten jetzt auch andere Werke Front gegen die „arbeitgeber-feindlichen Anschauungen“ und die angeblich „sozialistischen Tendenzen“ in den Verbänden der Angestellten.68 Gleichzeitig erhöhten die Arbeitgeber des Ruhrbergbaus den Druck auf die Steiger. Ein Polizeispitzel in Essen hatte dem Zechenverband die Postversandsliste der Zeitschrift des Deutschen Steigerverbandes besorgt. Aufgrund dieser Liste wurden ca. 500 Steiger zum Austritt gezwungen; allen anderen wurde mitgeteilt, dass die Zugehörigkeit zum Steigerverband ein Entlassungsgrund sei. Die Mitgliederzahl dieses Verbandes schrumpfte unter diesem Druck von 1.600 bis zum Ende des Jahres 1911 auf 200.69 Generell verschärft wurde die Konfrontation durch den lange vor 1912 einsetzenden Reichstagswahlkampf.70 Reusch erhielt auf der Jahresversammlung der Deutschen Arbeitgeberverbände im Dezember 1911 einen Vertrauensbeweis, als er demonstrativ in den Ausschuss der Hauptstelle gewählt wurde.71
Auch außerhalb des Reviers und der Schwerindustrie wurde Reuschs Kampf mit den Verbänden der Angestellten aufmerksam verfolgt. Im folgenden Februar informierte der Geschäftsführer des Vereins der Hamburger Reeder die GHH über einen ähnlich gelagerten Arbeitskampf auf den Schiffen der Hamburger und Bremer Reeder. Diese meinten, beim „Verein Deutscher Kapitäne und Offiziere der Handelsmarine“ eine gefährliche Radikalisierung festzustellen: Die Offiziere hätten sich auf den Schiffen mit den Seeleuten solidarisiert. Wenn sie das hingenommen hätten, wäre den Reedern die Verfügung über ihre Schiffe auf See entzogen worden. Daher hätten die Reeder alle ihre Kapitäne und Offiziere verpflichtet, aus dem Verein auszutreten. Nur ca. 40 Männer hätten sich geweigert und seien deshalb sofort entlassen worden. Der Vergleich mit der See-Schifffahrt und der uneingeschränkten Kommandogewalt des Kapitäns und letztlich der Reederei muss Reusch besonders gefallen haben. Er hatte den Hinweis auf die Verpflichtungserklärung und die Entlassung in diesem Schreiben dick angestrichen.72
Beim Spitzenverband der Arbeitgeber würde man sich noch sechs Jahre später, im November 1917, an den Konflikt der GHH mit dem Butib erinnern. Woltmann schickte der Vereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände das gedruckte Schreiben der GHH an die Kölner Stadtverordneten.73
Reuschs Härte im Umgang mit den Angestellten wurde ein Vierteljahr später beim Bergarbeiterstreik erneut auf die Probe gestellt. Die erschreckende Kompromisslosigkeit, mit der er allen gewerkschaftlichen Bestrebungen entgegen trat, mag teilweise darauf zurückzuführen sein, dass er im Vorfeld der Reichstagwahlen gerade die Erfahrung gemacht hatte, dass auch die Gremien der Nationalliberalen Partei sich von den Großunternehmern nicht einfach herumkommandieren ließen. Auch in der Parteipolitik profilierte sich der junge Generaldirektor auf dem äußersten rechten Flügel des politischen Spektrums.