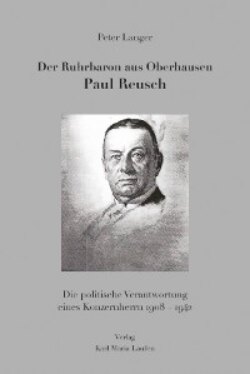Читать книгу Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch - Peter Langer - Страница 14
Die lokale Verankerung
ОглавлениеEs gibt keine Ton-Aufnahmen von Paul Reusch, aber die Vermutung liegt nahe, dass ihn sein süddeutscher Akzent immer sofort als Nicht-Preußen verriet. Dies würde zumindest ansatzweise seinen pathetisch zur Schau getragenen Lokalpatriotismus und die übereifrigen Loyalitätsbekundungen zum preußisch-deutschen Kaiserreich erklären. Unmittelbar nach seiner Ernennung zum neuen Vorstandsvorsitzenden, noch vor seinem offiziellen Dienstantritt in dieser Funktion verlegte der eben vierzigjährige Paul Reusch seinen Wohnsitz nach Oberhausen und brachte damit klar zum Ausdruck, wem er in der Konkurrenz mit Sterkrade den Vorzug gab.
Abb. 5:Paul Reuschs Wohnhaus Lipperfeld 3, StA Oberhausen
Damit waren bereits im Kaiserreich die Weichen gestellt für die Eingemeindung von Sterkrade und Osterfeld zwanzig Jahre später. In der Konkurrenz der Nachbarstädte ging es zunächst lediglich um zusätzliche Industrieflächen für die GHH am Ufer des Rhein-Herne-Kanals. Paul Reusch beanspruchte den sogenannten Grafenbusch am Nordufer des Kanals für neue Werksanlagen und setzte sich gegen heftige Proteste aus Sterkrade durch. Dadurch schrumpfte der Anteil Sterkrades am Nordufer des Kanals auf magere 1.700 Meter. Aber neue Arbeitsplätze entstanden für die Sterkrader nicht; weder ein neues Werk noch ein Werkshafen wurde auf der „Landzunge“ gebaut. Noch 1913 war der Grafenbusch nördlich des Rhein-Herne-Kanals so ausgedehnt, dass die führenden Herren der GHH dort auf die Pirsch gehen konnten. Im Dezember 1913 lud Paul Reusch Paul de Gruyter, ein Mitglied des Aufsichtsrates, dorthin zur Jagd ein; als Treffpunkt schlug er die Emscherbrücke auf der Straße von Oberhausen nach Sterkrade vor.150
Nach der Verdrängung vom Nordufer des Kanals war die Verleihung der Stadtrechte an die Gemeinde Sterkrade nur ein schwacher Trost.151 Reusch hatte sich persönlich intensiv um die Sache gekümmert. Er war gemeinsam mit Bürgermeister zur Nieden zum Regierungspräsidenten nach Düsseldorf und zu anderen zuständigen Behörden gefahren. Auf Reuschs Drängen ließ sich der Regierungspräsident im Dezember 1912 sogar dazu herab, eine Besichtigungsfahrt in Sterkrade durchzuführen. Als besonderer Gunsterweis wurde es bei dieser Gelegenheit registriert, dass Reusch dem Bürgermeister ein Automobil zur Verfügung stellte.152
Im öffentlichen Leben der Stadt Oberhausen trat der junge Vorstandsvorsitzende als strammer Nationalist in Erscheinung. In einer viel beachteten Rede im Kriegerverein der GHH am Neujahrstag des Jahres 1911 forderte er die Oberhausener „Krieger“ zu energischen Werbeaktivitäten auf. Um diesen Bemühungen Nachdruck zu verleihen, wurde der GHH-Direktor Woltmann, der den Kriegern seinen Rang als Oberleutnant präsentieren konnte, in den Verein delegiert. Danach stieg die Mitgliederzahl innerhalb eines halben Jahres auf das Dreifache.153 Bereits ein Jahr später hielt Woltmann zu Kaisers Geburtstag die Festrede „und endete mit einem Hoch auf den Kaiser und brausend schallte die Nationalhymne durch den Saal. Hierauf betrat der MGV ,Gute Hoffnung’ die Bühne und brachte mit reinem Stimmenmaterial das Lied ,Heil Kaiser und Reich’ zum Vortrage“.154
Die Nähe Reuschs zum Oberhausener Oberbürgermeister Havenstein hatte schon in der Sitzordnung beim Bankett zu Kaisers Geburtstag am 27. Januar 1912 im Kaisergarten-Restaurant ihren Ausdruck gefunden: „Auf dem Musikpodium war inmitten von Topfgewächsen die Kaiserbüste zu sehen. Auf der Haupttafel stand vor dem Platze des Herrn Oberbürgermeisters der große silberne Tafelaufsatz der Stadt. Neben dem Herrn Oberbürgermeister nahmen auf der einen Seite Herr Kommerzienrat Reusch, der Generaldirektor der Gutehoffnungshütte, und auf der anderen Herr Amtsgerichtsrat Wilms als Leiter des hiesigen Amtsgerichts Platz.“155 Wenige Tage später saß Reusch an gleicher Stelle wieder auf dem Podium, direkt neben ihm hatte der Oberpräsident der Provinz Rheinland Freiherr von Rheinbaben Platz genommen. Reusch hielt zum Geburtstag der Stadt Oberhausen eine donnernde Rede.
Während an der Vorherrschaft Oberhausens im Verhältnis zu den kleineren Nachbarstädten Sterkrade und Osterfeld schon vor 1914 nicht mehr zu rütteln war, wurde der Wettbewerb mit den anderen Ruhrgebietsstädten und den dort angesiedelten Konkurrenzunternehmen mit harten Bandagen ausgefochten. Dies ließ Reusch 1912 in seiner Rede zur 50-Jahr-Feier der Stadt Oberhausen durchblicken. Er sprach von „hartem Kampf“ und „heißer Arbeit unter widrigen Verhältnissen“, unter denen man Oberhausens Anspruch auf „ein Plätzchen an der Sonne“ gleichwohl habe durchsetzen können. Es entsprach dem Zeitgeist, wenn er prophezeite, dass Kohle und Stahl „noch durch Jahrhunderte“ das „Fundament der Stadt“ sein würden. An die Exzellenzen der preußischen Staatsregierung appellierend, betonte er, dass der Bestand dieses Fundaments „von der Beibehaltung der gegenwärtigen Wirtschaftspolitik abhängig“ sei. Dies war eine Spitze gegen jeden, der es wagte, am Dogma der Schutzzollpolitik zu rütteln oder auch ein Entgegenkommen in Richtung Sozialdemokratie zu fordern. Voller Stolz verkündete Reusch, dass „die Stadt Oberhausen unter allen Städten Deutschlands die geringste Schuldenlast pro Kopf der Bevölkerung aufweist“. Dies – so stichelte er – erfülle die Nachbarstädte mit Neid. Die Rede erreichte ihren Höhepunkt in dem obligaten patriotischen Treue-Bekenntnis: „Die Bürger der Stadt Oberhausen sind ohne Ausnahme Männer der Arbeit. Diese Männer haben zum Teil unter widrigen Verhältnissen und in hartem Kampfe in kurzer Zeit ein großes blühendes Gemeinwesen geschaffen. Allezeit treu zu König und Vaterland, treu zu Kaiser und Reich stehend, sind die Einwohner dieser Industriestadt noch heute in ihrer großen Mehrheit und wollen es bleiben für alle Zukunft national bis auf die Knochen.“156
Es gibt heute die Neigung, derartige Rhetorik als eine unserem Geschmack nicht mehr entsprechende, aber im Grunde harmlose Ausdrucksweise gutmütiger Patrioten abzutun. Diese Sichtweise verkennt jedoch, wie gefährlich der Nationalismus der um die Jahrhundertwende im rechten Spektrum sich ausbreitenden Organisationen war. Die Kriegervereine, von Reusch nachdrücklich gefördert, lieferten der bürgerlichen Rechten die Massenbasis für ihre zunehmend hysterischen Kampagnen in den Krisen vor dem Ersten Weltkrieg. Dieser Stimmung in der Öffentlichkeit konnte sich auch die Reichsregierung seit der zweiten Marokkokrise immer weniger entziehen, gerade weil sie sich der Illusion hingab, den Propaganda-Apparat des „Alldeutschen Verbandes“ vorübergehend zur Unterstützung ihrer außenpolitischen Absichten nutzen zu können. Durch diese Taktik machte sie sich „zur Geisel des extremen Nationalismus“.157 Diese Extremisten sehnten den großen Krieg herbei, je eher desto besser.
„Männer der Arbeit“ waren bei diesem Festessen im Nobel-Restaurant Kaisergarten nicht anwesend. Die Exklusivität dieser Veranstaltung hatte in der Oberhausener Bevölkerung erhebliche Irritationen ausgelöst. Selbst der ansonsten ganz staatstreue „Generalanzeiger“ kritisierte, dass die Stadt keine Volksfeste zur 50-Jahr-Feier organisiert hatte: „So lässt man nun eigentlich diesen Ehrentag der Stadt Oberhausen für die Masse seiner Bürger sang- und klanglos vorübergehen, und es ist begreiflich, wenn hierüber weite Kreise unserer Bevölkerung ihrem Befremden Ausdruck geben.“158