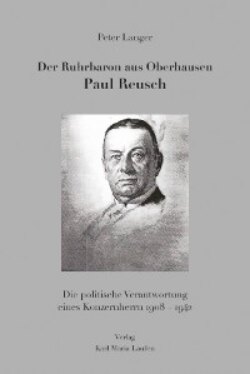Читать книгу Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch - Peter Langer - Страница 16
Verstärkte Förderung der „gelben“ Werkvereine
ОглавлениеDas Anwachsen der Wählerstimmen für die SPD und das Zentrum bei den Reichstagswahlen im Januar und der Bergarbeiterstreik im März 1912 veranlassten Reusch, die Pläne für die Gründung wirtschaftsfriedlicher Werkvereine bei der GHH energisch voranzutreiben. Bereits im Juni 1911 war in der GHH eine Arbeitsgruppe eingerichtet worden, um die wirtschaftliche, soziale und politische Problematik derartiger Gründungen zu prüfen. Reusch schien die 1908 gegründete, stramm nationale „Deutsche Vereinigung“ als Führungsorganisation der Werksvereinsbewegung besonders geeignet. Nach den März-Streiks wurde die Gründung des Werkvereins bei der GHH in beeindruckendem Tempo durchgezogen: Im April 1912 holte der nationalliberale Parteisekretär Max Liebscher im Auftrag der GHH Informationen bei der Firma Krupp in Essen ein; im Juni standen die „Grundzüge für die Bildung eines Werkvereins“ schriftlich fest; im August 1912 berieten die leitenden Angestellten bereits eine Satzung; im Oktober fanden unter Aufsicht der jeweiligen Betriebsleiter die konstituierenden Sitzungen auf den Zechen und in den einzelnen Werken der GHH statt; im selben Monat Oktober konnten bereits 955 Mitglieder gemeldet werden, bis zum Januar 1913 stieg die Mitgliederzahl auf 1.303 an, bis zum Krieg auf 1.879, was 20% der Belegschaft entsprach. Da die Wohlfahrtseinrichtungen der GHH bereits vorher gut ausgebaut waren, fielen nur geringe Zuschüsse des Betriebs für den Werkverein an: Für das Jahr 1913 nur ca. 7.000 Mark.182 Die Oberaufsicht lag bei Reuschs Stellvertreter Woltmann, der seinem Chef regelmäßig berichtete und u. a. dem Aufsichtsrat für die Sitzung im August 1912 ein „Normalstatut für Werkvereine“ vorzulegen hatte.183
Vor allem die christlichen Arbeitervereine beider Konfessionen empfanden die Werkvereine als unangenehme Konkurrenz; für die Mitgliedschaft in katholischen Arbeitervereinen galt ab Ende 1912 ein Unvereinbarkeitsbeschluss gegenüber den „gelben“ Werkvereinen. Die Auswirkungen ließen sich in Osterfeld exemplarisch studieren. Auf der Zeche Osterfeld existierte ab Mai 1912 ein Werkverein, der bis zum Jahresende auf annähernd 1.000 Mitglieder anwuchs. Nach dem Dözesan-Delegiertentag der katholischen Arbeitervereine und dem dort gefassten Unvereinbarkeitsbeschluss schrumpfte die Zahl der Mitglieder auf 300. „In einer fast rein katholischen Gegend wie Osterfeld war es einem Bergarbeiter nicht möglich, aus dem katholischen Knappenverein auszutreten. Er setzte sich dadurch mit seiner ganzen Familie massiven Repressionen aus, die vom ,Schneiden’ auf dem Arbeitsplatz bis zur ,Ermahnung’ von der Kanzel herab reichten.“184
Aber nicht nur im Lager der Katholiken gab es Vorbehalte gegenüber den „gelben“ Werkvereinen. Der Vorsitzende der Nationalliberalen im Wahlkreis Duisburg-Mülheim-Oberhausen äußerte sich ebenfalls sehr kritisch über die Gründungswelle dieser völlig von den Unternehmern abhängigen Organisationen; er befürchtete eine Spaltung des Nationalliberalen Volksvereins und als Folge die Erosion der Wählerbasis seiner Partei. Die Vertreter der Schwerindustrie, allen voran Paul Reusch, wiesen seine Kritik scharf zurück. Nach ersten Erfolgen bei den Landtagswahlen 1913, bei denen die Nationalliberalen Gewinne erzielen konnten auf Kosten der SPD und des Zentrums und als zur Freude Reuschs im ganzen Ruhrgebiet „rechtstehende Männer“ in die Fraktion einzogen, erhoffte er sich für die Zukunft auch eine stärkere Rechts-Orientierung in der Reichstagsfraktion der Nationalliberalen.185
Am 26. Oktober 1913 schlossen sich die Werkvereine des Ruhrgebiets auf einer Tagung in Oberhausen zum Verband der wirtschaftsfriedlich-nationalen Arbeitervereine im rheinisch-westfälischen Industriegebiet zusammen. Die Unternehmer verfolgten mit ihrer finanziellen Unterstützung die folgenden Ziele: Die ideologische Beeinflussung der Arbeiter im Sinne von Werksgemeinschaft, Arbeitsfrieden und nationaler Größe; die Abschottung der Belegschaften gegen eine „Vergewerkschaftung“; den Aufbau eines umfassenden Hilfskassenwesens und die Pflege der Geselligkeit. Neben diesen handfesten materiellen Vorteilen für die Mitglieder der Werkvereine legten die Satzungen allerdings auch fest, dass bei einer Streikbeteiligung finanzielle Zuwendungen unterbrochen bzw. Darlehen zurückgefordert werden konnten. Paul Reusch legte besonderen Wert darauf, dass seine leitenden „Beamten“ regelmäßig an den Vereinsfesten teilnahmen.186
Unter Reuschs Obhut entwickelten sich die sogenannten „gelben“ Gewerkschaften in Oberhausen prächtig. Für die Jahre vor dem Ersten Weltkrieg konnte der GHH-Chef 1913 zufrieden feststellen, dass es „den Arbeiterorganisationen weder gelungen [sei], der Großeisenindustrie ihren Willen aufzuzwingen“ noch in der Arbeiterschaft der GHH „in maßgebendem Umfang Fuß zu fassen“. Dieser „gute Geist“ sei vor allem auf das Wirken der wirtschaftsfriedlichen Gewerkschaften in der GHH-Belegschaft zurückzuführen.187