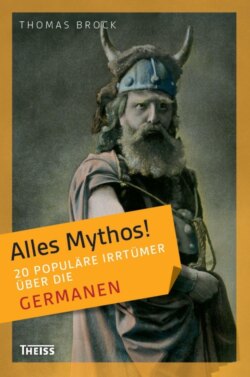Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Germanen - Thomas Brock - Страница 11
IRRTUM 2: Barbaren – Wilde, Riesen, Krieger
ОглавлениеMit den Kimbern und Teutonen verbreitete sich erstmals der Mythos von den riesigen, wilden, furchterregenden und massenhaften Scharen an Raufbolden des europäischen Nordens. Der griechische Schriftsteller Plutarch ließ sie in der Lebensbeschreibung des Marius mit nacktem Oberkörper als Giganten durch das Etschtal nach Italien einfallen. Sie „stiegen durch Eis und tiefen Schnee auf die Berge, setzten sich oben auf ihre breiten Schilde, stießen sich ab und sausten an Steilschluchten und schroffen Felsen vorbei die Hänge hinunter. Als sie dann in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen und das Flussbett betrachtet hatten, begannen sie, (das Wasser) zu stauen; sie rissen wie die Giganten ringsum die Hügel auf, trugen Bäume mitsamt den Wurzeln und Felsbrocken sowie Erdmassen in den Fluss, ließen das (gestaute) Wasser dann ab und lenkten (mit der Strömung) gegen die Brückenpfeiler mächtige Stämme, die flussabwärts treibend durch ihre Stöße den Bau erschütterten.“
Selbst noch fünfhundert Jahre nach dem Zug der Kimbern und Teutonen schilderte der Mönch und Geschichtsschreiber Orosios einen „wilden“ Brauch dieses Volkes. Die Kimbern hätten nach der Schlacht gegen die Römer bei Arausio im Jahr 105 vor Christi Geburt sich der Lager und einer gewaltigen Beute bemächtigt „und zerstörten in einem neuen und ungewöhnlichen Fluch all das, was sie an sich genommen hatten; die Kleidung wurde zerrissen und weggeworfen, Gold und Silber in den Fluss geschleudert, die Panzer der Männer zerschlagen, der (Stirn- und Brust-) Schmuck der Pferde vernichtet, die Pferde selbst wurden in den Fluten ertränkt; den Menschen legte man Schlingen um den Hals und hängte sie an den Bäumen auf, so dass der Sieger nichts von der Beute, der Besiegte nichts von einem Mitgefühl spürte.“
Vor dem Einmarsch von Kimbern und Teutonen nach Italien schildert Plutarch, in welchen Unmengen sie daher kamen: „… jetzt erst wurde durch die Länge und Dauer des Zuges richtig deutlich, um welche Menschenmassen es sich handelte; sie sollen nämlich sechs Tage lang ununterbrochen am Lager des Marius vorbeimarschiert sein.“
Und die Furcht, dass die Kimbern in Italien einfallen und wie die Gallier 387/86 v. Chr. die Metropole am Tiber in Schutt und Asche legen könnten, „war fast noch größer als zu Zeiten Hannibals in den Punischen Kriegen“, schrieb der römische Historiker Eutrop. Waren schon die Gallier fürchterlich, so schienen Kimbern und Teutonen alle barbarischen Eigenschaften auf einmal und in vollem Maße zu vereinen. Man hielt sie für Räuber, Menschenfresser und Giganten.
Der Schock, den die Kimbern bei den Römern hinterlassen hatten, saß tief. Caesar zählte sie fünfzig Jahre nach Ende ihrer Wanderung nicht nur zu den Germanen. Indem er an die Angst und den Schrecken erinnerte, die sie verbreitet hatten, stilisierte er sie zum Prototyp einer latenten germanischen Dauerbedrohung. Als „furor teutonicus“, als teutonische Raserei, sollte die Angst vor ihrem Einfall noch über einhundert Jahre später in einem Theaterstück des römischen Dichters L. Annaeus Lucanus sprichwörtlich werden.
Vielleicht glaubte manch ein Römer wohl wirklich, dass die Kimbern in ihrer Heimat an der Nordsee mit Waffen gegen die Fluten ankämpften. Zumindest rügte der Universalgelehrte Poseidonios von Apameia seine zeitgenössischen Kollegen, die solch einen Unsinn behaupteten: „Lügen verbreitet auch derjenige Autor, der behauptet, dass die Kimbern mit Waffengewalt gegen die Fluten angingen.“ Sowieso bemängelte er die wahrheitstreue seiner Kollegen: „Über die Kimbern sind manche Berichte unzutreffend“, mahnte der Gelehrte.
Wirklich Genaues wussten die meisten Römer über Germanien nicht. So konnte auch folgende Passage eines unbekannten Autors in Caesars Bericht Eingang finden: „Daneben gibt es Tiere, die Elche genannt werden. Sie sehen ähnlich aus wie Ziegen und haben auch ein buntes Fell. Sie sind jedoch etwas größer als Ziegen, haben stumpfe Hörner und Beine ohne Gelenkknöchel. Sie legen sich zur Ruhe nicht nieder und können nicht wieder auf die Beine kommen oder sich wenigstens vom Boden erheben, wenn sie zufällig zu Fall kommen und stürzen. Sie benutzten daher Bäume als Ruhestätten, daran lehnen sie sich und können so, etwas zur Seite geneigt, ausruhen. Wenn Jäger aus ihren Spuren herausfinden, wohin sie sich gewöhnlich zur Ruhe zurückziehen, untergraben sie von den Wurzeln her alle Bäume an dieser Stelle oder schneiden sie nur soweit an, dass der Eindruck erhalten bleibt, als stünden die Bäume fest. Wenn sich die Tiere nach ihrer Gewohnheit daran lehnen, bringen sie mit ihrem Gewicht die ihres Halt beraubten Bäume zu Fall und stürzen zusammen mit ihnen um.“