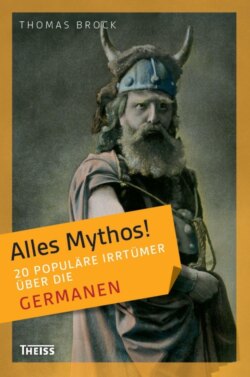Читать книгу Alles Mythos! 20 populäre Irrtümer über die Germanen - Thomas Brock - Страница 17
Der Schweigsame
ОглавлениеNur wenig ist über den Römer Cornelius Tacitus bekannt. Sein Name bedeutet der „Schweigsame“. Das, was man über diesen Mann weiß, entstammt wenigen Angaben aus seiner eigenen Feder und zwei Briefen an seinen Freund Plinius den Jüngeren. Wahrscheinlich zeugt ein marmorner Grabstein aus Rom von Tacitus’ Ableben. Zu lesen ist darauf lediglich „CITO“ (als Dativ von -citus) und von einer römischen Laufbahn. Der Rest der Inschrift ist abgebrochen – dort, wo das Todesdatum stand, ist eine Lücke. So bleiben selbst die Lebensdaten des Schweigsamen unvollständig. Was bleibt ist ein dürres Skelett an Fakten, dass nur noch durch die typischen Stationen der Karriereleiter eines römischen Staatsmannes etwas Fleisch erhält.
Tacitus wurde wahrscheinlich im Südosten Frankreichs oder im Norden Italiens um 55 n. Chr. geboren. Sein Vater war Ritter und Finanzier, wobei auch das nicht sicher ist. Er studierte Rhetorik und habe, wie Plinius der Jüngere schrieb, sich alsbald als Redner einen Namen gemacht. 77 n. Chr. ehelichte Tacitus die einzige Tochter des Iulius Agricola, eines renommierten Generals und Verwaltungsbeamten. Zwischen 79 und 81 n. Chr. wählte man den etwa 25-jährigen zum Quaestor, einem Senatsgehilfen, der unter anderem Steuern eintrieb. Damit wurde er zugleich Angehöriger des römischen Senats. Im Jahr 88, unter Kaiser Domitian, war er Praetor, bekleidete damit das zweithöchste senatorische Amt in Rom. Im Jahr 97 wurde er schließlich Konsul. 112–113 n. Chr. weilte er als römischer Statthalter in Asien, der neben Afrika prestigeträchtigsten Provinz Roms. Er starb wahrscheinlich um 120 n. Chr., nachdem Hadrian Kaiser wurde (117 n. Chr.).
Sein literarisches Debüt verfasste er im Jahr 98 n. Chr. Es ist eine Biografie seines Schwiegervaters Agricola. Bald darauf machte er sich an die „Germania“ und den „Dialog über die Redner“. Sein Hauptwerk bestand aus den „Historien“, einer römischen Geschichte der Jahre 69–96 und den „Annalen“, das die vorangehenden Jahre von 14 v. Chr. bis 68 n. Chr. umfasste, geschrieben wahrscheinlich nach 100 n. Chr. Viel mehr als diese wenigen gesicherten Informationen gibt es über den Mann, der für die Geschichte der Deutschen noch eine so bedeutende Rolle haben würde, nicht.
Lassen schon seine Lebensstationen einen wohl situierten, gutbürgerlichen Lebenswandel erahnen, mutet der Titel seiner dritten kleinen Schrift, der „Dialog über den Verfall der Beredsamkeit“ konservativ an, so offenbaren die Inhalte seiner großen Geschichtswerke, die Annalen und Historien, schließlich ein erzkonservatives, reaktionäres Weltbild. Für Tacitus hatte „das vergangene Zeitalter die wahren Maßstäbe verloren“, so der Altphilologe Manfred Fuhrmann im Nachwort zu seiner Übersetzung der Germania.
Germanien hat er nie gesehen. Ein Augenzeuge war Tacitus nicht. Römische Beamte und Kaufleute, die Germanien bereist hatten, werden Tacitus berichtet und Auskunft gegeben haben. Vor allem aber stammten seine Informationen aus den Federn von Caesar, Livius, Plinius dem Älteren und einigen anderen. Ebenso sind Stil, Aufbau und Gliederung aus verschiedensten Quellen inspiriert. An Caesar, der einzige, den Tacitus namentlich als Gewährsmann anführt, lehnt er sich schon mit dem Einleitungssatz der Germania an. Beschreibungen von Wohnweise, Kleidung, Haartracht, Waffen und anderem stehen ganz in einer antiken ethnographischen Tradition, die bis auf Herodot zurückreicht.
Tacitus wusste weder Neues noch Genaues zu vermelden. Seine Geographie und Ortsangaben sind ungenau. Die letzten großen Entdeckungen, wie die Flottenexpedition des Tiberius im Jahre 5 n. Chr., lagen fast einhundert Jahre zurück. Abgesehen davon, dass Domitian im Jahr 85 n. Chr. die Chatten besiegt hatte und anschließend die Wetterau der neuen Provinz Obergermanien zuschlug, fußt seine Schilderung im Wesentlichen auf den Zuständen in der ersten Hälfte des 1. Jahrhunderts. Aktuelle politische Ereignisse oder neue Entdeckungen rechtfertigten das Erscheinen einer Schrift über die Germanen um das Jahr 100 n. Chr. nicht.
Offenbar hatte Tacitus sich nicht einmal bemüht, Veränderungen, die eingetreten waren, seitdem die letzten Germanenberichte verfasst worden waren, zu überprüfen. So schreibt er etwa, die Hermunduren könnten jederzeit und „allerorten ohne Beaufsichtigung“ mit den Römern Handel treiben, doch das war spätestens seit etwa 90 n. Chr. nicht mehr der Fall.
Als wissenschaftliche Schrift zur Erlangung eines akademischen Grades wäre die Germania ein Plagiat, eine Kolportage und eine schlechte noch dazu. Doch ein solcher Maßstab würde der Absicht des Autors nicht gerecht werden. Tacitus Geschichtsschreibung diene nicht „der wissenschaftlichen Erkenntnis und noch weniger ästhetischem Genuß“, so der Philologe Manfred Fuhrmann. „Sie bindet sich zwar streng an die Wahrheit, und sie verwendet in reichem Maße künstlerische Mittel.“ Doch wollte Tacitus seinen Lesern den „Kodex der republikanischen Aristokratie“ einschärfen, der vor allem aus Leistung (virtus), Preis (gloria) und Freiheit (libertas) als Bedingungen für Ruhm und Ehre bestand. Seine künstlerischen Mittel und Intentionen verbauen uns heute den Zugang zum Verständnis seiner kleinen Schrift.
Tacitus kehrte die schlichten Sitten der Barbaren hervor, um seinen Landsleute ihre Dekadenz und den moralischen Verfall vor Augen zu führen: Einfach sind der Germanen Tauschhandel, Waffen, Kleidung und Haus. Sie sind nicht berechnend. Nur nach Freiheit streben sie. Häufig enden die Kapitel mit sarkastischen Pointen, die den römischen Lesern die gute alte Zeit vor Augen führen soll. Am Ende von Kapitel 8 heißt es, die Germanen verehren Frauen wie Veleda und Albruna als Seherinnen „aber nicht aus Unterwürfigkeit und als ob sie erst Göttinnen aus ihnen machen müssten“, – eine Anspielung darauf, dass Caligula, Nero und Domitian, Töchter, Gattinnen und Schwestern vergotten ließen. „Ihre Pferde zeichnet weder Schönheit noch Schnelligkeit aus“, spielt wiederum auf die römische Vorliebe für Reitspiele an. Denn die germanischen Pferde „werden auch nicht, wie bei uns, zu kunstvollen Wendungen abgerichtet.“ Das gesamte Werk durchziehen solche moralistischen Sarkasmen und Polemiken.
Doch bei aller Zuspitzung, Kontrastierung und Verherrlichung blieb der Autor im Kern um Wahrhaftigkeit bemüht. So lässt er auch die Laster der Germanen ebenso klar hervor scheinen wie ihre Tugenden. Er distanziert sich von den germanischen Exzessen, der Trunksucht und dem Würfelspiel, von Sklaventötungen und Menschenopfern. Manche Details, von denen Tacitus berichtet, konnten Archäologen bestätigen: Die Frisur der Sueben, die ihr „Haar seitwärts streichen und in einem Knoten hochbinden“, ist genauso überliefert wie Kultstätten in Mooren, die die Vorlage für den heiligen Hain der Semnonen geliefert haben könnten. Über die Lebens- und Siedlungsweise berichtet Tacitus etwa: „Ihre Dörfer legen sie nicht in unserer Weise an, dass die Gebäude verbunden sind und aneinander stoßen: Jeder umgibt sein Haus mit freiem Raum (…). Nicht einmal Bruchsteine oder Ziegel sind bei ihnen in Gebrauch; zu allem verwenden sie unbehauenes Holz, ohne auf ein gefälliges oder freundliches Aussehen zu achten. Einige Flächen bestreichen sie recht sorgfältig mit einer so blendend weißen Erde, dass es wie Bemalung und farbiges Linienwerk aussieht. Sie schachten auch oft im Erdboden Gruben aus und bedecken sie mit reichlich Dung, als Zuflucht für den Winter und als Fruchtspeicher.“ In diesem Satz stimmt vieles. Wie Archäologen nachweisen konnten, gab es sogar die von Tacitus beschriebenen bemalten Häuser. Nur selber dort gewesen, bei den Germanen, das ist der römische Schreiber nicht. Auch wenn der römische Geschichtsschreiber in seiner Germania viel Wahres berichtet, so bleibt sein Büchlein in erster Linie eine moralistische Agitationsschrift.