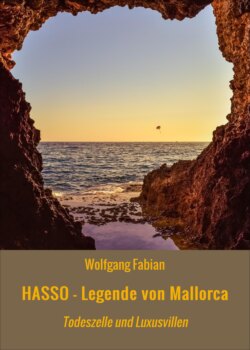Читать книгу HASSO - Legende von Mallorca - Wolfgang Fabian - Страница 4
2. Verrat und Folgen
ОглавлениеFrühherbst 1941.
Hasso, einige Klassenkameraden und Freundinnen übertrieben wieder einmal ihre Leidenschaft für den Jazz und ihre Ablehnung der Herrscherkultur der Nationalsozialisten. Wie immer kam ihnen nicht in den Sinn, sich zurückhalten zu müssen, sie waren ja unter sich. Doch was nützt die Überzeugung einer Gruppe scheinbar Gleichgesinnter, wenn sich in ihrem Kreis ein Verräter, ein Spitzel eingenistet hat. Natürlich war ihnen, den Anhängern des Jazz, bekannt, dass ihre Musik als abartig eingestuft war und das Hören strafrechtlich verfolgt wurde. Über vermeintliche Arten der Bestrafungen diskutierten sie gelegentlich. Das verbotene Hören von Jazzmusik nahmen sie unter sich nicht ernst, wohl aber in der Öffentlichkeit, wo ihre Gespräche rund um den Jazz absolut tabu waren. Ernster hingegen nahm diese angeblich volksschädlichen und zersetzenden Dinge ein Junge, der sich im Jazzkreis äußerlich loyal verhielt. Zu Hassos Klassenkameraden zählte er nicht. Er wohnte in einem anderen Stadtteil, wie auch einige der Mädchen im Kreise der Jazzliebhaber. Dieser junge Mensch nun, Anführer einer Hitler-Jugendgruppe, was dem Freundeskreis aber verborgen geblieben war, erwies sich als Spitzel, der das laute Treiben und hörbare Denken seiner Freunde seinem HJ-Vorgesetzten meldete. Dass auch er aktiv in dem Jazzkreis mitwirkte, war ein Mittel zum Zweck, gleichzusetzen mit den Spitzelaktivitäten des späteren SED-Regimes, überhaupt aller totalitärer Politsysteme.
Nun, der HJ-Führer reichte des jungen Verräters Erfahrungen weiter an die Gestapo (Geheime Staatspolizei), die die Angelegenheit auf ihre Weise erledigte. Welchem Treiben Hassos, eines Teils seiner Klassenkameraden, aber auch gleichaltriger Mädchen musste die Gestapo Einhalt gebieten? Die Jugendlichen − bis zu fünfzehn kamen oft zusammen – verdienten sich in ihrer Freizeit bei einer Hamburger Filmproduktion in der Blumenstraße, die überwiegend Werbefilme produzierte, ein gutes Taschengeld. Sie wurden als Komparsen eingesetzt und verrichteten zudem alle möglichen Hilfsdienste. Hassos Zuhause in Hamburg war dann manchmal verwaist. Sein Vater hatte inzwischen in Sachen Truppenbetreuung öfter im Dunstkreis der Wehrmachtsführung in Berlin zu tun, so kam es Hasso sehr gelegen, manchmal auch die Nächte in den Gebäuden und auf dem Werksgelände der Filmgesellschaft zu verbringen. Er schloss sich dann einem hauptamtlichen Wachmann an und half, vorgeschriebene Kontrollen vorzunehmen, wofür er zusätzlich zehn Mark pro Schicht kassierte. Einbrecher waren kaum zu befürchten, Hasso ängstigten vielmehr die zunehmenden nächtlichen Flugzeugalarme. Häufig heulten die Sirenen schon los, wenn die Dämmerung in die Nacht überging, und die jungen Leute sich noch in den Räumen der Filmstudios aufhielten. War das Sirenengeheul und die bedrohlichen Motorengeräusche über der Stadt verstummt – Bomben waren noch nicht gefallen –, dann legten die Jungs und Mädchen ihre Jazzplatten auf, deren Musik sie dann in wilden Tänzen auskosteten. Manchmal durften sie auch in den Filmvorführraum, wo ihnen die neuen Werbefilme, in denen sie mitwirkten, vorgeführt wurden. Da sahen sie sich dann hin und wieder im Verein mit Filmgrößen, wie Leni Riefenstahl oder Günter Lüders. Hasso, Wortführer der jungen Horde erfuhr in jener Zeit nicht nur die Bedrohung durch feindliche Flugzeuge, sondern auch seine erste große Liebe in Gestalt der reizenden Ursula Thies. Zu seinem Leidwesen erwiderte sie seine Liebe nicht sehr lange, denn gegen den Aufnahmeleiter, der sie geraume Zeit später sogar heiratete, kam er nicht an. Allerdings hatte die Ehe nicht lange Bestand. Denn nachdem irgendwann und irgendwie der amerikanische Filmschauspieler Robert Taylor sich nach dem Krieg in die Verbindung eingebracht hatte, war die Sache schnell erledigt. Dank dieses Mannes wurde Ursula Thies später in den USA eine gefragte Schauspielerin, galt von da an für viele Menschen sogar als die schönste Frau der Welt. Als Hasso davon erfuhr, war Deutschland längst dabei, aus Schutt und Asche wieder aufzusteigen.
Das Bespitzeln von Schul- und der Komparsenkameradschaft durch einen speziell beauftragten Hitlerjungen – heute, wie gesagt, erinnernd an die Machenschaften der Stasi in der DDR – war der Beginn von Hassos Abstieg, der schnell in einen freien Fall übergehen sollte. Die Gestapo war selbstverständlich nicht nur von dem permanenten Hören der Jazz-Musik informiert worden, sondern auch von dem Plan der Gymnasiasten, irgendwann heimlich nach Schweden entwischen zu wollen, um von dort aus gegen die Nazikultur zu agieren. Die Organisation der Reise in das skandinavische Land sollte einem Gruppenmitglied übertragen werden, dessen Vater Mitarbeiter im schwedischen Konsulat in Hamburg war. Dies alles hatte nun die Gestapo erfahren und schlug sofort zu. Bei der nächsten Zusammenkunft wurden Hasso und seine Freunde – die anwesenden Mädchen blieben verschont – verhaftet und in die Polizeileitstelle im Stadtteil Fuhlsbüttel gebracht, wo man sie eindringlichen Verhören unterzog ... den angeblichen Rädelsführer Hasso etwas schärfer. Seine Mitverhafteten setzte man nach sechs Tagen Eingesperrtsein wieder auf freien Fuß, ihn hingegen verurteilte die Gestapo in einem Schnellverfahren zu einer sechsmonatigen Haftstrafe, die er als Nazi- und Volksschädling im Konzentrationslager Neuengamme bei Hamburg zu verbüßen hatte. Warum bestrafte die Gestapo Hasso am schärfsten? Sie hielt ihn für einen kommenden gefährlichen Aufrührer und Systemgegner. Zwar verbot das Gesetz, Personen unter dem 21. Lebensjahr auf diese Weise zu bestrafen, bei dem erst siebzehnjährigen Hasso machte die Gestapo aber eine Ausnahme. Sie folgte ihren eigenen Gesetzen, sie hielt die Macht im Staat in ihren Händen. Was kümmerte sie die reguläre Justiz. Dennoch schwächte sie diesen Fall ab, indem sie Vater Eugen von der Verurteilung seines Sohnes unterrichtete und Hasso offiziell als Polizeihäftling bezeichnete. Polizeihäftlinge wurden einer sogenannten polizeimedizinischen Untersuchung unterzogen, was die Gestapo als das Sonderrecht eines Polizei- und niemals eines KZ-Häftlings deklarierte. So kurios es auch anzusehen ist: Hasso war theoretisch ein Polizei-, aber praktisch ein
KZ-Häftling. Der erboste Vater Eugen wandte sich an den Reichsjustizminister, der auch prompt bei der Gestapo intervenierte, was aber regelrecht im Sande verlief.
Wie es in einem Konzentrationslager zuging, muss hier nicht besonders hervorgehoben werden; aller Welt ist es bekannt. Im KZ Neuengamme gehörte Hasso der sogenannten Schwarzpunkt-Kompanie an, deren Angehörige in einer außerhalb des Lagers betriebenen Ziegelei eingesetzt wurden. Ein schwarzer runder Flicken auf den Sträflingsjacken war das Hoheitsabzeichen der Sträflinge. Der Marsch vom Lager zur Fabrik und zurück musste grundsätzlich im Laufschritt bewältigt werden. Arbeit, Misshandlungen, die Gewaltläufe und dazu die miserable Verpflegung überstanden hauptsächlich nur die psychisch Stabilsten. Manch anderer fiel in sich zusammen wie ein morsches Holzgestell und wurde dann, von aller Pein erlöst, aufgehoben und an einer bestimmten Stelle abgelegt. Nach Arbeitsende wurden die Toten dann abtransportiert. Ein Mangel an Arbeitskräften trat nie ein. An manchen Tagen war das KZ Endstation von Häftlingstransporten, entsandt von anderen, überlasteten Lagern. Es waren jeweils mehr als zweihundert Männer, oft dabei bereits von der schnell vorstoßenden Wehrmacht gefangene Sowjetsoldaten, deren Mission gleich nach Kriegsbeginn beendet war; im KZ traten sie eine neue an, in der Regel nun mit Sicherheit tödliche. Nach ihrer Ankunft sortierten sie SS-Aufseher die arbeitsfähigen Männer sofort aus, alle übrigen brachten sie so schnell wie möglich um.
(Im Konzentrationslager Neuengamme ermordeten die Nazis rund 55.000 Menschen.)
Hasso befreundete sich während seiner Lagerzeit mit zwei Leidensgenossen an. Wollten sie sich nahe sein, dann versuchten sie, beim Latrinengang beieinanderzusitzen, um sich dies und jenes zuflüstern zu können. In der Nähe sich aufhaltende Aufseher unterbanden das Geflüster der Gefangenen oft, denn das Reden war nicht nur während der Arbeit verboten, sondern auch im Latrinenbereich oder sonstwo. Hassos neue Bekannte waren unwesentlich älter als er. Ferdinand Georg hatte sich nach nazifeindlichen Äußerungen ins KZ gebracht; der zweite hieß Georg Mohr. Er fiel erst auf, als er nach Empfang seines Einberufungsbefehls in die Wehrmacht die staatliche Einladung missachtete und sich auf die Flucht begab. Vor der Grenze zur Schweiz fing ihn die deutsche Polizei ab. Georg Mohr war überzeugter Anhänger der islamischen Religion, was er immer zu verbergen wusste. Seine Gebete, in angenommener Richtung Mekka, verrichtete er, wenn er sich vollkommen sicher war, nicht beobachtet zu werden.
Beide Leidensbrüder Hassos, von etwas kleinerer Statur, aber dunkelhaarig wie er, sind hier vorerst erwähnt worden. Sie beiden, deren Schicksal bald ununterbrochen mit dem Hassos verbunden, werden als weitere Protagonisten Hasso auf seinem Weg begleiten und eine von ihrem Schicksal zugeordnete Rolle spielen.
Hasso hatte seine Strafe abgesessen, Georg Mohr und Ferdinand Georg mussten anscheinend bleiben. In seinen ihm ausgehändigten Zivilsachen fuhr Hasso in die väterliche Wohnung (den Schlüssel fand er bei Bekannten nebenan), die Vater Eugen, der in Berlin nach wie vor die Truppenbetreuung mitorganisierte, nicht aufgegeben hatte. Nun standen Vater und Sohn endlich wieder, wenn auch nur telefonisch, in Kontakt. Gleich zu Beginn seiner neuen Freiheit ließ Hasso zwei Fotos von sich anfertigen, eins sollte er für seinen Vater sein, eins behielt er für sich. Dass dieses Foto ihm später einmal das Leben retten, aber auch den Tod bringen könnte, war von ihm natürlich nicht zu ahnen.