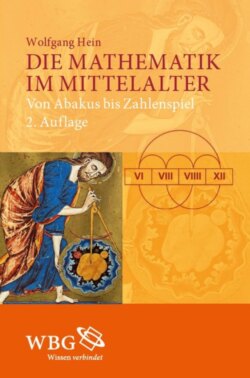Читать книгу Die Mathematik im Mittelalter - Wolfgang Hein - Страница 11
1.5 Maß, Zahl und Gewicht – Die Ordnung der Schöpfung
ОглавлениеDie pythagoreische Ordnung der irdischen und kosmischen Welt ist, wie wir gesehen haben, durch die Zahl als ihr konstitutives Element geprägt. Das Mittelalter hat dieses Prinzip schon früh aufgegriffen. So lesen wir bei Cassiodor im 6. Jahrhundert n. Chr. (vgl. 2.2), schon Pythagoras habe die Arithmetik als göttliche Wissenschaft gepriesen, da ohne sie nichts existieren könne.
„Ich glaube, dass dieses Urteil berechtigt ist, und ich leite meinen Glauben – wie viele andere Philosophen auch – von dem Prophetenwort ab, nachdem Gott alles nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet hat“ (Cassiodor, S. 180).
Cassiodor führt also nicht die griechische Philosophie als Zeuge an, sondern das Alte Testament; dort findet sich nämlich das genannte „Prophetenwort“ im Buch der Weisheit, Kap. 11, Vers 21, wo es heißt: „Denn alles hast du nach Maß, Zahl und Gewicht geordnet“. Schon lange vor Cassiodor wurde von den Kirchenvätern diese Stelle aus dem Weisheitsbuch als Beleg dafür gewertet, dass der Welt eine durch Zahl und Proportion bestimmte Ordnung zugrunde liegt, die den Menschen zu vernunftgemäßer Einsicht in den Bauplan der Schöpfung befähigt und ihm dadurch die Möglichkeit eröffnet, ein Abbild des göttlichen Bauplanes zu realisieren; die gotische Kathedrale als Spiegelbild der himmlischen Ordnung ist hierfür ein imposantes Beispiel.
Eine andere im Mittelalter verbreitete Folgerung aus diesem Ordoprinzip ist, dass es die Möglichkeit eröffnet, sichere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Gesetze der Zahlen sind ein Beleg dafür, dass es absolute Wahrheiten gibt, Wahrheiten, die unabhängig davon gelten, ob sie erkannt werden oder nicht. Dazu gehören die mathematischen Aussagen.
„Denn dass drei mal drei neun ist“ – so Augustinus in seinem Dialog „Gegen die Akademiker“ – „und ein Quadrat aus intelligiblen Zahlen, bleibt notwendigerweise wahr, auch wenn die ganze Menschheit schnarcht“ (Augustinus 1972, S. 122).
Die strengen und unveränderlichen Gesetze der Mathematik bilden Grundlage, Hilfsmittel und Modell zur Erlangung sicherer Einsichten mit den Mitteln der Vernunft. Im Dialog „Über die Ordnung“ formuliert Augustinus seine Überzeugung, die für das gesamte Mittelalter unumstößlich feststehen wird,
„[…] dass in der Vernunft das Beste und Mächtigste die Zahlen sind“; mehr noch: „dass Vernunft und Zahlen dasselbe sind“ (Ebd., S. 326f.).
Insofern sind mathematische Studien eine notwendige Vorbereitung zur Erlangung einer vernunftgemäßen Erkenntnis der Welt. Aber erst dadurch, dass sie den Weg ebnen zur Erkenntnis sowohl des Daseins als auch des Wesens Gottes, erhalten sie ihren endgültigen Platz in der mittelalterlichen Hierarchie des Wissens. Erreichen lässt sich dieses Ziel allerdings nur, wenn sich die Wissenschaft mit dem Glauben verbindet – credo ut intelligam – intellego ut credam – nur aus dem Zusammenwirken von Vernunft und Glaube erwächst wahre Erkenntnis.
Auch für die Ordnung einer sittlichen Lebensführung bleibt dies nicht ohne Konsequenzen. Die von Vitruv überlieferten „rechten“ Proportionen des menschlichen Körpers hat Leonardo da Vinci ins Bild gesetzt als homo quadratus, als den nach allen Seiten rechtschaffenen Menschen. Hier begegnen sich ästhetische und ethische Komponenten des mittelalterlichen Ordoprinzips.
Augustinus hat dem Mittelalter aufs Deutlichste den direkten Zusammenhang zwischen Sittlichkeit und der „Macht der Zahlen“ klargemacht:
„Schritt für Schritt führt sich nämlich die Seele zum Sittlichen und zum besten Leben empor, und zwar nicht durch den Glauben allein, sondern mit Hilfe der sicheren Vernunft. Hat sie mit aller Sorgfalt den Wert und die Macht der Zahlen begriffen, so wird sie es ganz würdelos und tief beklagenswert finden, […] sich unter der Herrschaft der Begierde mit dem schimpflichsten Lärm der Laster zu einem Missklang zu vereinen“ (Augustinus 1972, Über die Ordnung, S. 330; vgl. auch Lorenz S. 224).
Aus all dem wird deutlich, dass nicht die strenge Mathematik vergangener Zeiten Grundlage all dieser Spekulationen ist. Grundlage ist die „philosophische“ Mathematik in ihrer neuplatonischen und neupythagoreischen Ausprägung. Die Zahlen besitzen ein selbstständiges Sein, das den Sinnen unzugänglich ist, aber durch die Vernunft – und nur durch sie – erfasst werden kann. Die Zahlen werden gleichsam zu einem Spiegelbild der Vernunft, und daraus erhalten sie ihre ordnende Kraft.
Im Gegensatz zu den Mathematikern in der pythagoreischen Gemeinschaft, bei denen die fundamentale Bedeutung von Zahl und Proportion den Anstoß für wissenschaftliche Studien auf dem Gebiet der Arithmetik gegeben hat, haben die mittelalterlichen Gelehrten aus der vergleichbar exponierten Stellung der Arithmetik keine mathematischen Schlussfolgerungen gezogen. Stattdessen ist das Mittelalter den gleichen Weg gegangen, den auch die Anhänger der reinen Lehre des Pythagoras beschritten haben, nämlich die symbolhafte Ausdeutung der Zahl. Obwohl dies der immer wieder betonten Vernunft scheinbar zuwider läuft, sah der mittelalterliche Mensch darin keinerlei Widerspruch.