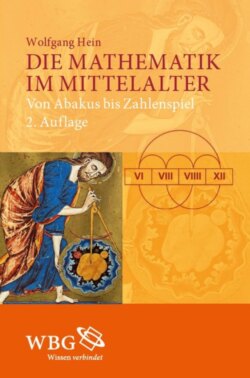Читать книгу Die Mathematik im Mittelalter - Wolfgang Hein - Страница 5
Vorwort
ОглавлениеDie alten Hochkulturen des 2. und 3. Jahrtausends v. Chr. haben sich ein beachtliches Maß an mathematischen Kenntnissen erarbeitet. Die Triebfedern dieser Entwicklung waren vor allem die praktischen Erfordernisse in Wirtschaft und Technik. Im alten Griechenland wurde die Mathematik zu einer Wissenschaft im heutigen Sinne entwickelt. Die Neuzeit hat – so jedenfalls ihr Credo – unmittelbar daran angeknüpft und weitergearbeitet.
Dazwischen liegt mehr als ein Jahrtausend, das mathematikhistorisch bis heute durchweg als eine vernachlässigbare Größe angesehen wird. Dieser Auffassung zufolge handelt es sich um eine Epoche, die sich für mathematisch-naturwissenschaftliche Fragestellungen nur ganz am Rande interessiert und die wenigen Ansätze einer Ideologie untergeordnet hat, die mit wissenschaftlichen Methoden unvereinbar ist.
Dies ist aber nur die halbe Wahrheit. Wir werden das hier nicht näher begründen, da die folgenden Kapitel das im Einzelnen belegen wollen; wir beschränken uns auf einige allgemeine Hinweise.
Abgesehen davon, dass man keiner geschichtlichen Epoche, besonders aber nicht dem Mittelalter, gerecht werden kann, wenn man sie durch die Brille heutiger Begrifflichkeit betrachtet, muss man feststellen, dass es schon seit dem 2. Jahrhundert v. Chr. keine nennenswerte Weiterentwicklung der Mathematik der vorangehenden Jahrhunderte gegeben hat. Selbst in Alexandria, das sich im 3. Jahrhundert v. Chr. zum Zentrum der Wissenschaften entwickelt hatte, verflachte die Mathematik zusehends und reduzierte sich zunehmend auf Zusammenfassungen und Kommentare des antiken Erbes. Neupythagoreismus und Neuplatonismus erlebten eine Blüte, und die Mathematik interessierte nur insoweit, als sie zum Verständnis der philosophischen Werke, insbesondere derjenigen Platons, für erforderlich gehalten wurde. Die Römer, die noch einen ungehinderten Zugriff auf die klassischen Werke der griechischen Wissenschaft und Philosophie hatten und – nach anfänglichem Zögern – griechische Kultur auf verschiedenen Gebieten gepflegt haben, konnten sich nicht für die griechische Wissenschaft und insbesondere für die abstrakte Mathematik erwärmen. Immerhin haben sie spärliche Reste in Kompendien und berufskundlichen Handbüchern zusammengestellt, nicht selten unverstanden und daher anfällig für Fehler. Die großartigen technischen Leistungen wurden fast gänzlich ohne Mathematik ersonnen und ausgeführt.
Niemand, der mit der geschichtlichen Entwicklung einigermaßen vertraut ist, wird nun erwarten, dass in den ersten Jahrhunderten des Frühmittelalters auf dieser Basis eine eigenständige Produktion wissenschaftlicher Erkenntnisse hätte wachsen können. Der Untergang des Weströmischen Reiches, seiner Städte und Bildungseinrichtungen, kurz: die Barbarisierung durch die Völkerwanderungen, war kein geeigneter Humus für das Gedeihen wissenschaftlicher Studien. Dennoch hat es eine nicht geringe Anzahl von Versuchen gegeben, in die Rudimente des überlieferten Wissens einzudringen und zu neuen Einsichten zu gelangen.
Die Väter des frühen Christentums haben um die Frage gerungen, wie weit griechische Philosophie und Wissenschaft in die christliche Lehre integriert werden könnten oder auch müssten. Dabei haben sich schroff ablehnende Meinungen herausgebildet, die zum Ziel hatten, jedwede Annäherung „zwischen Athen und Jerusalem“, zwischen heidnischer Wissenschaft und christlicher Heilslehre von vornherein zu verhindern. Das hat dem frühen Christentum den pauschalen Vorwurf eingebracht, die Überlieferung und Weiterentwicklung der antiken Wissenschaft unterbrochen oder zumindest nachhaltig behindert zu haben. Aber es gab auch Stellungnahmen, die die Pflege der antiken Philosophie und Wissenschaft und ihre Harmonisierung mit der christlichen Lehre für zwingend, ja geradezu heilsnotwendig erklärten. Obwohl die ablehnenden Stimmen nie ganz verstummen sollten, hat sich diese Einstellung am Ende der Spätantike doch im Wesentlichen durchgesetzt. In den Klöstern, die sich im Frühmittelalter zu den maßgeblichen Kulturträgern entwickelten, wurden die noch zugänglichen spärlichen Reste der aus der Spätantike überkommenen Quellen gesammelt, in Enzyklopädien zusammengestellt, abgeschrieben und so erhalten; mit Glossen und Kommentaren versehen wurden sie zur Grundlage des sprachlichen und mathematischen Unterrichts.
Dadurch wurde der Boden für den Ansturm auf die Bibliotheken der Muslime bereitet, der während der Rückeroberung der iberischen Halbinsel durch die christlichen Herrscher in Gang kam, und der schon nach einer vergleichsweise kurzen Phase der Rezeption beträchtliche Fortschritte sowohl in der Mathematik als auch in den Naturwissenschaften brachte.
Man kann daraus wohl schließen, dass die Mathematik ihre Faszination im Mittelalter nie – auch nicht in den vergleichsweise „dunklen“ Jahrhunderten des Frühmittelalters – verloren hat; gerade in dieser schwierigen Phase der kulturellen Entwicklung Westeuropas hat die Mathematik wie in kaum einer anderen ihre Vitalität unter Beweis gestellt.
Das vorliegende Buch hat das Ziel, in Form einer zusammenfassenden Darstellung einer breiten historisch und mathematisch interessierten Leserschaft einen lebendigen Eindruck der mathematischen Aktivitäten dieser „Zwischenzeit“ zu vermitteln. Dabei kann es selbstverständlich nicht um Vollständigkeit gehen, sondern nur um einen möglichst repräsentativen Überblick.
Die wichtigste inhaltliche Einschränkung ist die auf das lateinische Mittelalter. Kurze Zusammenfassungen des antike Erbes (Kapitel 1) und der Mathematik im islamischen Kulturkreis (Abschnitt 5.1) wurden allerdings als unverzichtbar für eine angemessene Einordnung der übrigen Teile angesehen. Dabei folgt der Text nicht genau dem zeitlichen Verlauf, was nur zu Wiederholungen gleicher oder ähnlicher Themenkreise, die im Mittelalter besonders zahlreich anzutreffen sind, führen würde; stattdessen ist das Buch vorrangig nach Themenbereichen geordnet und erst in zweiter Linie nach dem zeitlichen Verlauf. Hierbei hat der Autor in besonderem Maße von dem reichhaltigen Werk Menso Folkerts profitiert, an dem keine Geschichte der mittelalterlichen Mathematik vorbeigehen kann.
Das Buch ist also ein Beitrag zur Mathematikgeschichte, freilich in einem weit gefassten Sinne. Es will auch da, wo keine eigene mathematische Produktivität festzustellen ist, dem Einfluss der Mathematik (oder auch nur mathematischer Begriffe) auf das Denken (und Handeln) gelehrter Zeitgenossen nachspüren. Da im Mittelalter eine Ausdifferenzierung und Verselbstständigung der verschiedenen Wissenszweige nicht stattgefunden hat und auch nicht angestrebt wurde, wird Wert darauf gelegt, Zusammenhänge mathematischer Entwicklungen mit anderen kulturellen Bereichen herauszuarbeiten. Insofern möchte dieses Buch auch einen Beitrag zur Kulturgeschichte des Mittelalters über die Geschichte der Mathematik hinaus leisten.
Siegen, im November 2009
Wolfgang Hein