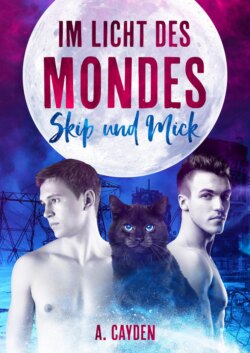Читать книгу Im Licht des Mondes - A. Cayden - Страница 11
Kapitel 7
ОглавлениеMick:
Müde gehe ich die Gänge mit dem spärlichen Angebot des Supermarktes durch und erledige meinen längst überfälligen Wocheneinkauf. Länger kann ich ihn nicht mehr aufschieben, denn ich hatte wirklich nichts mehr Essbares im Haus. Es ist nicht meine Art, Dinge hinauszuzögern, doch jedes Mal, wenn ich von meiner Arbeit hatte pünktlich gehen wollen, war irgendetwas dazwischengekommen. Fast so, als hätte das Schicksal selbst etwas dagegen. Auch heute war das der Fall gewesen, denn wir hatten in den letzten Stunden einen ganz wichtigen Kundenauftrag reingekriegt. Unser Chef hatte darauf bestanden, dass wir diesen heute noch erledigen, um mehr Geld aus der Reparatur gewinnen zu können.
Es ist unheimlich still im Laden, da so gut wie kein anderer Kunde hier ist. Leise seufze ich auf, als ich vor der leeren Kiste der Backwaren stehe. Hierfür bin ich wohl zu spät. Dies ist einer der Gründe, warum ich um diese Uhrzeit nicht gern meine Besorgungen erledige. Das, was man möchte, ist meist ausverkauft und ich bin müde und erschöpft vom langen Arbeitstag, sodass ich die Hälfte von dem, was ich brauche, ohnehin vergesse.
Etwas neben der Spur suche ich eine Alternative für das nicht vorhandene Brot zum Frühstück und entscheide mich schließlich für Cornflakes. Zum Glück kann ich noch zwei Päckchen Milch ergattern und ein paar Dosen mit Fertigessen, das nur aufgewärmt werden muss. Das sollte die nächsten Tage reichen. Erleichtert, den lästigen Einkauf hinter mich gebracht zu haben, bewege ich mich schleppend Richtung Kasse. Die letzten Nächte konnte ich kaum schlafen und dieser eine Albtraum vor zwei Tagen und die derzeitigen Überstunden nagen heftig an mir. Ich bräuchte dringend ein bisschen Urlaub, doch bei der momentanen Auftragslage wird das schwierig werden.
Ich kneife leicht die Augen zusammen, denn das defekte und ständig flackernde Licht bereitet mir Kopfschmerzen. Eilig schlurfe ich weiter zur Kasse. Aus den Augenwinkeln registriere ich einen kleinen Jungen im Alter von fünf Jahren. Er sieht abgemagert und blass aus wie ein Gespenst. Mit zittrigen Fingern lässt er etwas Käse und Wurst in seiner ausgebeulten und mit Flicken übersäten, braunen Jacke verschwinden. Er scheint mich nicht zu registrieren, bis er sich mit wackeligen Beinen etwas zu ruckartig umdreht und direkt gegen mich läuft. Seine hellbraunen Augen weiten sich angstvoll und sein Mund öffnet sich entsetzt. Er scheint vor Furcht gelähmt, unfähig auch nur eine Bewegung zu tätigen oder einen Laut von sich zu geben. Wie eine Maus in der Mausefalle kauert er auf dem Gang und starrt mich an, als wäre ich der große, böse Kater, der ihn bei der nächsten Regung tötet. Genauso erstarrt wie der ertappte Dieb verharre auch ich, bis ich die Situation richtig begreifen kann.
„Gibt es da hinten ein Problem?“, die alte Verkäuferin des überschaubaren Ladens kommt mit holprigen Schritten auf uns zu gewatschelt und blickt misstrauisch von mir zu dem Blondschopf, der noch blasser wird, als er ohnehin schon ist. Die Zeit scheint in diesem Moment stillzustehen und mein Gewissen will mich innerlich zerreißen. Zögernd werfe ich noch einmal einen Blick auf den bibbernden Jungen, der kurz vor einer Ohnmacht steht. Die alte Frau mustert den Knirps von oben bis unten, welcher immer kleiner wird. Ihre Augen formen sich zu schmalen Schlitzen und blitzen argwöhnisch auf.
„Alles okay, danke Ihnen“, gebe ich in ruhigem Tonfall zurück und lächle die Verkäuferin beschwichtigend an. Skeptisch betrachtet sie mich. Es kommt mir wie eine Ewigkeit vor, bis sie endlich nickt und wieder nach vorne an ihre Kasse schlendert.
„Beeilt euch aber – ich möchte den Laden für heute dichtmachen!“, gibt sie murrend von sich, dann ist sie hinter dem nächsten Regal verschwunden. Ich atme beruhigt aus, dann lege ich dem mageren Jungen besänftigend eine Hand auf die Schulter und merke, dass er noch dürrer ist, als er aussieht. Ein leichter Schmerz durchbohrt meine Brust. Ich bemühe mich ihn so freundlich wie möglich anzulächeln.
„Hey Kleiner. Ist schon in Ordnung. Was hast du denn alles eingesteckt? Gib es mir, okay? Keine Sorge, ich bezahle das für dich.“
Langsam richtet sich der fremde Junge auf und öffnet zögernd seine Jacke. Mit immer noch zitternden Fingern reicht er mir seine Beute: eine Stange Salami, etwas Gouda und zwei Äpfel. Ich sehe kurz in meinem Gelbeutel nach, doch mein Geld sollte reichen. Für die nächsten paar Tage heißt es eben etwas kürzertreten. Behutsam nehme ich ihm die Lebensmittel ab und schiebe ihn sacht vor zur Kasse. Der Junge fühlt sich sichtlich unwohl, er kann die Situation wohl noch nicht einschätzen. Die alte Frau rechnet mit einem handlichen Taschenrechner flink die Beträge zusammen und ich zahle eilig die Summe, nehme die Einkäufe und laufe schnell mit dem Kind nach draußen. Dort reiche ich ihm wie versprochen seine Lebensmittel. Seine Augen strahlen, als er bemerkt, dass er das Essen auch wirklich bekommt und er scheint es kaum fassen zu können. Unwillkürlich muss ich schmunzeln.
„Wo wohnst du denn? Soll ich dich heimbringen?“, frage ich den Jungen, der die Vorräte hastig in seiner alten Jacke verstaut. Etwas zu hurtig schüttelt er den Kopf, wobei sein wirres Haar wild durcheinanderwirbelt. Unsicher bleibe ich stehen und betrachte ihn. Es ist mir nicht recht, dass ein Kind um diese Uhrzeit allein durch die Straßen zieht, noch dazu wo sein Gesundheitszustand nicht gerade der beste zu sein scheint.
„Du hast doch ein Zuhause, nicht?“, hake ich sicherheitshalber nach, doch als ich nach seiner Hand greifen möchte, springt er geschickt zurück. Überfordert mit der Situation gehe ich in die Hocke und versuche, ruhig auf ihn einzureden und seine Furcht vor mir zu nehmen.
„Keine Angst. Ich tu dir nichts. Ich möchte nur nicht, dass dir etwas passiert – die Straßen sind nachts gefährlich, weißt du? Es wäre also kein Problem für mich, dich nach Hause zu bringen … du hast doch ein Zuhause oder etwa nicht?“
Der Junge sieht mir tief in die Augen und erinnert mich abermals an eine kleine Maus, die unvorsichtig in eine Falle getappt ist und nicht weiß, wie sie dort wieder herauskommen soll. Wie es aussieht hat er ziemlich Angst vor mir. Das war nicht meine Absicht. Nachdenklich kratze ich mich am Nacken, unschlüssig, wie ich als Nächstes vorgehen soll. Ich kann ihn unmöglich hier allein zurücklassen. Der Kleine nickt missmutig und zeigt nach rechts, dieselbe Richtung, in der meine Wohnung liegt. Langsam richte ich mich auf und biete ihm nochmals meine Hand an, die er allerdings nicht ergreift. Schweigend trotten wir für fünf Minuten nebeneinander her, unfähig ein Gespräch anzufangen. Dann versuche ich es erneut: „Wie heißt du eigentlich?“
„Niklas“, antwortet der Junge mit piepsiger Stimme und seine Augen klappern ruhelos die Gegend ab.
„Ich heiße Mick. Möchtest du mir nun verraten, wo du wohnst?“
Der schmächtige Knirps schüttelt leicht den Kopf, immer noch die Umgebung absuchend. Ich runzle leicht die Stirn. Irgendwie ist die Sache schwieriger als angenommen.
„Wie soll ich aber dann wissen, wo wir hinmüssen?“, hake ich geduldig nach. In diesem Moment bleibt der Kleine auf einmal stehen und richtet seinen verklärten Blick langsam auf mich. Irritiert verharre ich auf der Stelle und sehe ihn wartend an.
„Gar nicht!“, schreit er mir mit halb erstickter Stimme entgegen und noch ehe ich reagieren kann, tritt er mir gegen das Schienbein und rennt fluchtartig in die entgegengesetzte Richtung zurück. Ein ruckartiger Schmerz durchfährt mein Bein und hallt unangenehm nach. So viel Kraft habe ich ihm nicht zugetraut. Es wäre ein leichtes für mich, ihn trotz seines kleinen Vorsprungs wieder einzuholen, doch ich rühre mich keinen Millimeter und lasse ihn ziehen. Vorwürfe kann ich ihm keine machen, denn wer weiß schon, was er alles erlebt hat. Ich hoffe nur, dass er ein sicheres Dach über den Kopf hat.
***
Erleichtert, endlich daheim zu sein, lege ich die Tasche mit den eingekauften Lebensmitteln auf den Tisch und werfe meine Jeansjacke über den klapprigen Küchenstuhl, der das Gewicht gerade noch so auszuhalten scheint. Ein Blick auf meine Uhr verrät mir, dass es schon nach 22 Uhr ist. Ich strecke meine müden Glieder, pfriemle einen kleinen Topf aus dem Schrank und schütte den Inhalt einer eingedellten Dose Ravioli hinein. Auf mittlerer Hitze lasse ich das Ganze erwärmen und verschwinde schnell in mein kleines Badezimmer, um mir eine kurze Dusche zu gönnen.
Das kalte Wasser prickelt angenehm auf meiner Haut und ich schließe für einen Moment die Augen, um meine Gedanken zu ordnen. Heute war wirklich ein merkwürdiger Tag gewesen. Irgendwie hatte ich das Gefühl, dass mir alles entgleitet und ich bin mir nicht mal sicher, warum und was genau. Bilde ich mir das ein oder wird es tatsächlich immer schlimmer? Wieder sehe ich den kleinen Jungen vor mir: abgemagert, ängstlich und mit großen braunen Augen, die ziellos umherschweifen. In mir kommt eine Vermutung auf, dass er gar kein eigenes Zuhause hat …
Hätte ich anders reagieren sollen? Ihn festhalten und zwingen sollen, mit mir zu kommen? Habe ich falsch gehandelt? Meine Gedanken wirbeln durcheinander durch meinen Kopf und ich kann mich nur noch schwer konzentrieren. Was hilft es jetzt noch darüber nachzudenken? Ich muss die ganze Sache abhaken. Im Grunde genommen hätte ich eh nicht viel mehr tun können, oder? Doch warum fühle ich mich dann so deprimiert und schuldig?
Ich steige aus der Dusche und versuche, alle Gedanken zu verdrängen. Mit knurrendem Magen gehe ich in meine schmale Küche, wo die Ravioli verlockend vor sich hin blubbern. Ich schalte den Herd aus und gehe mit vollem Teller in das Wohnzimmer zum Essen, denn die Couch ist um einiges gemütlicher als in der Küche zu stehen. Vorsichtig stelle ich mein Geschirr ab und lasse mich auf die weiche Polstergarnitur sinken, als mein Blick auf das Bild meiner lächelnden Eltern fällt. Ein dicker Kloß macht sich in meiner Kehle breit und das Schlucken fällt mir schwer. Minutenlang schaue ich die Fotografie an, während sich ein leichter Tränenfilm in meinen Augen bildet. Mir wird flau im Magen und ein leichtes Schwindelgefühl breitet sich in mir aus. Mir ist, als würde der Boden unter meinen Füßen weggezogen.
„Es tut mir leid“, murmle ich leise vor mich hin und drehe mit zittrigen Händen das Bild um, „doch heute kann ich das nicht, sorry.“
***
Ich liege rücklings auf dem Balkon und betrachte die hellfunkelnden Sterne am Himmelszelt, die mit dem Mond um die Wette leuchten. Einfach faszinierend, wie gut sie miteinander harmonieren, jeder auf seine eigene Art und Weise. Ich schließe kurz meine müden Augen, spüre die kühle Nachtluft auf meiner Haut und bekomme eine leichte Gänsehaut. Etwas entfernt höre ich eine Gruppe Jugendlicher rumgrölen, die nicht mehr ganz nüchtern zu sein scheinen. Irgendwo schreit ein Baby und die letzte Straßenbahn gibt ein warnendes Piepen vor der Abfahrt von sich. Wie vertraut doch alles ist. Ich fühle, wie der Stress der letzten Tage und Nächte von mir abfällt und dem Gefühl der Geborgenheit weicht. Langsam öffne ich wieder meine Augen und blicke fasziniert in den strahlenden Nachthimmel, wartend, als könnte er mir jede Sekunde eine neue Geschichte erzählen. Es ist bewundernswert, wie mich der bloße Anblick der prächtigen Himmelskörper ständig inspiriert. Ich bin ihnen dankbar dafür, wenngleich auch manchmal Gefühle beim Betrachten in mir hochkommen, die ich lieber vergessen und nicht spüren würde. Denn nicht allzu selten wird mir beim Beobachten des Himmels bewusst, wie klein und einsam ich bin – irgendwie verloren. Nachdenklich greife ich zu meinem Block und Kugelschreiber, die ich mir auf die Seite gelegt habe und lasse meinen Gedanken freien Lauf.
Späte Einsicht
Ich renne durch die Straßen und suche dich
Doch dichter Nebel trübt meine Sicht
Hüllt mich ein, nimmt mich gefangen,
wohin bist du bloß gegangen?
Ich bin mir sicher, du wartest dort auf mich.
Halte durch, vertraue drauf und verlass mich nicht.
Ich verspreche dir, mein Bestes zu geben
Denn du bist mein Atem, mein Licht, mein Leben.
Ohne dich erscheint mir mein Sein so schwer,
und ohne dich sein, kann ich jetzt nicht mehr.
Du kennst mich besser als ich mich selbst
Du bist die Person, die mich aufrechthält
Gabst mir Hoffnung, gabst mir Licht
Tränen verschmieren mir die Sicht.
Wie konnte es nur soweit kommen?
Ich war ein Idiot, hab alles genommen.
Zu sicher habe ich mich gefühlt
Und mit deinen Gefühlen gespielt.
Alles auf eine Karte gesetzt
Und dich damit zutiefst verletzt.
Wenn ich dich finde, lass ich dich nie mehr los
Wenn ich dich finde, stell ich dich nie mehr bloß
Werde alles tun, damit du mir verzeihst
Und für immer bei mir bleibst.
Kälte durchdringt meine müden Glieder
Entkräftet lege ich mich nieder.
Meine Gedanken drehen sich jetzt nur um dich,
auch als alles um mich herum mit einem Schlag erlischt …
PAPATACK!
Erschrocken zucke ich zusammen, als ich das fremde Geräusch direkt hinter mir am vibrierenden Geländer vernehme und mich unsanft aus meinen Gedanken reißt. Kullernd rollt mein Kugelschreiber, den ich fallen gelassen habe, von mir weg und direkt vor vier schwarze Samtpfoten. Meine Augen weiten sich überrascht und ich blicke auf, direkt in zwei schmale Katzenaugen, die mich durchdringend und erwartungsvoll mustern. Mein Herz scheint vor Freude einen Sprung zu machen und ich bin im ersten Moment unfähig, eine Bewegung zu tätigen.
„Du bist tatsächlich zurückgekommen“, murmle ich und ein berauschendes Prickeln durchdringt meinen Körper. Beherzt springe ich auf.
„Du hast bestimmt Durst und Hunger – ich hole dir sofort was!“
Ich bin mir der Albernheit bewusst, doch zu groß ist das aufkeimende Glücksgefühl der zerschlagenen Einsamkeit, das sich wärmend in meinen vor Kälte steifen Körper ausbreitet. Eilig haste ich in meine Wohnung, beflügelt von kindischer Freude über meinen nächtlichen, tierischen Besuch.