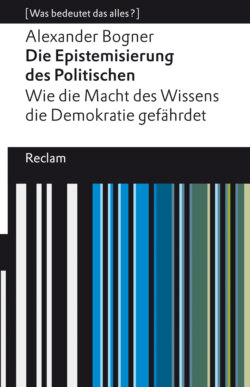Читать книгу Die Epistemisierung des Politischen. Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet - Alexander Bogner - Страница 11
Die Impfkontroverse
ОглавлениеEin anderes Beispiel: Impfen. Im Zuge der aktuellen Debatte um eine Impfpflicht in Deutschland kochten erneut die Emotionen hoch. Absehbar ist ein erbitterter Stellungskampf, in dem die alten Argumente erneut mit aller Vehemenz verfochten werden. Die Impfbefürworter weisen auf den Schutz der Allgemeinheit vor gefährlichen Infektionskrankheiten und hier insbesondere auf die Gefährlichkeit der Masernerkrankung für Kinder hin. Die Impfgegner hingegen verweisen auf Nebenwirkungen, etwa auf die Gefahren von Metallzusatzstoffen in Impfungen oder – der Klassiker – auf das Risiko, an Autismus zu erkranken oder gar zu sterben. Im Hinblick auf die hartnäckige Impfkritik lautet die erste Empfehlung der Experten, falsche Informationen zu bekämpfen, Aufklärung zu betreiben. Denn das Vertrauen in die experten- und evidenzbasierte Impfpolitik wird durch widersprüchliche Darstellungen im Internet, durch Fehlinformationen oder gezielte Manipulationen und Verschwörungstheorien unterminiert. Gerüchte und Ängste verbreiten sich im Netz ungehindert und wachsen teilweise zu einer regelrechten Protestwelle an. Die Digitalisierung erscheint auf diese Weise schon fast als die wahre Seuche, weil sie die Verbreitung gezielter Falschinformationen extrem beschleunigt. Empfohlen werden daher ein Monitoring der sozialen Medien sowie die regelmäßige Erhebung von Einstellungen in der Bevölkerung durch standardisierte Befragungen (die Forschung kennt sogar einen Impf-Vertrauensindex, kurz VCI).
Eine andere Empfehlung lautet, dass man das Vertrauen in die Experten stärken kann, indem man zweifelnde Eltern auf den weitreichenden Expertenkonsens hinweist. Über 90 Prozent aller Ärzte sind übereinstimmend der Meinung, dass Kinder alle vorgesehenen Impfungen erhalten sollten. Es besteht also ein starker Konsens darüber, dass das Impfen sicher und medizinisch absolut sinnvoll ist.16 Allerdings werden die evidenzbasierten Aussagen der Experten von besorgten Laien durch anekdotische Evidenz in Zweifel gezogen – und zwar immer und immer wieder von neuem. Und solange die Experten nicht realisieren, dass der Streit auf der Inkommensurabilität der Weltbilder basiert, wird sich daran nicht viel ändern. Auf der einen Seite: das wissenschaftliche Weltbild, in dem die Beherrschung aller Dinge über Standardisierung und Berechenbarkeit hergestellt wird und Prognosen auf der Logik der großen Zahl beruhen. Auf der anderen Seite: das unbedingte Bestehen auf den Einzelfall und – eng damit verbunden – die Kritik an der Unterordnungs- bzw. Subsumtionslogik epidemiologischer Statistiken.17 Besorgte Eltern interessieren sich aber nicht primär für die Impfwirksamkeit oder die generelle Sicherheit von Impfungen, sondern wollen einfach nur wissen: Welche Risiken bestehen für mein Kind?
Das heißt, die Einschätzungen der Experten sind für die Impfgegner gar nicht unbedingt unwahr, sondern eher irrelevant. Ihre massendatengestützten Aussagen beziehen sich nämlich nicht wirklich auf die Bedenken der Leute. Gesetzt den Fall, dass 90 Prozent aller Experten die aktuelle Impfpolitik unterstützen, kann die Besorgnis um das eigene Kind leicht zu der Vermutung verleiten, dass sich unter den restlichen zehn Prozent geniale Außenseiter befinden, die einfach irgendwie mehr wissen und darum vom Establishment an den Rand gedrängt werden. Das paradigmatische Beispiel liefert der britische Kinderarzt Andrew Wakefield, der mit seiner Lancet-Publikation aus dem Jahr 1998 die Debatte um den Zusammenhang von Impfung und Autismus so richtig in Schwung gebracht hat. Zwar wurde die Publikation wegen schwerer Methodenfehler (erst) nach zwölf Jahren zurückgezogen und Wakefield die ärztliche Zulassung aberkannt; dennoch ist er als Impfgegner hochaktiv und einflussreich geblieben. Viele Experten glauben, dass seine Aktivitäten zum Ausbruch der Masernwelle 2017 in Minnesota beigetragen haben.
In diesem Stellungskrieg gehen die wirklich wichtigen Fragen unter. Denn die Frage, ob »manche Impfung tatsächlich notwendig ist, debattieren selbst Fachleute, die eindeutig keine Impfgegner sind«.18 Impfen ist durchaus nicht ohne Risiko: So kann es bei der Impfung gegen Windpocken zu sogenannten Durchbruchsinfektionen kommen (die Impfung provoziert die Erkrankung). Auch Grippeimpfungen sind kein Allheilmittel, denn am wenigsten wirksam ist sie »bei Älteren und Abwehrschwachen, sprich: denjenigen, die die Grippeimpfung am nötigsten hätten«.19 Es besteht also durchaus Diskussionsbedarf, etwa über die Unzulänglichkeiten einzelner Impfungen und manche Unsicherheiten des medizinischen Wissens. Doch viele Fachleute trauen sich an diese Fragen öffentlich gar nicht heran, um nicht sofort als Mitstreiter von den Impfgegnern vereinnahmt zu werden. Die real existierenden Vorteile, aber auch die Defizite der aktuellen Impfpolitik kommen auf diese Weise erst gar nicht auf den Tisch. Stattdessen richtet man es sich in den alten Stellungen ein und führt einen Wissenskonflikt (Wie sicher ist das Impfen?). Und dieser Streit wird so lange nicht beendet sein, wie man nicht realisiert, dass es sich eigentlich um einen Streit zwischen Weltbildern handelt.