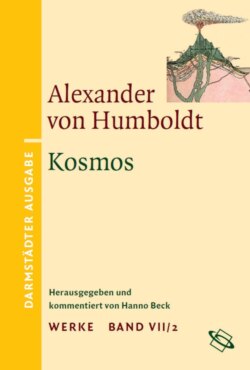Читать книгу Werke - Alexander Humboldt - Страница 10
I Naturbeschreibung – Naturgefühl nach Verschiedenheit der Zeiten und der Völkerstämme
ОглавлениеEs ist oftmals ausgesprochen worden, daß die Freude an der Natur, wenn auch dem Altertum nicht fremd, doch in ihm als Ausdruck des Gefühls sparsamer und minder lebhaft gewesen sei denn in der neueren Zeit. „Wenn man sich “, sagt Schiller4 in seinen Betrachtungen über die naive und sentimentalische Dichtung, „der schönen Natur erinnert, welche die alten Griechen umgab, wenn man nachdenkt, wie vertraut dieses Volk unter seinem glücklichen Himmel mit der freien Natur leben konnte, wie sehr viel näher seine Vorstellungsart, seine Empfindungsweise, seine Sitten der einfältigen Natur lagen und welch ein treuer Abdruck derselben seine Dichterwerke sind, so muß die Bemerkung befremden, daß man so wenig Spuren von dem sentimentalischen Interesse, mit welchem wir Neueren an Naturszenen und Naturcharakteren hängen können, bei denselben antrifft. Der Grieche ist zwar im höchsten Grade genau, treu, umständlich in Beschreibung derselben, aber mit nicht mehrerem Herzensanteil, als er es in der Beschreibung eines Gewandes, eines Schildes, einer Rüstung ist. Die Natur scheint mehr seinen Verstand als sein moralisches Gefühl zu interessieren; er hängt nicht mit Innigkeit und süßer Wehmut an derselben wie die Neueren.“ So viel Wahres und Vortreffliches auch im einzelnen in diesen Äußerungen liegt, so können sie doch keineswegs auf das ganze Altertum ausgedehnt werden. Auch dürfen wir es wohl eine beschränkte Ansicht nennen, unter dem Altertum, wenn dasselbe der neueren Zeit entgegengesetzt werden soll, immer nur ausschließlich die hellenische und römische Welt zu verstehen. Tiefes Naturgefühl spricht sich in den ältesten Dichtungen der Hebräer und Inder aus, also bei Volksstämmen sehr verschiedener, semitischer und indogermanischer Abkunft.
Wir können auf die Sinnesart der alten Völker nur aus den Äußerungen der Naturgefühle schließen, welche in den Überbleibseln ihrer Literatur ausgesprochen sind; wir müssen daher diesen Äußerungen um so sorgfältiger nachspüren und sie um so vorsichtiger beurteilen, als sie sich unter den großen Formen der lyrischen und epischen Dichtung nur sparsam darbieten. Im hellenischen Altertum, im Blütenalter der Menschheit, finden wir allerdings den zartesten Ausdruck tiefer Naturempfindung den dichterischen Darstellungen menschlicher Leidenschaft, einer der Sagengeschichte entnommenen Handlung beigemischt; aber das eigentlich Naturbeschreibende zeigt sich dann nur als ein Beiwerk, weil in der griechischen Kunstbildung sich alles gleichsam im Kreis der Menschheit bewegt.
Beschreibung der Natur in ihrer gestaltenreichen Mannigfaltigkeit, Naturdichtung als ein abgesonderter Zweig der Literatur war den Griechen völlig fremd. Auch die Landschaft erscheint bei ihnen nur als Hintergrund eines Gemäldes, vor dem menschliche Gestalten sich bewegen. Leidenschaften in Taten ausbrechend fesselten fast allein den Sinn. Ein bewegtes öffentliches Volksleben zog ab von der dumpfen, schwärmerischen Versenkung in das stille Treiben der Natur; ja den physischen Erscheinungen wurde immer eine Beziehung auf die Menschheit5 beigelegt, sei es in den Verhältnissen der äußeren Gestaltung oder der inneren anregenden Tatkraft. Fast nur solche Beziehungen machten die Naturbetrachtung würdig, unter der sinnigen Form des Gleichnisses, als abgesonderte kleine Gemälde voll objektiver Lebendigkeit in das Gebiet der Dichtung gezogen zu werden.
Zu Delphi wurden Frühlings-Päane6 gesungen, wahrscheinlich bestimmt, die Freude des Menschen nach der überstandenen Not des Winters auszudrücken. Eine naturbeschreibende Darstellung des Winters ist den Werken und Tagen7 des Hesiodus (vielleicht von der fremden Hand eines späteren ionischen Rhapsoden?) eingewebt. In edler Einfachheit, aber in nüchtern didaktischer Form gibt dies Gedicht Anweisungen zum Feldbau, Erwerbs- und Arbeitsregeln, ethische Mahnungen zu tadellosem Wandel. Es erhebt sich ebenfalls zu mehr lyrischem Schwung nur, wenn der Sänger das Elend des Menschengeschlechts oder die schöne allegorische Mythe des Epimetheus und der Pandora in ein anthropomorphisches Gewand einhüllt. Auch in der ›Theogonie‹ des Hesiodus, die aus sehr verschiedenen uralten Elementen zusammengesetzt ist, finden sich mehrfach, z.B. bei Aufzählung der Nereiden8, Naturschilderungen des neptunischen Reichs unter bedeutsamen Namen mythischer Personen versteckt. Die böotische Sängerschule und überhaupt die ganze alte Dichtkunst wenden sich den Erscheinungen der Außenwelt zu, um sie menschenartig zu personifizieren.
Ist, wie soeben bemerkt, Naturbeschreibung, sei sie Darstellung des Reichtums und der Üppigkeit tropischer Vegetation, sei sie lebensfrische Schilderung der Sitten der Tiere, gleichsam nur in der neuesten Zeit ein abgesonderter Zweig der Literatur geworden, so ist es nicht, als habe da, wo so viel Sinnlichkeit atmet, die Empfänglichkeit für das Naturschöne gemangelt,9 als müsse man da, wo die schaffende Kraft der Hellenen in der Poesie und der bildenden Kunst unnachahmliche Meisterwerke erzeugte, den lebensfrischen Ausdruck einer anschauenden Dichternatur vermissen. Was wir nach dieser Richtung hin im Gefühl unserer modernen Sinnesart in jenen Regionen der antiken Welt nur zu sparsam auffinden, bezeugt in seiner Negation weniger den Mangel der Empfänglichkeit als den eines regen Bedürfnisses, das Gefühl des Naturschönen durch Worte zu offenbaren. Minder der unbelebten Erscheinungswelt als dem handelnden Leben und der inneren, spontanen Anregung der Gefühle zugewandt, waren die frühesten und auch die edelsten Richtungen des dichterischen Geistes episch und lyrisch. In diesen Kunstformen aber können Naturschilderungen sich nur wie zufällig beigemischt finden. Sie erscheinen nicht als gesonderte Erzeugnisse der Phantasie. Je mehr der Einfluß der Alten Welt verhallte, je mehr ihre Blüten dahinwelkten, ergoß sich die Rhetorik in die beschreibende wie in die belehrende, didaktische Poesie. Diese war ernst, großartig und schmucklos in ihrer ältesten philosophischen, halb priesterlichen Form als Naturgedicht des Empedokles; sie verlor allmählich durch die Rhetorik von ihrer Einfachheit und früheren Würde.
Möge es uns erlaubt sein, um das allgemein Gesagte zu erläutern, hier bei einzelnen Beispielen zu verweilen. Wie der Charakter des Epos es erheischt, finden sich in den Homerischen Gesängen immer nur als Beiwerk die anmutigsten Szenen des Naturlebens. „Der Hirt freut sich der Windstille der Nacht, des reinen Äthers und des Sternenglanzes am Himmelsgewölbe; er vernimmt aus der Ferne das Toben des plötzlich angeschwollenen, Eichenstämme und trüben Schlamm fortreißenden Waldstroms.“10 Mit der großartigen Schilderung der Waldeinsamkeit des Parnassos und seiner dunklen, dichtbelaubten Felstäler konstrastieren die heiter lieblichen Bilder des quellenreichen Pappelhains in der Phäaken-Insel Scheria, und vor allem das Land der Zyklopen: „Wo schwellend von saftreichem, wogenden Gras die Auen den ungepflegten Rebenhügel umgrenzen.“11 Pindaros besingt in einem Frühlings-Dithyrambus, den er zu Athen hat aufführen lassen, „die mit neuen Blüten bedeckte Erde, wenn in der Argeischen Nemea der sich zuerst entwickelnde Sprößling des Palmbaums dem Seher den anbrechenden, duftenden Frühling verkündigt“; er besingt den Ätna: „die Säule des Himmels, Nährerin dauernden Schnees“; aber eilend wendet er sich ab von der toten Natur und ihren Schauern, um Hieron von Syracus zu feiern und die siegreichen Kämpfe der Hellenen gegen das mächtige Volk der Perser.
Vergessen wir nicht, daß die griechische Landschaft den eigentümlichen Reiz einer innigeren Verschmelzung des Starren und Flüssigen, des mit Pflanzen geschmückten oder malerisch felsigen, luftgefärbten Ufers und des wellenschlagenden, lichtwechselnden, klangvollen Meers darbietet. Wenn anderen Völkern Meer und Land, das Erd- und Seeleben wie zwei getrennte Sphären der Natur erschienen sind, so wurde dagegen den Hellenen, und nicht etwa bloß den Inselbewohnern, sondern auch den Stämmen des südlichen Festlands, fast überall gleichzeitig der Anblick dessen, was im Kontakt und durch Wechselwirkung der Elemente dem Naturbild seinen Reichtum und seine erhabene Größe verleiht. Wie hätten auch jene sinnigen, glücklich gestimmten Völker nicht angeregt werden sollen von der Gestalt waldbegrenzter Felsrippen an den tiefeingeschnittenen Ufern des Mittelmeers, von dem stillen, nach Jahreszeiten und Tagesstunden wechselnden Verkehr der Erdfläche mit den unteren Schichten des Luftkreises, von der Verteilung der vegetabilischen Gestalten? Wie sollte in dem Zeitalter, wo die dichterische Stimmung die höchste war, sich nicht jegliche Art lebendiger sinnlicher Regung des Gemüts in idealische Anschauung auflösen? Der Grieche dachte sich die Pflanzenwelt in mehrfacher mythischer Beziehung mit den Heroen und Göttern. Diese rächten strafend eine Verletzung geheiligter Bäume und Kräuter. Die Einbildungskraft belebte gleichsam die vegetabilischen Gestalten; aber die Formen der Dichtungsarten, auf welche bei der Eigentümlichkeit griechischer Geistesentwicklung das Altertum sich beschränkte, gestatteten dem naturbeschreibenden Teil nur eine mäßige Entfaltung.
Einzeln bricht indes selbst bei den Tragikern mitten im Gewühl aufgeregter Leidenschaft und wehmütiger Gefühle ein tiefer Natursinn in begeisterte Schilderungen der Landschaft aus. Wenn Ödipus sich dem Hain der Eumeniden naht, singt der Chor „den edeln Ruhesitz des glanzvollen Kolonos, wo die melodische Nachtigall gern einkehrt und in helltönenden Lauten klagt“; er singt „die grünende Nacht der Efeu-Gebüsche, die von himmlischem Tau getränkten Narzissen, den goldstrahlenden Krokos und den unvertilgbaren, stets selber sich wiedererzeugenden Ölbaum“.12 Indem Sophokles seinen Geburtsort, den Gau von Kolonos, zu verherrlichen strebt, stellt er die hohe Gestalt des schicksalverfolgten, herumirrenden Königs an die schlummerlosen Gewässer des Kephissos, von heiteren Bildern sanft umgeben. Die Ruhe der Natur vermehrt den Eindruck des Schmerzes, welchen die hehre Gestalt des Erblindeten, das Opfer verhängnisvoller Leidenschaft, hervorruft. Auch Euripides13 gefällt sich in der malerischen Beschreibung von „Messeniens und Lakoniens Triften, die unter dem ewig milden Himmel durch tausend Quellenbrunnen genährt, vom schönen Pamisos durchströmt werden“.
Die bukolische Dichtung, in den Gefilden von Sizilien entstanden und zum Dramatischen volkstümlich hingeneigt, führt mit Recht den Namen einer Übergangsform. Sie schildert im kleinen Hirten-Epos mehr den Naturmenschen als die Landschaft. So erscheint sie in ihrer anmutigsten Vollendung in Theokrit. Ein weiches elegisches Element ist übrigens dem Idyll eigen, gleichsam als wäre es „aus der Sehnsucht nach einem verlorenen Ideal“ entstanden, als sei immerdar in der Brust des Menschen dem tiefen Naturgefühl eine gewisse Wehmut beigemischt.
Wie nun mit dem freien Volksleben die Poesie in Hellas erstarb, wurde diese beschreibend, didaktisch eine Trägerin des Wissens. Sternkunde, Erdbeschreibung, Jagd und Fischfang treten auf in der alexandrinischen Zeit als Gegenstände der Dichtkunst, oft geziert durch eine sehr vorzügliche metrische Technik. Die Gestalten und Sitten der Tierwelt werden mit Anmut und oft mit einer Genauigkeit geschildert, daß die neuere klassifizierende Naturkunde Gattungen und selbst Arten in den Beschreibungen erkennen kann. Es fehlt aber allen diesen Dichtungsarten das innere Leben, eine begeisterte Anschauung der Natur, das, wodurch die Außenwelt dem angeregten Dichter fast unbewußt ein Gegenstand der Phantasie wird. Das Übermaß des beschreibenden Elements findet sich in den durch kunstreichen Versbau ausgezeichneten 48 Gesängen der ›Dionysiaca‹ des Ägypters Nonnus. Der Dichter gefällt sich in der Darstellung großer Naturumwälzungen, er läßt durch ein vom Blitz entzündetes Waldufer, im Flußbett des Hydaspes, selbst die Fische verbrennen; er lehrt, wie aufsteigende Dämpfe den meteorologischen Prozeß des Gewitters und eines elektrischen Regens erzeugen. Zur romantischen Poesie hingeneigt, ist Nonnus von Panopolis wundersam ungleich, bald begeistert und anregend, bald langweilig und wortreich.
Mehr Naturgefühl und Zartheit der Empfindung offenbaren sich in einzelnen Teilen der griechischen Blumenlese (›Anthologie‹), welche auf so verschiedenen Wegen und aus verschiedenen Zeiten zu uns gelangt ist. In der anmutigen Übersetzung von Jacobs ist alles, was das Tier- und Pflanzenleben betrifft, in einer Abteilung vereinigt. Es sind kleine Bilder, meist nur Anspielungen auf individuelle Formen. Die Platane, welche „in ihrem Gezweig die mostschwellende Traube ernährt“ und aus Kleinasien über die Insel des Diomedes erst unter Dionysius dem Älteren bis zu den Ufern des sizilischen Anapus vordrang, wird vielleicht nur zu oft besungen; doch scheint im ganzen der antike Sinn in diesen Liedern und Epigrammen mehr der Tier- als der Pflanzenwelt zugewandt. Eine edle und zugleich etwas größere Komposition ist das Frühlingsidyllium des Meleager von Gadara in Cölesyrien [Mittelsyrien zwischen Libanon und Antilibanon]14.
Schon des alten Rufs der Gegend wegen muß ich die Schilderung des Waldtals von Tempe erwähnen, welche Aelian15 wahrscheinlich nach dem Vorbild des Dicäarchus entworfen hat. Es ist das Ausführlichste, was uns von Naturbeschreibungen aus den griechischen Prosaiken erhalten ist, topographisch freilich, aber doch auch malerisch zugleich; denn das schattige Tal wird belebt durch den pythischen Aufzug (theoria), „welcher vom heiligen Lorbeer die sühnenden Zweige bricht“. In der späten byzantinischen Zeit, seit dem Ende des 4. Jahrhunderts, sehen wir landschaftliche Schilderungen schon häufiger in die Romane der griechischen Prosaiker eingewebt. Durch die Schilderungen zeichnet sich der Schäferroman des Longus16 aus, in welchem aber doch zarte Lebensbilder den Ausdruck der Naturgefühle weit übertreffen.
Es war nicht der Zweck dieser Blätter, mehr zu liefern, als was durch spezielle Erinnerung an einzelne Kunstformen die allgemeinen Betrachtungen über die dichterische Auffassung der Außenwelt zu erläutern vermag. Ich würde schon den Blütenkreis des hellenischen Altertums verlassen, wenn in einem Werk, dem ich gewagt, den Namen ›Kosmos‹ vorzusetzen, mit Stillschweigen die Naturschilderung übergangen werden dürfte, mit der das Pseudo-Aristotelische Buch vom Kosmos (oder von der Weltordnung) anhebt. Es zeigt uns dieselbe „den Erdball mit üppigem Pflanzenwuchs geschmückt, reich bewässert und (als das Preiswürdigste) von denkenden Wesen bewohnt“.17 Die rhetorische Färbung eines so reichen Naturbildes, der konzisen und rein wissenschaftlichen Darstellungsweise des Stagiriten völlig unähnlich, ist selbst als eines der vielen Zeichen der Unechtheit jener Schrift ›Über den Kosmos‹ erkannt worden. Mag sie immerhin dem Aupulejus18 oder dem Chrysippus19 oder wem sonst zugehören! Die naturbeschreibende Stelle, die wir als aristotelisch entbehren, wird uns gleichsam durch eine andere, echte ersetzt, welche Cicero uns erhalten hat. Aus einem verlorenen Werk des Aristoteles führt dieser in wörtlicher Übertragung20 folgendes an: „Wenn es Wesen gäbe, die in den Tiefen der Erde immerfort in Wohnungen lebten, welche mit Statuen und Gemälden und allem dem verziert wären, was die für glücklich Gehaltenen in reicher Fülle besitzen; wenn dann diese Wesen Kunde erhielten vom Walten und der Macht der Götter und durch die geöffneten Erdspalten aus jenen verborgenen Sitzen herausträten an die Orte, die wir bewohnen, wenn sie urplötzlich Erde und Meer und das Himmelsgewölbe erblickten, den Umfang der Wolken und die Kraft der Winde erkennten, die Sonne bewunderten in ihrer Größe, Schönheit und lichtausströmenden Wirkung, wenn sie endlich, sobald die einbrechende Nacht die Erde in Finsternis hüllt, den Sternenhimmel, den lichtwechselnden Mond, den Auf- und Untergang der Gestirne und ihren von Ewigkeit her geordneten unveränderlichen Lauf erblickten, so würden sie wahrscheinlich aussprechen, es gebe Götter und so große Dinge seien ihr Werk.“ Man hat mit Recht gesagt, daß diese Worte allein schon hinreichen, Ciceros Ausspruch über „den goldenen Strom der Aristotelischen Rede“ zu bewähren21, daß in ihnen etwas von der begeisternden Kraft des Platonischen Genius weht. Ein solcher Beweis für das Dasein himmlischer Mächte aus der Schönheit und unendlichen Größe der Werke der Schöpfung steht im Altertum sehr vereinzelt da.
Was wir, ich sage nicht, in der Empfänglichkeit des griechischen Volkes, sondern in den Richtungen seiner literarischen Produktivität vermissen, ist noch sparsamer bei den Römern zu finden. Eine Nation, die nach alter sikulischer Sitte dem Feldbau und dem Landleben vorzugsweise zugetan war, hätte zu anderen Hoffnungen berechtigt; aber neben so vielen Anlagen zur praktischen Tätigkeit war der Volkscharakter der Römer in seinem kalten Ernst, in seiner abgemessenen, nüchternen Verständigkeit, sinnlich weniger erregbar, der alltäglichen Wirklichkeit mehr als einer idealisierenden dichterischen Naturanschauung hingegeben. Diese Unterschiede des inneren Lebens der Römer und der griechischen Stämme spiegeln sich ab in der Literatur als dem geistigen Ausdruck alles Volkssinnes. Zu ihnen gesellt sich noch trotz der Verwandtschaft in der Abstammung die anerkannte Verschiedenheit im organischen Bau der beiden Sprachen. Der Sprache des alten Latium wird mindere Bildsamkeit, eine beschränktere Wortfügung, „eine mehr realistische Tendenz“ als idealische Beweglichkeit zugeschrieben. Dazu konnte im Augusteischen Zeitalter der entfremdende Hang, griechischen Vorbildern nachzustreben, den Ergießungen heimischer Gemütlichkeit und eines freien Naturgefühls hinderlich werden; aber von Vaterlandsliebe getragen, wußten kräftige Geister durch schöpferische Individualität, durch Erhabenheit der Ideen wie durch zarte Anmut der Darstellung jene Hindernisse zu überwinden.
Reichlich mit poetischem Genius ausgestattet ist das begeisterte Naturgedicht des Lucretius. Es umfaßt den ganzen Kosmos; dem Empedokles und Parmenides verwandt, erhöht die archaistische Diktion den Ernst der Darstellung. Die Poesie ist hier tief mit der Philosophie verwachsen, ohne deshalb in die „Frostigkeit“ der Komposition zu verfallen, welche, gegen die phantasiereiche Naturansicht Platos abstechend, schon von dem Rhetor Menander in dem über die ›Physischen Hymnen‹ gefällten Urteil so bitter getadelt wird22. Mein Bruder hat mit viel Scharfsinn die auffallenden Analogien und Verschiedenheiten entwickelt, welche aus der Verwachsung metaphysischer Abstraktionen mit der Poesie in den alten griechischen Lehrgedichten, in dem des Lucretius und in der Episode Bhagavad-Gita, aus dem indischen Epos Mahabharata23, entstanden sind. Das große physische Weltgemälde des römischen Dichters kontrastiert in seiner erkaltenden Atomistik und seinen oft wilden geognostischen Träumen mit seiner lebensfrischen Schilderung vom Übergang des Menschengeschlechts aus dem Dickicht der Wälder zum Feldbau, zur Beherrschung der Naturkräfte, zur erhöhten Kultur des Geistes und also auch der Sprache, zur bürgerlichen Gesittung.24
Wenn bei einem Staatsmann in einem bewegten und vielbeschäftigten Leben, in einem durch politische Leidenschaft aufgeregten Gemüt, lebendiges Naturgefühl und Liebe zu ländlicher Einsamkeit sich erhalten, so liegt die Quelle davon in den Tiefen eines großen und edlen Charakters. Ciceros eigene Schriften bezeugen die Wahrheit dieser Behauptung. Allerdings ist, wie allgemein bekannt, im Buch ›Von den Gesetzen‹ und in dem ›Vom Redner‹ manches dem Phädrus des Plato25 nachgebildet; das italische Naturbild hat aber darum nichts von seiner Individualität verloren. Plato preist in allgemeinen Zügen den „dunklen Schatten der hochbelaubten Platane, die Kräuterfülle in vollem Duft der Blüten; die Lüfte, welche süß und sommerlich im Chor der Zikaden wehen“. In Ciceros kleinem Naturbild ist, wie noch neuerlichst ein sinniger Forscher26 bemerkt hat, alles so dargestellt, wie man es heute noch in der wirklichen Landschaft wiederfindet. Den Liris sehen wir von hohen Pappeln beschattet; man erkennt, wenn man vom steilen Berg hinter der alten Burg von Arpinum gegen Osten hinabsteigt, den Eichenhain am Bach Fibrenus wie die Insel, jetzt Isola di Carnello genannt, welche durch die Teilung des Flüßchens entsteht und in die Cicero sich zurückzog, um, wie er sagt, „seinen Meditationen nachzuhängen, zu lesen oder zu schreiben“. Arpinum am Volskischen Gebirge war des großen Staatsmanns Geburtssitz, und die herrliche Umgebung hat gewiß auf seine Stimmung im Knabenalter gewirkt. Dem Menschen unbewußt, gesellt sich früh, was die umgebende, mehr oder minder anregende Natur in der Seele abspiegelt, zu dem, was tief und frei in den ursprünglichen Anlagen, in den inneren geistigen Kräften gewurzelt ist.
Mitten unter den verhängnisvollen Stürmen des Jahres 708 (nach Erbauung der Stadt) fand Cicero Trost in seinen Villen, abwechselnd in Tusculum, in Arpinum, bei Cumä und Antium. „Nichts ist erfreulicher“, schreibt er27 an Atticus, „als diese Einsamkeit; nichts anmutiger als dieser Landsitz, als das nahe Ufer und der Blick auf das Meer. – In der Einöde der Insel Astura, an der Mündung des gleichnamigen Flusses, am Ufer des Tyrrhenischen Meers stört mich kein Mensch; und wenn ich mich früh Morgens in einem dichten und rauhen Wald verborgen halte, verlasse ich denselben vor Abend nicht. Nächst meinem Atticus ist mir nichts so lieb wie die Einsamkeit; in ihr pflege ich meinen Verkehr mit den Wissenschaften, doch wird dieser oft durch Tränen unterbrochen. Ich kämpfe (als Vater) dagegen an, so viel ich es vermag; aber noch bin ich solch einem Kampf nicht gewachsen.“ Man hat mehrfach bemerkt, daß in diesen Briefen und in denen des jüngeren Plinius Anklänge moderner Sentimentalität nicht zu verkennen seien. Ich finde darin nur Anklänge dieser Gemütlichkeit, die in jedem Zeitalter, bei jedem Volksstamm aus der schmerzlich beklommenen Brust emporsteigen.
Die Kenntnis der großen Dichterwerke des Virgil, des Horatius und des Tibullus ist mit der allgemeinen Verbreitung der römischen Literatur so innigst verwebt, daß es überflüssig wäre, hier bei einzelnen Zeugnissen des zarten und immer regen Naturgefühls, das einige dieser Werke belebt, zu verweilen. In Virgils Nationalepos konnte nach der Natur dieser Dichtung die Beschreibung des Landschaftlichen allerdings nur als Beiwerk erscheinen und einen sehr kleinen Raum einnehmen. Individuelle Auffassung bestimmter Lokalitäten28 bemerkt man nicht, wohl aber in mildem Farbenton ein inniges Verständnis der Natur. Wo ist das sanfte Spiel der Meereswogen, wo die Ruhe der Nacht glücklicher beschrieben? Wie kontrastieren mit diesen heiteren Bildern die kräftigen Darstellungen des einbrechenden Ungewitters im ersten Buch vom Landbau, der Meerfahrt und Landung bei den Strophaden, des Felsensturzes oder des flammensprühenden Ätna in der Aeneis!29 Von Ovidius hätten wir als Frucht seines langen Aufenthalts in den Ebenen von Tomi (in Unter-Mösien) eine dichterische Naturbeschreibung der Steppen erwarten können, deren keine aus dem Altertum auf uns gekommen ist. Der Verbannte sah freilich nicht die Art von Steppen, welche im Sommer mit vier bis sechs Fuß hohen saftreichen Kräutern dicht bedeckt sind und bei jedem Windhauch das anmutige Bild bewegter Blütenwellen darbieten; der Verbannungsort des Ovidius war ein ödes sumpfreiches Steppenland und der gebrochene Geist des unmännlich Klagenden war mit Erinnerungen an die Genüsse der geselligen Welt, an die politischen Ereignisse in Rom, nicht mit der Anschauung der ihn umgebenden skythischen Einöde erfüllt. Als Ersatz hat uns der hochbegabte, jeder lebensfrischen Darstellung so mächtige Dichter neben den, freilich nur zu oft wiederholten, allgemeinen Schilderungen von Höhlen, Quellen und „stillen Mondnächten“ eine überaus individualisierte, auch geognostisch wichtige Beschreibung des vulkanischen Ausbruchs bei Methone, zwischen Epidaurus und Trözen, gegeben. Es ist dieser Beschreibung schon an einem anderen Ort, im Naturgemälde30, gedacht. Ovidius zeigt uns, „wie durch der eingezwängten Dämpfe Kraft der Boden gleich einer luftgefüllten Blase, gleich dem Fell des zweigehörnten Bocks anschwillt und sich als ein Hügel erhebt“.
Am meisten ist zu bedauern, daß Tibullus keine große naturbeschreibende Komposition von individuellem Charakter hat hinterlassen können. Unter den Dichtern des Augusteischen Zeitalters gehört er zu den wenigen, die, der alexandrinischen Gelehrsamkeit glücklicherweise fremd, der Einsamkeit und dem Landleben ergeben, gefühlvoll und darum einfach, aus eigener Quelle schöpften. Elegien31 müssen freilich als Sittenbilder betrachtet werden, in welchen die Landschaft den Hintergrund bildet; aber die ›Feldweihe‹ und die 6. Elegie des ersten Buches lehren, was von Horazens und Messalas Freund zu erwarten gewesen wäre.
Lucanus, der Enkel des Rhetors M. Annäus Seneca, ist diesem freilich durch rednerischen Schmuck der Diktion nur zu sehr verwandt; doch finden wir bei ihm ein vortreffliches und naturwahres Gemälde von der Zerstörung des Druidenwalds32 am jetzt baumlosen Gestade von Marseille. Die gefällten Eichenstämme erhalten sich schwebend aneinander gelehnt; entblättert lassen sie den ersten Lichtstrahl in das schauervolle, heilige Dunkel dringen. Wer lange in den Wäldern der Neuen Welt gelebt hat, fühlt, wie lebendig mit wenigen Zügen der Dichter die Üppigkeit eines Baumwuchses schildert, dessen riesenmäßige Reste noch in einigen Torfmooren von Frankreich begraben liegen33. In dem didaktischen Gedicht ›Aetna‹ des Lucilius Junior, eines Freunds des L. Annäus Seneca, sind allerdings die Ausbruchserscheinungen eines Vulkans mit Wahrheit geschildert; aber die Auffassung ist ohne Individualität, mit viel minderer, als wir schon oben34 am ›Aetna, dialogus‹ des jungen Bembo gerühmt haben.
Als endlich die Dichtkunst in ihren großen und edelsten Formen wie erschöpft dahinwelkte, seit der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts, waren die poetischen Bestrebungen, vom Zauber schöpferischer Phantasie entblößt, auf die nüchternen Realitäten des Wissens und des Beschreibens gerichtet. Eine gewisse rednerische Ausbildung des Stils konnte nicht ersetzen, was an einfachem Naturgefühl und idealisierender Begeisterung abging. Als Erzeugnis dieser unfruchtbaren Zeit, in der das poetische Element nur wie ein zufälliger äußerer Schmuck des Gedankens erscheint, nennen wir das Moselgedicht des Ausonius. Im aquitanischen Gallien geboren, hatte der Dichter dem Feldzug Valentinians gegen die Alemannen beigewohnt. Die ›Mosella‹, im alten Trier gedichtet, besingt in einzelnen Stellen35 nicht ohne Anmut die schon damals rebenbepflanzten Hügel eines der schönsten Ströme unseres vaterländischen Bodens; aber die nüchterne Topographie des Landes, die Aufzählung der der Mosel zuströmenden Bäche, die Charakteristik der Fischgattungen in Gestalt, Farbe und Sitten sind Hauptgegenstände dieser ganz didaktischen Komposition.
In den römischen Prosaikern, unter denen wir schon oben einige denkwürdige Stellen des Cicero angeführt haben, sind Naturbeschreibungen ebenso selten wie in den griechischen. Nur die großen Historiker Julius Cäsar, Livius und Tacitus bieten einzelne Beispiele dar, wo sie veranlaßt sind, Schlachtfelder, Übergänge von Flüssen oder unwegsame Bergpässe zu beschreiben; da, wo sie das Bedürfnis fühlen, den Kampf der Menschen mit Naturhindernissen zu schildern. In den Annalen des Tacitus entzücken mich die Beschreibung der unglücklichen Schiffahrt des Germanicus auf der Ems (Amisia) und die großartige geographische Schilderung der Bergketten von Syrien und Palästina36. Curtius37 hat uns ein schönes Naturbild von einer waldigen Wildnis hinterlassen, die das makedonische Heer westlich von Hekatompylos im feuchten Mazenderan durchziehen mußte. Ich würde desselben hier ausführlicher erwähnen, wenn man mit einiger Sicherheit unterscheiden könnte, was ein Schriftsteller, dessen Zeitalter so ungewiß ist, aus seiner lebhaften Phantasie, was er aus historischen Quellen geschöpft hat.
Des großen enzyklopädischen Werks des älteren Plinius, dem an Reichtum des Inhalts kein anderes Werk des Altertums gleichkommt, wird späterhin, in der Geschichte der Weltanschauung, gedacht werden. Es ist, wie der Neffe (der jüngere Plinius) sich schön ausdrückt, „mannigfach wie die Natur“. Ein Erzeugnis des unwiderstehlichen Hangs zu allumfassendem, oft unfleißigem Sammeln; im Stil ungleich, bald einfach und aufzählend, bald gedankenreich, lebendig und rhetorisch geschmückt, ist die Naturgeschichte des älteren Plinius schon ihrer Form wegen an individuellen Naturschilderungen arm; aber überall, wo die Anschauung auf ein großartiges Zusammenwirken der Kräfte im Weltall, auf den wohlgeordneten Kosmos (Naturae majestas) gerichtet ist, kann eine wahre, aus dem Innern quellende Begeisterung nicht verkannt werden. Das Werk hat auf das ganze Mittelalter mächtig nachgewirkt.
Als Beweise des Naturgefühls bei den Römern würden wir gern auch die anmutig gelegenen Villen auf dem Pincius, bei Tusculum und Tibur, am Vorgebirge Misenum, bei Puteoli und Bajae anführen: wenn sie nicht, wie die des Scaurus und Mäcenas, des Lucullus und des Hadrian, mit Prachtgebäuden überfüllt gewesen wären. Tempel, Theater und Rennbahnen wechselten ab mit Vogelhäusern und Gebäuden, der Zucht von Schnecken und Haselmäusen bestimmt. Seinen, allerdings einfacheren Landsitz zu Liternum hatte der ältere Scipio festungsartig mit Türmen umgeben. Der Name eines Freundes des Augustus (Matius) ist uns aufbewahrt, weil er, Zwang und Unnatur liebend, zuerst die Sitte des Beschneidens der Bäume aufbrachte, um sie nach architektonischen und plastischen Vorbildern kunstmäßig umzuformen. Die Briefe des jüngeren Plinius liefern uns anmutige Beschreibungen zweier38 seiner zahlreichen Villen (Laurentinum und Tuscum). Wenn man auch in beiden der Baulichkeiten, von beschnittenem Buchs umgeben, mehr zusammengedrängt findet, als nach unserm Naturgefühl zu wünschen wäre, so beweisen doch diese Schilderungen wie die Nachahmung des Tals von Tempe in der tiburtinischen Villa des Hadrian, daß neben der Liebe zur Kunst, neben der ängstlichsten Sorgfalt für Behaglichkeit durch Stellung der Landhäuser nach Verhältnis zur Sonne und zu vorherrschenden Winden, auch Liebe zu freiem Genuß der Natur den römischen Stadtbewohnern nicht fremd war. Mit Freude setzen wir hinzu, daß dieser Genuß auf den Landgütern des Plinius durch den widrigen Anblick des Sklavenelends minder gestört war. Der reiche Mann war nicht bloß einer der gelehrtesten seiner Zeit, er hatte auch, was im Altertum wenigstens selten ausgedrückt ist, rein menschliche Gefühle des Mitleids für die unfreien unteren Volksklassen. Auf den Villen des jüngeren Plinius gab es keine Fesseln; der Sklave als Landbauer vererbte frei, was er sich erworben hatte.39
Vom ewigen Schnee der Alpen, wenn sie sich am Abend oder am frühen Morgen röten, von der Schönheit des blauen Gletschereises, von der großartigen Natur der schweizerischen Landschaft ist keine Schilderung aus dem Altertum auf uns gekommen, und doch gingen ununterbrochen Staatsmänner, Heerführer und in ihrem Gefolge Literaten durch Helvetien nach Gallien. Alle diese Reisenden wissen nur über die unfahrbaren scheußlichen Wege zu klagen; das Romantische der Naturszenen beschäftigte sie nie. Es ist sogar bekannt, daß Julius Cäsar, als er zu seinen Legionen nach Gallien zurückkehrte, die Zeit benutzte, um „während des Übergangs über die Alpen“ eine grammatische Schrift ›De analogia‹ anzufertigen40. Silius Italicus (er starb unter Trajan, wo die Schweiz schon sehr angebaut war) beschreibt die Alpengegend als eine schreckenerregende, vegetationslose Einöde41, während er mit Liebe alle Felsenschluchten Italiens und die buschigen Ufer des Liris (Garigliano) besingt42. Auffallend ist dabei, daß der wundersame Anblick gegliederter Basaltsäulen, wie das mittlere Frankreich, die Rheinufer und die Lombardei sie in vielfältigen Gruppen darbieten, die Römer zu keiner Beschreibung, ja nicht einmal zu einer Erwähnung angeregt hat.
Während die Gefühle abstarben, welche das klassische Altertum belebten und den Geist auf Handlung und Äußerung menschlicher Tatkraft, nicht auf Zustände und Beschauung der Außenwelt leiteten, gewann eine neue Sinnesart Raum. Es verbreitete sich allmählich das Christentum; und wie dieses, selbst wo es als Staatsreligion auftrat, in der großen Angelegenheit der bürgerlichen Freiheit des Menschengeschlechts für die niederen Volksklassen wohltätig wirkte, so erweiterte es auch den Blick in die freie Natur. Das Auge haftete nicht mehr an den Gestalten der olympischen Götter; der Schöpfer (so lehren es die Kirchenväter in ihrer kunstgerechten, oft dichterischen phantasiereichen Sprache) zeigt sich groß in der toten Natur wie in der lebendigen, im wilden Kampf der Elemente wie im stillen Treiben der organischen Entfaltung. Bei der allmählichen Auflösung der römischen Weltherrschaft verschwinden freilich nach und nach in den Schriften jener traurigen Zeit die schöpferische Kraft, die Einfachheit und Reinheit der Diktion; sie verschwinden zuerst in den lateinischen Ländern, später auch im griechischen Osten. Hang zur Einsamkeit, zu trübem Nachdenken, zu innerer Versenkung des Gemüts wird sichtbar; sie wirkt gleichzeitig auf die Sprache und auf die Färbung des Stils.
Wenn sich auf einmal etwas Neues in den Gefühlen der Menschen zu entwickeln scheint, so kann fast immer ein früher, tiefliegender Keim wie vereinzelt aufgespürt werden. Die Weichheit43 des Mimnermos hat man oft eine sentimentale Richtung des Gemüts genannt. Die Alte Welt ist nicht schroff von der neueren geschieden; aber Veränderungen in den religiösen Ahnungen der Menschheit, in den zartesten sittlichen Gefühlen, in der speziellen Lebensweise derer, welche Einfluß auf den Ideenkreis der Massen ausüben, machten plötzlich vorherrschend, was früher der Aufmerksamkeit entgehen mußte. Die christliche Richtung des Gemüts war die, aus der Weltordnung und aus der Schönheit der Natur die Größe und die Güte des Schöpfers zu beweisen. Eine solche Richtung, die Verherrlichung der Gottheit aus ihren Werken, veranlaßte den Hang nach Naturbeschreibungen. Die frühesten und ausführlichsten finden wir bei einem Zeitgenossen des Tertullianus und Philostratus, bei einem rhetorischen Sachwalter zu Rom, Minucius Felix, aus dem Anfang des 3. Jahrhunderts. Man folgt ihm gern im Dämmerlicht an den Strand bei Ostia, den er freilich malerischer und der Gesundheit zuträglicher schildert, als wir ihn jetzt finden. In dem religiösen Gesprach ›Octavius‹ wird der neue Glaube gegen die Einwürfe eines heidnischen Freunds mutvoll verteidigt.44
Es ist hier der Ort, aus den griechischen Kirchenvätern einige Naturschilderungen fragmentarisch einzuschalten, da sie meinen Lesern gewiß weniger bekannt sind als, was aus der römischen Literatur uns die altitalische Liebe zum Landleben überliefert hat. Ich beginne mit einem Brief Basilius’ des Großen, für den ich lange schon eine besondere Vorliebe hege. Aus Cäsarea in Kappadozien gebürtig, hatte Basilius, nicht viel über dreißig Jahre alt, dem heiteren Leben zu Athen entsagt, auch schon die christlichen Einsiedeleien in Cölesyrien [Mittelsyrien] und Oberägypten besucht, als er sich nach Art der vorchristlichen Essener [jüdische Sekte] und Therapeuten [Sekte] in eine Wildnis am armenischen Fluß Iris zurückzog. Dort war sein zweiter Bruder45 Naucratius nach fünfjährigem strengen Anachoretenleben beim Fischen ertrunken. „Ich glaube endlich“, schreibt er an Gregorius von Nazianz, „das Ende meiner Wanderungen zu finden. Die Hoffnung, mich mit Dir zu vereinigen, ich sollte sagen meine süßen Träume (denn mit Recht hat man Hoffnungen Träume des wachenden Menschen genannt), sind unerfüllt geblieben. Gott hat mich einen Ort finden lassen, wie er uns beiden oft in der Einbildungskraft vorschwebte. Was diese uns in weiter Ferne gezeigt, sehe ich jetzt vor mir. Ein hoher Berg, mit dichter Waldung bedeckt, ist gegen Norden von frischen, immerfließenden Wassern befeuchtet. Am Fuß des Bergs dehnt sich eine weite Ebene hin, fruchtbar durch die Dämpfe, die sie benetzen. Der umgebende Wald, in welchem sich vielartige Bäume zusammendrängen, schließt mich ab wie eine feste Burg. Die Einöde ist von zwei tiefen Talschluchten begrenzt. Auf der einen Seite bildet der Fluß, wo er vom Berg schäumend herabstürzt, ein schwer zu überschreitendes Hindernis, auf der anderen verschließt ein breiter Bergrücken den Eingang. Meine Hütte ist auf dem Gipfel so gelegen, daß ich die weite Ebene überschaue wie den ganzen Lauf des Iris, welcher schöner und wasserreicher ist als der Strymon bei Amphipolis. Der Fluß meiner Einöde, reißender als irgendeiner, den ich kenne, bricht sich an der vorspringenden Felswand und wälzt sich schäumend in den Abgrund, dem Bergwanderer ein anmutiger, wundervoller Anblick, den Eingeborenen nutzbar zu reichlichem Fischfang. Soll ich Dir beschreiben die befruchtenden Dämpfe, welche aus der (feuchten) Erde, die kühlen Lüfte, welche aus dem (bewegten) Wasserspiegel aufsteigen? Soll ich reden vom lieblichen Gesang der Vögel und der Fülle blühender Kräuter? Was mich vor allem reizt, ist die stille Ruhe der Gegend. Sie wird bisweilen nur von Jägern besucht; denn meine Wildnis nährt Hirsche und Herden wilder Ziegen, nicht eure Bären und eure Wölfe. Wie möchte ich einen anderen Ort mit diesem vertauschen! Alkmäon, nachdem er die Echinaden [Inseln an der Küste Akarnaniens] fand, wollte nicht weiter umherirren.“46 Es sprechen sich in dieser einfachen Schilderung der Landschaft und des Waldlebens Gefühle aus, welche sich mit denen der modernen Zeit inniger verschmelzen als alles, was uns aus dem griechischen und römischen Altertum überkommen ist. Von der einsamen Berghütte, in die Basilius sich zurückgezogen, senkt sich der Blick auf das feuchte Laubdach des tief liegenden Waldes. Der Ruhesitz, nach welchem er und sein Freund Gregorius von Nazianz47 so lange sich sehnten, ist endlich gefunden. Die dichterisch mythische Anspielung am Ende des Briefes erklingt wie eine Stimme, die aus einer anderen, früheren Welt in die christliche herüberschallt.
Auch des Basilius’ Homilien über das ›Hexaëmeron‹ zeugen von seinem Naturgefühl. Er beschreibt die Milde der ewig heiteren Nächte in Kleinasien, wo, wie er sich ausdrückt, die Sterne, „die ewigen Blüten des Himmels“, den Geist des Menschen vom Sichtbaren zum Unsichtbaren erheben48. Wenn er in der Sage von der Weltschöpfung die „Schönheit des Meeres“ preisen will, so beschreibt er den Anblick der grenzenlosen Fläche in ihren verschiedenen, wechselnden Zuständen: „wie sie, vom Hauch der Lüfte sanft bewegt, vielfarbig, bald weißes, bald blaues, bald rötliches Licht zurückwirft; wie sie die Küste liebkost in ihren friedlichen Spielen“. Dieselbe sentimental-schwermütige, der Natur zugewandte Stimmung finden wir bei Gregorius von Nyssa, dem Bruder des großen Basilius. „Wenn ich“, ruft er aus, „jeden Felsenrücken, jeden Talgrund, jede Ebene mit neuentsprossenem Grase bedeckt sehe, dann den mannigfaltigen Schmuck der Bäume und zu meinen Füßen die Lilien, doppelt von der Natur ausgestattet mit Wohlgeruch und mit Farbenreiz; wenn ich in der Ferne sehe das Meer, zu dem hin die wandelnde Wolke führt, so wird mein Gemüt von Schwermut ergriffen, die nicht ohne Wonne ist. Verschwinden dann im Herbst die Früchte, fallen die Blätter, starren die Äste des Baums ihres Schmucks beraubt, so versenken wir uns (bei dem ewig und regelmäßig wiederkehrenden Wechsel) in den Einklang der Wunderkräfte der Natur. Wer diese mit dem sinnigen Auge der Seele durchschaut, fühlt des Menschen Kleinheit bei der Größe des Weltalls.“49
Leitete eine solche Verherrlichung Gottes in liebevoller Anschauung der Natur die christlichen Griechen zu dichterischen Naturschilderungen, so waren sie dabei auch immer in den früheren Zeiten des neuen Glaubens nach der Eigentümlichkeit ihrer Sinnesart voll Verachtung aller Werke der menschlichen Kunst. Chrysostomus sagt in unzähligen Stellen: „Siehst du schimmernde Gebäude, will dich der Anblick der Säulengänge verführen, so betrachte schnell das Himmelsgewölbe und die freien Felder, in welchen die Herden am Ufer der Seen weiden. Wer verachtet nicht alle Schöpfungen der Kunst, wenn er in der Stille des Herzens früh die aufgehende Sonne bewundert, indem sie ihr goldenes (krokosgelbes) Licht über den Erdkreis gießt; wenn er, an einer Quelle im tiefen Gras oder unter dem dunklen Schatten dichtbelaubter Bäume ruhend, sein Auge weidet an der weiten dämmernd dahinschwindenden Ferne!“50 Antiochien war damals von Einsiedeleien umgeben und in einer derselben lebte Chrysostomus. Es war, als hätte die Beredsamkeit am Quell der Natur in den damals waldigen Berggegenden von Syrien und Kleinasien ihr Element, die Freiheit, wiedergefunden.
Als aber in den späteren, aller Geisteskultur feindlichen Zeiten das Christentum sich unter germanische und keltische Volksstämme verbreitete, die vormals, dem Naturdienst ergeben, in rohen Symbolen die erhaltenden und zerstörenden Mächte verehrten, wurden allmählich der nahe Umgang mit der Natur und das Aufspüren ihrer Kräfte als zur Zauberei anregend verdächtigt. Dieser Umgang schien ebenso gefahrbringend wie dem Tertullian, dem Clemens von Alexandrien und fast allen älteren Kirchenvätern die Pflege der plastischen Künste. Im 12. und 13. Jahrhundert untersagten Kirchenversammlungen zu Tours (1163) und zu Paris (1209) den Mönchen das sündhafte Lesen physikalischer Schriften.51 Erst durch Albert den Großen und Roger Bacon wurden die Geistesfesseln mutvoll gebrochen, wurde die „Natur entsündigt“ und in ihre alten Rechte eingesetzt.
Wir haben bisher die Kontraste geschildert, welche sich bei Griechen und Römern, in zwei so nahe miteinander verwandten Literaturen, nach Verschiedenheit der Zeitepochen offenbarten. Aber nicht die Zeit allein, d.h. die Weltbegebenheiten, welche Regierungsform, Sitten und religiöse Anschauungen unaufhaltsam umwandeln, bringen diese Kontraste in der Gefühlsweise hervor; noch auffallender sind die, welche die Stammverschiedenheit der Menschen und ihre geistigen Anlagen erzeugen. Wie ganz anders zeigen sich uns Lebendigkeit des Naturgefühls und dichterische Färbung der Naturschilderungen bei den Hellenen, den Germanen des Nordens, den semitischen Stämmen, den Persern und Indern! Es ist eine vielfach geäußerte Meinung, daß bei den nordischen Völkern die Freude an der Natur, eine alte Sehnsucht nach den anmutigen Gefilden von Italien und Griechenland, nach der wundervollen Üppigkeit der Tropenvegetation hauptsächlich einer langen winterlichen Entbehrung alles Naturgenusses zuzuschreiben sei. Wir leugnen nicht, daß die Sehnsucht nach dem Palmenklima abnimmt, je nachdem man sich dem mittäglichen [südlichen] Frankreich oder der Iberischen Halbinsel nähert; aber der jetzt so allgemein gebrauchte, auch ethnologisch richtige Name indogermanischer Stämme sollte allein schon daran erinnern, daß man jenen Einflüssen des nordischen Winters nicht eine zu allgemeine Wirksamkeit zuschreiben müsse. Die überreiche dichterische Literatur der Inder lehrt, daß zwischen den Wendekreisen und denselben nahe, südlich von der Himalaja-Kette immergrüne und immer blütenreiche Wälder die Einbildungskraft der ostarischen Völker von jeher lebhaft anregten, daß diese Völker sich zur naturbeschreibenden Poesie mehr noch hingeneigt fühlten als die im unwirtlichen Norden bis Island verbreiteten echt germanischen Stämme. Eine Entbehrung oder wenigstens eine gewisse Unterbrechung des Naturgenusses ist aber auch den beglückteren Klimaten des südlichen Asien eigen. Die Jahreszeiten sind schroff voneinander geschieden, durch Wechsel von allbefruchtendem Regen und staubig verödender Dürre. In Persien (der westarischen Hochebene) dringt die pflanzenleere Wüste mannigfach buchtenförmig in die gesegnetsten Fruchtländer ein. Waldung bildet oft in Mittel- und Vorderasien das Ufer der weitgedehnten inneren Steppenmeere. So gewähren dem Bewohner jener heißen Klimate die räumlichen Verhältnisse des Bodens in horizontaler Richtung denselben Kontrast der Öde und des Pflanzenreichtums wie in senkrechter Richtung die schneebedeckten Bergketten von Indien und Afghanistan. Großartige Kontraste der Jahreszeiten, der Vegetation und der Höhe sind aber überall, wo eine lebendige Naturanschauung mit der ganzen Kultur und den religiösen Ahnungen eines Volksstammes verwebt ist, die anregenden Elemente dichterischer Phantasie.
Freude an der Natur, dem beschaulichen Hang der germanischen Nationen eigentümlich, spricht sich in einem hohen Grad in den frühesten Gedichten des Mittelalters aus. Die ritterliche Poesie der Minnesänger in der hohenstaufischen Zeit gibt zahlreiche Beweise dafür. So mannigfaltige historische Berührungspunkte auch diese Poesie mit der romanischen der Provenzalen hat, ist doch das echt germanische Prinzip nie daran verkannt worden. Ein inniges, alles durchdringendes Naturgefühl leuchtet aus den germanischen Sitten und allen Einrichtungen des Lebens, ja aus dem Hang zur Freiheit hervor.52 Viel in höfischen Kreisen lebend, ja oft aus ihnen entsprossen, blieben die wandernden Minnesänger mit der Natur in beständigem Verkehr. Es erhielt sich frisch in ihnen eine idyllische, oft elegische Gemütsstimmung. Um das zu würdigen, was eine solche Stimmung hervorbrachte, wende ich mich zu den Forschungen der tiefsten Kenner unseres deutschen Mittelalters, zu meinen edlen Freunden Jacob und Wilhelm Grimm. „Die vaterländischen Dichter jener Epoche“, sagt der letzere, „haben sich nirgends einer abgesonderten Naturschilderung hingegeben, einer solchen, die kein anderes Ziel hat, als den Eindruck der Landschaft auf das Gemüt mit glänzenden Farben darzustellen. Der Sinn für die Natur fehlte den altdeutschen Meistern gewiß nicht; aber sie hinterließen uns keine andere Äußerung dieses Sinns als die, welche der Zusammenhang mit geschichtlichen Vorfällen mit den Empfindungen erlaubte, die in lyrische Gedichte ausströmten. Um mit dem Volksepos, den ältesten und wertvollsten Denkmälern, zu beginnen, so findet sich weder in den ›Nibelungen‹ noch in der ›Gudrun‹53 die Schilderung einer Naturszene selbst da, wo dazu Veranlassung war. Bei der sonst umständlichen Beschreibung der Jagd, auf welcher Siegfried ermordet wird, geschieht nur Erwähnung der blumenreichen Heide und des kühlen Brunnens unter der Linde. In der ›Gudrun‹, die eine gewisse feinere Ausbildung zeigt, bricht der Sinn für die Natur etwas mehr durch. Als die Königstochter mit ihren Gefährten, zu niedrigem Sklavendienst gezwungen, die Gewänder ihrer grausamen Gebieter an das Ufer des Meers trägt, wird die Zeit bezeichnet, wo der Winter sich eben gelöst hat und der Wettgesang der Vögel beginnt. Noch fallen Schnee und Regen herab, und das Haar der Jungfrauen wird vom rauhen Märzwind gepeitscht. Als Gudrun, ihre Befreier erwartend, das Lager verläßt und nun das Meer beim Aufgang des Morgensterns zu schimmern beginnt, unterscheidet sie die dunklen Helme und die Schilde der Freunde. Es sind wenige Worte, welche dies andeuten, aber sie geben ein anschauliches Bild, bestimmt, die Spannung vor einem wichtigen geschichtlichen Ereignis zu vermehren. Nicht anders macht es Homer, wenn er die Zyklopen-Insel schildert und die geordneten Gärten des Alcinous; er will anschaulich machen die üppige Fülle der Wildnis, in der die riesigen Ungeheuer leben, und den prächtigen Wohnsitz eines mächtigen Königs. Beide Dichter gehen nicht darauf aus, eine für sich bestehende Naturschilderung zu entwerfen.“
„Dem schlichten Volksepos stehen die inhaltreichen Erzählungen der ritterlichen Dichter des 13. Jahrhunderts entgegen, die eine bewußte Kunst übten und unter welchen sich Hartmann von Aue, Wolfram von Eschenbach und Gottfried von Straßburg54 am Beginn des Jahrhunderts so sehr hervorheben, daß man sie die großen und klassischen nennen kann. Aus ihren umfangreichen Werken würde man Beweise genug von tiefem Gefühl für die Natur, wie es zumal in Gleichnissen ausbricht, sammeln können; aber der Gedanke an unabhängige Naturschilderungen war auch ihnen fremd. Sie hemmten nicht den Fortschritt der Handlung, um bei der Betrachtung des ruhigen Lebens der Natur stillzustehn. Wie verschieden davon sind die neueren dichterischen Kompositionen! Bernardin de St. Pierre braucht die Ereignisse nur als Rahmen für sein Gemälde. Die lyrischen Dichter des 13. Jahrhunderts, zumal wenn sie die Minne besingen (was sie nicht immer tun), reden oft genug vom milden Mai, dem Gesang der Nachtigall, dem Tau, welcher an den Blüten der Heide glänzt, aber immer nur in Beziehung der Gefühle, die sich darin abspiegeln sollen. Um trauernde Stimmungen zu bezeichnen, wird der falben Blätter, der verstummenden Vögel, der in Schnee vergrabenen Saaten gedacht. Dieselben Gedanken, freilich schön und sehr verschiedenartig ausgedrückt, kehren unablässig wieder. Der seelenvolle Walther von der Vogelweide und der tiefsinnige Wolfram von Eschenbach, von dem wir leider nur wenige lyrische Gesänge besitzen, sind hier als glänzende Beispiele aufzuführen.
Die Frage, ob der Kontakt mit dem südlichen Italien oder durch die Kreuzzüge mit Kleinasien, Syrien und Palästina die deutsche Dichtkunst nicht mit neuen Naturbildern bereichert habe, kann im allgemeinen nur verneint werden. Man bemerkt nicht, daß die Bekanntschaft mit dem Orient dem Minnegesang eine andere Richtung gegeben habe. Die Kreuzfahrer kamen wenig in Verbindung mit den Sarazenen; ja sie lebten selbst mit anderen Völkern, die für dieselbe Sache kämpften, in großer Spannung. Einer der ältesten lyrischen Dichter war Friedrich von Hausen. Er kam im Heer Barbarossas um. Seine Lieder enthalten vielfache Beziehungen auf die Kreuzfahrt, aber sie drücken nur religiöse Ansichten aus oder den Schmerz, sich von der Geliebten getrennt zu sehen. Vom Land fanden er und alle, die an den Kreuzzügen teilnahmen, wie Reinmar der Alte, Rubin, Neidhart und Ulrich von Lichtenstein, nicht Veranlassung etwas zu sagen. Reinmar kam als Pilgrim nach Syrien, wie es scheint, im Gefolge Herzog Leopolds VI. von Österreich. Er klagt, daß die Gedanken an die Heimat ihn nicht loslassen und ihn von Gott abziehen. Die Dattelpalme wird hier einige Male genannt, wo der Palmenzweige gedacht ist, welche fromme Pilger auf der Schulter tragen sollen. Ich erinnere mich auch nicht, daß die herrliche Natur Italiens die Phantasie der Minnesänger angeregt habe, welche die Alpen überstiegen. Walther von der Vogelweide, der weit umherzog, hatte nur den Po gesehen; aber Freidank55 war in Rom. Er bemerkt bloß, daß in den Palästen derer, welche sonst dort herrschten, Gras wachse.“
Das deutsche Tierepos, welches nicht mit der Tierfabel des Orients verwechselt werden darf, ist aus einem Zusammenleben mit der Tierwelt entstanden, ohne die Absicht zu haben, diese darzustellen. Das Tierepos, welches Jacob Grimm in der Einleitung zu seiner Ausgabe des ›Reinhart Fuchs‹ so meisterhaft behandelt, bezeugt eine innige Freude an der Natur. Die nicht an den Boden gefesselten, mit Stimme begabten, leidenschaftlich aufgeregten Tiere kontrastieren mit dem Stilleben der schweigsamen Pflanzen. Sie sind ein immerdar tätiges, die Landschaft belebendes Prinzip. „Die alte Poesie betrachtet das Naturleben gern mit menschlichem Auge; sie leiht den Tieren und bisweilen selbst den Pflanzen Sinn und Empfindungen des Menschen, indem sie phantasiereich und kindlich alles Wahrgenommene in Gestalt und Trieben zu deuten weiß. Kräuter und Blumen sind von Göttern und Helden gepflückt und gebraucht worden, sie führen dann nach ihnen den Namen. Man fühlt, daß wie ein alter Waldgeruch uns aus dem deutschen Tiergedicht anwehe.“56
An die Denkmäler germanischer Naturdichtung hätte man vormals geneigt sein können, Reste keltischirischer Dichtung anzuschließen, die ein halbes Jahrhundert lang unter dem Namen Ossians wie Nebelgestalten von Volk zu Volk gewandelt sind; aber der Zauber ist verschwunden, seitdem des talentvollen Macphersons literarisches Benehmen durch die Herausgabe des von ihm geschmiedeten gälischen Urtexts (einer Rückübertragung des englischen Werks) vollkommen aufgedeckt worden ist. Es gibt altirische Fingallieder, unter dem Namen der Finnianischen aufgezeichnet, aus christlicher Zeit, vielleicht nicht einmal bis zu der des 8. Jahrhunderts hinaufreichend; aber diese Volksgesänge enthalten wenig von den sentimentalen Naturschilderungen, welche den Macphersonschen Gedichten einen besonderen Reiz geben.57
Wir haben schon oben bemerkt, daß, wenn sentimental-romantische Anregungen der Gefühle dem indogermanischen Menschenstamm des nördlichen Europa in einem hohen Grad eigentümlich sind, man diese Erscheinung nicht allein als Folge des Klimas, d.h. der durch lange Entbehrung gesteigerten Sehnsucht betrachten darf. Wir haben erinnert, wie die indische und persische Literatur, unter der Glut des südlichen Himmels entwickelt, die reizendsten Schilderungen liefert sowohl der organischen wie der toten elementarischen Natur: des Überganges der Dürre zum tropischen Regen, der Erscheinung des ersten Gewölbes im tiefen Blau der reinen Lüfte, wenn die langersehnten etesischen Winde im gefiederten Laub der Palmengipfel allmählich zu rauschen beginnen.
Es ist hier der Ort, etwas tiefer in das Gebiet der indischen Naturschilderung einzudringen. „Denken wir uns“, sagt Lassen in seiner vortrefflichen indischen Altertumskunde58, „einen Teil des arischen Stamms aus seinem Ursitz, dem Nordwestland, nach Indien eingewandert, so fand sich derselbe dort von einer ganz neuen, wundervoll reichen Natur umgeben. Die Milde des Klimas, die Fruchtbarkeit des Bodens, seine freigebige Fülle an herrlichen Gaben mußten dem neuen Leben eine heitere Farbe mitteilen. Bei den ursprünglichen herrlichen Anlagen des arischen Volks, beim Besitz einer höheren Ausstattung des Geistes, in der alles Erhabene und Große, das von den Indern ausgeführt ist, wie in einem Keim wurzelt, erzeugte früh die Anschauung der Außenwelt ein tiefes Nachdenken über die Kräfte der Natur, ein Nachdenken, welches die Grundlage der kontemplativen Richtung ist, die wir innigst mit der ältesten Poesie der Inder verwebt finden. Ein so allbeherrschender Eindruck, welchen die Natur auf das Bewußtsein des Volks machte, betätigt sich am deutlichsten in seiner religiösen Grundansicht, in der Erkenntnis des Göttlichen in der Natur. Die sorgenlose Leichtigkeit des äußeren Daseins kam einer kontemplativen Richtung fördernd entgegen. Wer konnte sich ungestörter und inniger der Betrachtung hingeben, nachsinnen über das irdische Leben, den Zustand des Menschen nach dem Tod, über das Wesen des Göttlichen als die indischen Büßer, die waldbewohnenden Brahmanen59, deren alte Schulen eine der eigentümlichsten Erscheinungen des indischen Lebens bilden und auf die geistige Entwicklung des ganzen Stamms einen wesentlichen Einfluß ausgeübt haben.“
Soll ich hier, wie ich es, von meinem Bruder und anderen Sanskritkundigen geleitet, in meinen öffentlichen Vorlesungen tat, einzeln an das erinnern, was ein lebendiges und häufig ausbrechendes Naturgefühl in die beschreibenden Teile der indischen Poesie eingewebt hat, so beginne ich mit den ›Veden‹, dem ersten und heiligsten Denkmal der Kultur ostarischer Völker. Ihr Hauptgegenstand ist die Verehrung der Natur. Reizende Schilderungen der Morgenröte und des Anblicks der „goldhändigen“ Sonne enthalten die Hymnen des ›Rigveda‹. Die großen Heldengedichte ›Ramayana‹ und ›Mahabharata‹ sind jünger als die Veden, älter als die ›Puranen‹. In den epischen Schöpfungen ist ihrem Wesen nach die Verherrlichung der Natur an die Sage geknüpft. Wenn sich in den Veden selten örtlich die Szene angeben läßt, welche die heiligen Weisen begeisterte, so sind dagegen in den Heldengedichten die Naturschilderungen meist individuell und an bestimmte Lokalitäten gebunden, daher, was hauptsächlich Leben gibt, aus selbstempfangenen Eindrücken geschöpft. Von reicher Färbung ist die Reise Ramas von Ayuthia nach der Residenzstadt Dschanakas, sein Leben im Urwald, das Bild vom Einsiedlerleben der Panduiden.
Der Name Kalidasas ist vielfach und früh unter den westlichen Völkern gefeiert worden. Der große Dichter glänzte am hochgebildeten Hof des Vikramaditya, also gleichzeitig mit Virgil und Horaz. Die englischen und deutschen Übersetzungen der ›Sakuntala‹ haben die Bewunderung angeregt, welche dem Kalidasa in so reichem Maß gezollt worden ist.60 Zartheit der Empfindungen und Reichtum schöpferischer Phantasie weisen ihm seinen hohen Rang unter den Dichtern aller Nationen an. Den Reiz seiner Naturschilderungen bezeugen das liebliche Drama ›Vikrama und Urvasi‹, wo der König im Dickicht der Wälder umherirrt, um die Nymphe Urvasi zu suchen; das Gedicht der ›Jahreszeiten‹ und der ›Wolkenbote‹ (›Meghaduta‹). Mit bewundernswürdiger Naturwahrheit ist in diesem die Freude geschildert, mit welcher nach langer tropischer Dürre die erste Erscheinung eines aufsteigenden Gewölks als Anzeige der nahen Regenzeit begrüßt wird. Der Ausdruck Naturwahrheit, dessen ich mich eben bedient habe, kann allein die Kühnheit rechtfertigen, neben dem indischen ›Wolkenboten‹ an ein Naturbild vom Eintritt der Regenzeit zu erinnern61, das ich in Südamerika zu einer Epoche entwarf, wo Kalidasas ›Meghaduta‹ mir auch nicht einmal aus Chézys Übersetzung bekannt sein konnte. Die geheimnisvollen meteorologischen Prozesse, welche im Luftkreis vorgehen, in Dunstbildung, Wolkengestalt und leuchtenden elektrischen Erscheinungen, sind zwischen den Wendekreisen dieselben in beiden Kontinenten; und die idealisierende Kunst, deren Beruf es ist, die Wirklichkeit zu einem Bild zu erheben, würde nicht von ihrem Zauber verlieren, wenn es dem zergliedernden Beobachtungsgeist späterer Jahrhunderte glückte, die Naturwahrheit einer alten, nur beschauenden Dichtung zu bekräftigen.
Von den Ostariern, den brahmanischen Indern, und der entschiedenen Richtung ihres Sinns auf die malerische Schönheit der Natur62 gehen wir zu den Westariern, den Persern, über, welche sich im nördlicheren Zendland getrennt hatten und ursprünglich einer geistigen Verehrung der Natur neben der dualistischen Anschauung von Ahriman und Ormuzd zugetan waren. Was wir persische Literatur nennen, steigt nur in die Zeit der Sassaniden hinauf; die ältesten Denkmale der Dichtung sind untergegangen. Erst nachdem das Land von den Arabern unterjocht und sich selbst entfremdet war, erhielt es wieder eine Nationalliteratur unter den Samaniden, Gazneviden und Seldschuken. Der Flor der Poesie von Firdusi bis Hafiz und Dschami dauerte kaum vier- bis fünfhundert Jahre; er reicht fast nur bis zur Schiffahrt von Vasco da Gama. Wenn wir dem Naturgefühl bei Indern und Persern nachspüren, so dürfen wir nicht vergessen, daß beide Völker, nach dem Maß ihrer Bildung betrachtet, gleichmäßig durch Zeit und Raum voneinander getrennt erscheinen. Die persische Literatur gehört dem Mittelalter, die große indische im eigentlichsten Sinn dem Altertum zu. Die Natur im iranischen Hochland hat nicht die Üppigkeit der Baumvegetation, die wundersame Mannigfaltigkeit von Gestalt und Farbe der Gewächse, welche den Boden von Hindostan schmücken. Die Vindhya-Kette, lange die Grenzscheide der ostarischen Völker, fällt noch in die Tropenzone, während ganz Persien jenseits des Wendekreises liegt, ja die persische Dichtung teilweise sogar dem nördlichen Boden von Balkh und Fergana zugehört. Die von den persischen Dichtern gefeierten vier Paradiese63 waren das anmutige Tal von Soghd bei Samarkand, Maschanrud bei Hamadan, Scha’abi Bowan bei Kal’eh Sofid in Fars, und Ghute, die Ebene von Damaskus. Beiden, Iran und Turan, fehlt indes die Waldnatur und mit ihr das Einsiedlerleben des Walds, welche beide so mächtig auf die Einbildungskraft der indischen Dichter gewirkt haben. Gärten, durch springende Wasser erfrischt, mit Rosengebüsch und Fruchtbäumen gefüllt, ersetzen nicht die wilden, großartigen Naturszenen von Hindostan. Kein Wunder daher, daß die beschreibende Poesie minder lebensfrisch, oft nüchtern und von gekünstelter Zierlichkeit ist. Wenn nach dem Sinn der Eingeborenen das höchste Lob dem gezollt wird, was wir durch die Worte Geist und Witz bezeichnen, so muß die Bewunderung sich auf die Fruchtbarkeit der persischen Dichter, auf die unabsehbare Mannigfaltigkeit der Formen64 beschränken, unter welchem sie denselben Stoff zu behandeln wissen; Tiefe und Innigkeit der Gefühle werden vermißt.
Auch die Schilderung der Landschaft unterbricht nur selten die Erzählung in dem Nationalepos oder geschichtlichen Heldenbuch des Firdusi. Besonders anmutig und von lokaler Wahrheit, die Milde des Klimas und Kraft der Vegetation beschreibend, scheint mir das Lob des Küstenlands Masenderan im Mund eines wandernden Sängers. Der König Kei Kawus wird durch dies Lob zu einem Zug nach dem Kaspischen Meer und zu einer neuen Eroberung angereizt65. Die Frühlingsgedichte von Enweri, Dschelal-eddin Rumi, Adhad und des halbindischen Feisi (der zweite gilt für den größten mystischen Dichter des Orients) atmen ein frisches Leben, da wo der kleinliche Drang nach spielenden Gleichnissen den Genuß nicht unbehaglich stört.66 Sadi im Bostan und Gulistan (Frucht- und Rosengarten), Hafiz, dessen fröhliche Lebensphilosophie man mit der des Horaz verglichen hat, bezeichnen, wie Joseph von Hammer[-Purgstall] in seinem großen Werk über die Geschichte der persischen Dichtung sich ausdrückt, der erste ein Zeitalter der Sittenlehre, der zweite als Minnesänger den höchsten Schwung der Lyrik; aber Schwulst und Ziererei verunstalten oft die Schilderung der Natur67. Der Lieblingsgegenstand der persischen Dichtung, „die Liebe der Nachtigall und der Rose“, kehrt immer ermüdend wieder, und in den konventionellen Künsteleien der Blumensprache erstirbt im Morgenland das innere Naturgefühl.
Wenn wir vom iranischen Hochland durch Turan (im Zend Tûirja)68 nordwärts in die Europa und Asien scheidende Uralkette übergehen, so gelangen wir zum Ursitz des finnischen Stamms: denn der Ural ist ein altfinnisches wie der Altai ein alttürkisches Land. Bei den finnischen Stämmen nun, die sich weit in Westen auf europäischem Boden in der Niederung ansiedelten, hat aus dem Mund der Karelier und der Landleute von Olonez Elias Lönnrot eine große Zahl finnischer Lieder gesammelt, in denen nach dem Ausdruck von Jacob Grimm69 „ein reges sinniges Naturgefühl waltet, wie es fast nur in indischen Dichtungen angetroffen wird“. Ein altes Epos von fast dreitausend Versen dreht sich um den Kampf zwischen Finnen und Lappen und um die Schicksale eines göttlichen Helden, der Vaino genannt wird. Es enthält das Epos eine anmutvolle Beschreibung des finnischen Landlebens, besonders da, wo die Frau des Eisenschmieds Ilmarinen ihre Herden in die Wälder sendet und Gebete zum Schutz der Tiere spricht. Wenige Völkerstämme bieten in ihrer Geistesbildung und in der Richtung ihrer Gefühle, wie sie durch entartende Knechtschaft oder kriegerische Wildheit oder ausdauerndes Streben nach politischer Freiheit bestimmt worden ist, mannigfaltigere und wundersamere Abstufungen dar als der finnische Stamm in seinen sprachverwandten Unterabteilungen. Wir erinnern an jene, jetzt so friedlichen Landleute, bei denen das Epos aufgefunden wurde; an die lange mit Mongolen verwechselten weltstürmenden Hunnen und an ein großes und edles Volk, die Magyaren.
Bei der Betrachtung dessen, was in der Lebendigkeit des Naturgefühls und der Form seiner Äußerungen von der Verschiedenheit der Rassen, vom eigentümlichen Einfluß der Gestaltung des Bodens, von der Staatsverfassung und der religiösen Stimmung abzuhängen scheint, bleibt uns übrig, einen Blick auf die Völker Asiens zu werfen, welche in den arischen oder indogermanischen Stämmen, den Indern und Persern, am meisten kontrastieren. Die semitischen oder aramäischen Nationen zeigen uns in den ältesten und ehrwürdigsten Denkmälern ihrer dichterischen Gemütsart und schaffenden Phantasie Beweise eines tiefen Naturgefühls. Der Ausdruck desselben offenbart sich großartig und belebend in Hirtensagen, in Tempel- und Chorgesängen, im Glanz der lyrischen Poesie unter David, in der Seher- und Prophetenschule, deren hohe Begeisterung der Vergangenheit fast entfremdet, ahnungsvoll auf die Zukunft gerichtet ist.
Die hebräische Dichtungsweise bietet den Bewohnern des Abendlands bei ihrer inneren, erhabenen Größe noch den besonderen Reiz, daß sie mit den lokalen Glaubenserinnerungen der Anhänger von drei weitverbreiteten Religionen, der mosaischen, christlichen und mohammedanischen, vielfach verwebt ist. Durch Missionen, welche der Handelsgeist und die Eroberungssucht schiffahrender Nationen begünstigen, sind geographische Namen und Naturschilderungen des Morgenlands, wie sie die Schriften des alten Bundes uns aufbewahrten, tief in die Wälder der Neuen Welt und in die Inseln der Südsee eingedrungen.
Es ist ein charakteristisches Kennzeichen der Naturpoesie der Hebräer, daß als Reflex des Monotheismus sie stets das Ganze des Weltalls in seiner Einheit umfaßt, sowohl das Erdenleben als die leuchtenden Himmelsräume. Sie weilt seltener beim einzelnen der Erscheinung, sondern erfreut sich der Anschauung großer Massen. Die Natur wird nicht geschildert als ein für sich Bestehendes, durch eigene Schönheit Verherrlichtes; dem hebräischen Sänger erscheint sie immer in Beziehung auf eine höher waltende geistige Macht. Die Natur ist ihm ein Geschaffenes, Angeordnetes, der lebendige Ausdruck der Allgegenwart Gottes in den Werken der Sinnenwelt. Deshalb ist die lyrische Dichtung der Hebräer schon ihrem Inhalt nach großartig und von feierlichem Ernst; sie ist trübe und sehnsuchtsvoll, wenn sie die irdischen Zustände der Menschheit berührt. Bemerkenswert ist auch noch, daß diese Poesie trotz ihrer Größe, selbst im Schwung der höchsten, durch den Zauber der Musik hervorgerufenen Begeisterung, fast nie maßlos wie die indische Dichtung wird. Der reinen Anschauung des Göttlichen hingegeben, sinnbildlich in der Sprache, aber klar und einfach im Gedanken, gefällt sie sich in Gleichnissen, die fast rhythmisch, immer dieselben, wiederkehren.
Als Naturbeschreibungen sind die Schriften des alten Bundes eine treue Abspiegelung der Beschaffenheit des Landes, in welchem das Volk sich bewegte, der Abwechslung von Öde, Fruchtbarkeit und libanotischer Waldbedeckung, die der Boden von Palästina darbietet. Sie schildern die Verhältnisse des Klimas in geregelter Zeitfolge, die Sitten der Hirtenvölker und deren angestammte Abneigung gegen den Feldbau. Die epischen oder historischen Darstellungen sind von naiver Einfachheit, fast noch schmuckloser als Herodot, naturwahr, wie bei so geringer Umwandlung der Sitten und aller Verhältnisse des Nomadenlebens die neueren Reisenden einstimmig es bezeugen. Geschmückter aber und ein reiches Naturleben entfaltend ist die Lyrik der Hebräer. Man möchte sagen, daß in dem einzigen 104. Psalm das Bild des ganzen Kosmos dargelegt ist: „Der Herr, mit Licht umhüllet, hat den Himmel wie einen Teppich ausgespannt. Er hat den Erdball auf sich selbst gegründet, daß er in Ewigkeit nicht wanke. Die Gewässer quellen von den Bergen herab in die Täler zu den Orten, die ihnen beschieden, daß sie nie überschreiten die ihnen gesetzten Grenzen, aber tränken alles Wild des Feldes. Der Lüfte Vögel singen unter dem Laube hervor. Saftvoll stehen des Ewigen Bäume; Libanons Zedern, die der Herr selbst gepflanzt, daß sich das Federwild dort niste und auf Tannen sein Gehäus der Habicht baue.“ Es wird beschrieben „das Weltmeer, in dem es wimmelt von Leben ohne Zahl. Da wandeln die Schiffe, und es regt sich das Ungeheuer, das Du schufest darin zu scherzen“. Es wird „die Saat der Felder, durch Menschenarbeit bestellt, der fröhliche Weinbau und die Pflege der Ölgärten“ geschildert. Die Himmelskörper geben diesem Naturbild seine Vollendung. „Der Herr schuf den Mond, die Zeiten einzuteilen, die Sonne, die das Ziel kennt ihrer Bahn. Es wird Nacht, da schwärmt Gewild umher. Nach Raube brüllen junge Löwen und verlangen Speise von Gott. Erscheint die Sonne, so heben sie sich davon und lagern sich in ihre Höhlen; dann geht der Mensch zu seiner Arbeit, zu seinem Tagewerk bis Abend.“ Man erstaunt, in einer lyrischen Dichtung von so geringem Umfang, mit wenigen großen Zügen, das Universum, Himmel und Erde geschildert zu sehen. Dem bewegten Elementarleben der Natur ist hier des Menschen stilles, mühevolles Treiben vom Aufgang der Sonne bis zum Schluß des Tagewerks am Abend entgegengestellt. Dieser Kontrast, diese Allgemeinheit der Auffassung in der Wechselwirkung der Erscheinungen, dieser Rückblick auf die allgegenwärtige unsichtbare Macht, welche „die Erde verjüngen“ oder in Staub zertrümmern kann, begründen das Feierliche einer minder lebenswarmen und gemütlichen [gemütvollen] als erhaben poetischen Dichtung.
Ähnliche Ansichten des Kosmos kehren mehrmals70 wieder (Psalm 65, 7–14 und 74, 15–17), am vollendetsten vielleicht im 37. Kapitel des alten, wenn auch nicht vormosaischen Buchs ›Hiob‹. Die meteorologischen Prozesse, welche in der Wolkendecke vorgehen, die Formbildung und Auflösung der Dünste bei verschiedener Windrichtung, ihr Farbenspiel, die Erzeugung des Hagels und des rollenden Donners, werden mit individueller Anschaulichkeit beschrieben; auch werden viele Fragen vorgelegt, die unsre heutige Physik [Naturlehre] in wissenschaftlicheren Ausdrücken zu formulieren, aber nicht befriedigend zu lösen vermag. Das Buch ›Hiob‹ wird allgemein für die vollendetste Dichtung gehalten, welche die hebräische Poesie hervorgebracht hat. Es ist so malerisch in der Darstellung einzelner Erscheinungen wie kunstreich in der Anlage der ganzen didaktischen Komposition. In allen modernen Sprachen, in welche das Buch Hiob übertragen worden ist, lassen seine Naturbilder des Orients einen tiefen Eindruck. „Der Herr wandelt auf des Meeres Höhen, auf dem Rücken der vom Sturm aufgetürmten Wellen. – Die Morgenröte erfaßt der Erde Saum und gestaltet mannigfach die Wolkenhülle, wie des Menschen Hand den bildsamen Ton.“ – Es werden die Sitten der Tiere geschildert, des Waldesels und der Rosse, des Büffels, des Nilpferds und der Krokodile, des Adlers und des Straußes. – Wir sehen „den reinen Äther in der Schwüle des Südwindes wie einen gegossenen Spiegel über die dürstende Wüste hingedehnt“.71 Wo die Natur kärglich ihre Gaben spendet, schärft sie den Sinn des Menschen, daß er auf jeden Wechsel im bewegten Luftkreis wie in den Wolkenschichten lauscht, daß er in der Einsamkeit der starren Wüste wie in der des wellenschlagenden Ozeans jedem Wechsel der Erscheinungen bis zu seinen Vorboten nachspürt. Das Klima ist besonders im dürren und felsigen Teil von Palästina geeignet, solche Beobachtungen anzuregen. Auch an Mannigfaltigkeit der Form fehlt es der dichterischen Literatur der Hebräer nicht. Während von Josua bis Samuel die Poesie eine kriegerische Begeisterung atmet, bietet das kleine Buch der ährenlesenden Ruth ein Naturgemälde dar von der naivsten Einfachheit und von unaussprechlichem Reiz. Goethe72 in der Epoche seines Enthusiasmus für das Morgenland nennt es „das lieblichste, das uns episch und idyllisch überliefert worden ist“.
Selbst in den neueren Zeiten, in den ersten Denkmalen der Literatur der Araber, bemerkt man einen schwachen Abglanz der großartigen Naturanschauung, welche dem semitischen Stamm so früh eigentümlich war. Ich erinnere an die malerische Schilderung des beduinischen Wüstenlebens, die der Grammatiker Asmai an den großen Namen Antars knüpft und mit anderen vormohammedanischen Sagen ritterlicher Taten zu einem großen Werk verschmolzen hat. Die Hauptperson dieser romantischen Novelle ist derselbe Antar aus dem Stamm Abs, Sohn des fürstlichen Häuptlings Scheddad und einer schwarzen Sklavin, dessen Verse unter den in der Kaaba aufgehangenen Preisgedichten (moallakât) bewahrt werden. Der gelehrte englische Übersetzer Terrick Hamilton hat selbst schon auf die biblischen Anklänge des Stils im Antar aufmerksam gemacht73. Den Sohn der Wüste läßt Asmai nach Konstantinopel reisen, wodurch ein malerischer Gegensatz von griechischer Kultur und nomadischer Roheit herbeigeführt wird. Daß in der frühesten arabischen Dichtung die Naturschilderung des Bodens nur einen sehr geringen Raum einnimmt, darf nach der Bemerkung eines berühmten Kenners dieses Zweigs der Literatur, meines Freunds Freytag zu Bonn, um so weniger Wunder nehmen, als die Hauptgegenstände der Dichtung Erzählungen von Waffentaten, Lob der Gastfreundschaft und der Liebestreue sind, als fast kein einziger der Sänger aus dem Glücklichen Arabien [= Jemen] stammte. Eine traurige Einförmigkeit von Grasfluren und staubbedeckte Einöden konnten nur in eigentümlichen selteneren Stimmungen das Naturgefühl beleben.
Wo dem Boden der Schmuck der Wälder fehlt, beschäftigen, wie wir bereits früher bemerkten, die Lufterscheinungen, Sturm, Gewitter und langersehnter Regen, um so mehr die Einbildungskraft. Ich erinnere vorzugsweise hier, um naturwahre Bilder dieser Art den arabischen Dichtern zu entlehnen, an Antars ›Moallakât‹, welches die vom Regen befruchtete, vom Schwarm summender Insekten besuchte Flur beschreibt74; an die herrlichen und dazu noch örtlichen Schilderungen des Gewitters von Amru’l Kais und im 7. Buch des berühmten ›Hamasa‹75; endlich an das Anschwellen des Euphrat, wenn der Strom Schilfmassen und Baumstämme in seinen Fluten fortrollt, im ›Nabegha Dhobyani‹76. Das achte Buch der ›Hamasa‹, welches „Reise und Schläfrigkeit“ überschrieben ist, mußte natürlich meine besondere Aufmerksamkeit auf sich lenken. Ich wurde bald belehrt, daß die Schläfrigkeit77 sich nur auf das erste Fragment des Buchs bezieht und auch in diesem um so verzeihlicher ist, als sie einer Nachtreise auf dem Kamel zugeschrieben wird.
Ich habe in diesem Abschnitt fragmentarisch zu entwickeln gesucht, wie die Außenwelt, d.h. der Anblick der belebten und unbelebten Natur, zu verschiedenen Zeitepochen und bei verschiedenen Volksstämmen ungleichartig auf die Gedanken- und Empfindungswelt eingewirkt hat. Aus der Geschichte der Literatur wurde das ausgehoben, was die lebendige Äußerung des Naturgefühls charakterisiert. Es kam dabei, wie in meinem ganzen Werk vom Kosmos, nicht auf Vollständigkeit, sondern nur auf Allgemeinheit der Ansicht,I auf die Auswahl solcher Beispiele an, in denen sich die Eigentümlichkeiten der Zeiten und der Menschenrassen offenbaren. Ich habe die Griechen und Römer geschildert bis zum allmählichen Absterben der Gefühle, die dem klassischen Altertum im Abendland einen unverlöschbaren Glanz gaben; ich habe in den Schriften der christlichen Kirchenväter dem schönen Ausdruck des Naturgefühls nachgespürt, den in stiller Rührung das Einsiedlerleben erzeugte. Bei Betrachtung der indogermanischen Völker (ich nehme die Benennung hier im engeren Sinn des Worts) sind wir übergegangen von den Dichtungen der Deutschen im Mittelalter zu denen der hochgebildeten alten Ostarier (Inder) und der minder begabten Westarier, der Bewohner des alten Iran. Nach einem flüchtigen Blick auf die keltischen (gälischen) Gesänge und ein neuentdecktes finnisches Epos habe ich das reiche Naturleben geschildert, das in einem Zweig des semitischen (aramäischen) Stamms in den erhabenen Gedichten der Hebräer und in denen der Araber atmet. So haben wir die Erscheinungswelt abgespiegelt gesehen in der Phantasie der Völker im Norden und Südosten von Europa, in Vorderasien, in den persischen Hochebenen und dem indischen Tropenland. Um die Natur in ihrer ganzen Größe zu umfassen, glaubte ich sie nach zweierlei Ansichten, einmal objektiv als tatsächliche Erscheinung und dann in den Gefühlen der Menschheit reflektiert, darstellen zu müssen.
Nach dem Hinschwinden aramäischer, griechischer und römischer Herrlichkeit, ich könnte sagen, nach dem Untergang der Alten Welt, zeigt uns der große und begeisterte Schöpfer einer neuen, Dante Alighieri, von Zeit zu Zeit das tiefste Gefühl des irdischen Naturlebens. Er entzieht sich dann den Leidenschaften wie dem Subjektiven seines weiten Ideenkreises, einer ahnungsschweren Mystik. Die Zeitepoche, in der er lebte, folgt unmittelbar der, in welcher diesseits der Alpen der schwäbische Minnegesang, den wir oben geschildert haben, zu verhallen anfing. Unnachahmlich malt Dante am Ende des ersten Gesangs des ›Purgatorio‹78 den Morgenduft und das zitternde Licht des sanft bewegten fernen Meeresspiegels (il tremolar de la marina), im fünften Gesang den Wolkenbruch und das Anschwellen der Flüsse, wobei nach der Schlacht von Campaldino der Leichnam des Buonconte da Montefeltro in den Arno versank79. Der Eingang in den dichten Hain des irdischen Paradieses erinnert den Dichter an den Pinienwald bei Ravenna, „la pineta in sul lito di Chiassi“80, wo in den Wipfeln der Frühgesang der Vögel erschallt. Mit der örtlichen Wahrheit dieses Naturbilds kontrastiert im himmlischen Paradies der Lichtstrom, aus welchem Funken81 sprühen, „die sich in die Blumen des Ufers senken, aber wie von Düften berauscht zurücktauchen in den Strom, während andere sich erheben“. Man möchte glauben, einer solchen Fiktion liege die Erinnerung an den eigentümlichen und selteneren Zustand der Phosphoreszenz des Ozeans zugrunde, wo leuchtende Punkte sich beim Zusammenschlagen der Wellen über der Oberfläche zu erheben scheinen und die ganze flüssige Ebene ein bewegtes Sternenmeer bildet. Die außerordentliche Konzision des Stils vermehrt in der ›Divina Commedia‹ den Ernst und die Tiefe des Eindrucks.
Um noch auf italienischem Boden zu verweilen, aber dem frostigen Schäferroman fremd zu bleiben, nenne ich hier, nach Dante, Petrarcas Trauersonett, den Eindruck schildernd, welchen das anmutige Tal von Vaucluse ihm ohne Laura, seit ihrem Hinsterben, machte; die kleineren Dichtungen des Bojardo, des Freundes des Herkules von Este; und die späteren Stanzen der Vittoria Colonna82.
Als nun die klassische Literatur allgemeiner wieder aufblühte durch den plötzlichen Verkehr mit dem politisch tief gesunkenen Griechenland, finden wir unter den Prosaikern das erste Beispiel reizender Naturbeschreibungen bei dem kunstliebenden Kardinal Bembo, Raphaels Ratgeber und Freund. Seine kleine Jugendschrift ›Aetna dialogus‹ gibt uns ein lebendiges Bild der geographischen Verteilung der Gewächse am Abhang des Gebirges, von Siziliens kornreichen Fluren bis zum schneebedeckten Rand des Kraters. Das vollendete Werk des reiferen Alters, die ›Historiae Venetae‹, charakterisieren auf eine noch mehr malerische Weise das Klima und die Vegetation des Neuen Kontinents.
Alles war damals dazu geeignet, den Geist gleichzeitig mit den großen Bildern des plötzlich erweiterten Weltraums und der Erhöhung menschlicher Kräfte zu erfüllen. Wie im Altertum der makedonische Zug nach dem Paropamisus [= Hindukusch] und den waldreichen Flußtälern von Vorderindien durch den Anblick einer reich geschmückten exotischen Natur Eindrücke zuließ, deren Lebendigkeit sich nach Jahrhunderten noch in den Werken hochbegabter Schriftsteller offenbart, so wirkte zum zweiten Mal, und selbst in einem höheren Maßstab als die Kreuzzüge, auf die westlichen Völker die Entdeckung von Amerika. Die Tropenwelt mit der ganzen Üppigkeit ihrer Vegetation in der Ebene, mit allen Abstufungen des Organismus am Abhang der Cordilleren, mit allen Anklängen nördlicher Klimate in den bewohnten Hochebenen von Mexico, Neu-Granada und Quito wurde nun zuerst den Europäern eröffnet. Die Phantasie, ohne deren Anregung kein wahrhaft großes Werk der Menschheit gedeihen kann, gab den Naturschilderungen von Columbus und Vespucci einen eigentümlichen Reiz. Den letzteren charakterisiert in der Beschreibung der brasilianischen Küste eine genaue Bekanntschaft mit den Dichtern alter und neuer Zeit; jenen in der Beschreibung des milden Himmels von Paria und der (wie er wähnt) dem östlichen Paradies entströmenden Wassermenge des Orinoco eine ernste religiöse Stimmung. Bei zunehmendem Alter, beim Ankämpfen gegen ungerechte Verfolgung ging diese Stimmung in Trübsinn und schwärmerische Begeisterung über.
In den heroischen Zeiten der portugiesischen und kastilianischen Volksstämme führte nicht Golddurst allein (wie man aus Unkunde des damaligen Volkslebens behauptet hat), sondern allgemeine AufregungII zu den Wagnissen ferner Reisen. Die Namen Haiti, Cubagua und Darién wirkten im Anfang des 16. Jahrhunderts auf die Einbildungskraft der Menschen wie in den neueren Zeiten die seit Anson und Cook gefeierten Namen von Tinian und Otaheiti [Tahiti]. Wenn damals die Kunde weit entlegener Länder die Jugend aus der spanischen Halbinsel, aus Flandern, Mailand und Süddeutschland unter die siegreichen Fahnen des großen Kaisers [Karls V.] auf den Rücken der Andenkette oder in die heißen Fluren von Urabá und Coro lockte, so gewann unter dem milden Einfluß späterer Gesittung bei gleichmäßiger Eröffnung aller Teile des Erdraums jenes unruhige Sehnen nach der Ferne andere Motive und eine andere Richtung. Leidenschaftliche Liebe zum Naturstudium, welche hauptsächlich vom Norden ausging, entflammte die Gemüter. Intellektuelle Größe der Ansichten wurde der materiellen Erweiterung des Wissens beigesellt; und die dichterisch sentimentale Stimmung des Zeitalters individualisierte sich seit dem Ende des verflossenen Jahrhunderts in literarischen Werken, deren Formen der Vorzeit unbekannt waren.
Werfen wir noch einmal den Blick zurück in die Zeit der großen Entdeckungen, welche jene moderne Stimmung vorbereiteten, so müssen wir vor allem der Naturschilderungen gedenken, die wir von Columbus selbst besitzen. Erst seit kurzem kennen wir sein eigenes Schiffsjournal; seine Briefe an den Schatzmeister Sanchez, an die Amme des Infanten Don Juan, Frau Juana de la Torre, und an die Königin Isabella. Ich habe schon an einem anderen Ort, in den ›Kritischen Untersuchungen über die Geschichte der Geographie des 15ten und l6ten Jahrhunderts‹83, zu zeigen gesucht, mit welchem tiefen Naturgefühl der große Entdecker begabt war; wie er das Erdenleben und den neuen Himmel, die sich seinem Blick offenbarten (viage nuevo al nuevo cielo y mundo que fasta entonces estaba en occulto), mit einer Schönheit und Einfachheit des Ausdrucks beschrieb, die nur diejenigen ganz zu schätzen vermögen, welche mit der alten Kraft der Sprache jener Zeit vertraut sind.
Die physiognomische Gestaltung der Pflanzen, das undurchdringliche Dickicht der Wälder, „in denen man kaum unterscheiden kann, welche Blüten und Blätter jedem Stamm zugehören“, wie wilde Üppigkeit des krautbedeckten Bodens der feuchten Ufer, die rosenfarbigen Flamingos, welche fischend schon am frühen Morgen die Mündung der Flüsse beleben, beschäftigen den alten Seemann, als er längs den Küsten von Cuba, zwischen den kleinen lucayischen Inseln und den auch von mir besuchten Jardinillos hinfuhr. Jedes neu entdeckte Land scheint ihm noch schöner als das früher beschriebene; er beklagt, nicht Worte zu finden, um die süßen Eindrücke wiederzugeben, die er empfing. Mit der Kräuterkunde völlig unbekannt, wenngleich durch Einfluß arabischer und jüdischer Ärzte sich damals schon einige oberflächliche Kenntnis der Gewächse in Spanien verbreitet hatte, treibt das einfache Naturgefühl den Entdecker an, alles Fremdartige einzeln anzufassen. Er unterscheidet in Cuba schon sieben oder acht verschiedene Palmenarten, die schöner und höher als die Dattelpalme sind (variedades de palmas superiores α las nuestras en su belleza y altura); er meldet seinem geistreichen Freund Anghiera, daß er in derselben Ebene Palmen und Tannen zusammengruppiert, palmeta und pineta wundervoll gemengt gesehen; er betrachtet die Vegetation mit solchem Scharfblick, daß er zuerst bemerkt, es gebe in Cibao auf den Bergen Pinien, deren Früchte nicht Tannenzapfen sind, sondern Beeren wie die Oliven des Ajarafe [= Plateau] de Sevilla. Columbus hat also schon, wie ich bereits oben84 erinnerte, das Geschlecht Podocarpus von der Familie der Abietineen getrennt.
„Die Anmut dieses neuen Landes“, sagt der Entdecker, „steht hoch über der der campiña de Córdoba. Alle Bäume glänzen von immergrünem Laub und sind ewig mit Früchten beladen. Auf dem Boden stehen die Kräuter hoch und blühend. Die Lüfte sind lau wie im April in Kastilien; es singt die Nachtigall süßer, als man es beschreiben kann. Bei Nacht singen wieder süß andere, kleinere Vögel; auch höre ich unseren Grashüpfer und die Frösche. Einmal kam ich in eine tief eingeschlossene Hafenbucht und sah was kein Auge gesehen hat, hohes Gebirge, von dem lieblich die Wasser (lindas aguas) herabströmen. Das Gebirge war bedeckt mit Tannen und anderen vielfach gestalteten, mit schönen Blüten geschmückten Bäumen. Den Strom hinaussteuernd, der in die Bucht mündete, war ich erstaunt über die kühlen Schatten, die kristallklaren Wasser und die Zahl der Singvögel. Es war mir, als möchte ich solch einen Ort nie verlassen, als könnten tausend Zungen dies alles nicht wiedergeben, als weigere sich die verzauberte Hand, es niederzuschreiben (para hacer relacion α los Reyes de las cosas que vian no bastáran mil lenguas α referirlo, ni la mano para lo escribir, que le parecia questaba encantado). “85
Wir lernen hier aus dem Tagebuch eines literarisch ganz ungebildeten Seemanns, welche Macht die Schönheit der Natur in ihrer individuellen Gestaltung auf ein empfängliches Gemüt auszuüben vermag. Gefühle veredeln die Sprache; denn die Prosa des Admirals ist, besonders da, wo er, bereits 67 Jahre alt, auf der vierten Reise seinen großartigen Wundertraums86 an der Küste von Veragua erzählt, wenn auch nicht beredter, doch anregender als der allegorische Schäferroman des Boccaccio und die zwei Arcadien von Saunazaro und Sidney, als Garcilasos ›Salicio y Nemoroso‹ oder die ›Diana‹ des Jorge de Montemayor. Das elegisch-idyllische Element war leider (!) nur zu lange vorherrschend in der italienischen und in der spanischen Literatur. Es bedurfte des lebensfrischen Bildes, in dem Cervantes die Abenteuer des Ritters aus der Mancha darstellte, um die ›Galatea‹ desselben Schriftstellers zu verdunkeln. Der Hirtenroman, so sehr ihn auch bei den eben genannten großen Dichtern Schönheit der Sprache und Zartheit der Empfindungen veredelten, bleibt seiner Natur nach wie die allegorischen Verstandeskünsteleien des Mittelalters frostig und ermüdend. Individualität des Beobachteteten führt allein zur Naturwahrheit in der Darstellung; auch hat man in den herrlichsten beschreibenden Stanzen87 des ›befreiten Jerusalem‹ Eindrücke von der malerischen Umgebung des Dichters, Erinnerungen an die anmutige Landschaft von Sorrent zu erkennen geglaubt.
Jene individuelle Naturwahrheit, die aus eigener Anschauung entspringt, glänzt im reichsten Maß im großen Nationalepos der portugiesischen Literatur. Es weht wie ein indischer Blütenduft durch das ganze unter dem Tropenhimmel (in der Felsgrotte bei Macao und in den Molukken) geschriebene Gedicht. Mir geziemt es nicht, einen kühnen Ausspruch Friedrich Schlegels zu bekräftigen, nach welchem die ›Lusiaden‹ des Camoens „an Farbe und Fülle der Phantasie den Ariost bei weitem übertreffen“88; aber als Naturbeobachter darf ich wohl hinzufügen, daß in den beschreibenden Teilen der ›Lusiaden‹ nie die Begeisterung des Dichters, der Schmuck der Rede und die süßen Laute der Schwermut der Genauigkeit in der Darstellung physischer Erscheinungen hinderlich werden. Sie haben vielmehr, wie dies immer der Fall ist, wenn die Kunst aus ungetrübter Quelle schöpft, den belebenden Eindruck der Größe und Wahrheit der Naturbilder erhöht. Unnachahmlich sind in Camoens die Schilderungen des ewigen Verkehrs zwischen Luft und Meer, zwischen der vielfach gestalteten Wolkendecke, ihren meteorologischen Prozessen und den verschiedenen Zuständen der Oberfläche des Ozeans. Er zeigt uns diese Oberfläche, bald wenn milde Winde sie kräuseln und die kurzen Wellen im Spiel des zurückgeworfenen Lichtstrahls funkelnd leuchten, bald wenn Coelhos und Paul de Gamas Schiffe in einem furchtbaren Sturm gegen die tief aufgeregten Elemente ankämpfen89. Camoens ist im eigentlichen Sinn des Worts ein großer Seemaler. Als Kriegsmann hatte er gefochten am Fuß des Atlas im marokkanischen Gebiet, im Roten Meer und im Persischen Meerbusen; zweimal hatte er das Kap umschifft und, mit tiefem Naturgefühl begabt, 16 Jahre lang am indischen und chinesischen Gestade alle Phänomene des Weltmeers belauscht. Er beschreibt das elektrische St. Elmsfeuer (Kastor und Pollux der alten griechischen Seefahrer): „das lebende Licht90, dem Seevolk heilig“, er beschreibt die gefahrdrohende Trombe in ihrer allmählichen Entwicklung: „wie der Dunst, aus feinem Duft gewoben, sich im Kreise dreht, ein dünnes Rohr herabläßt und die Flut dürstend aufpumpt; wie er, wenn das schwarze Gewölk sich satt gesogen hat, den Fuß des Trichters zurückzieht und zum Himmel fliegend auf der Flucht als süßes Wasser den Wogen wiedergibt, was die Trombe ihnen brausend entzog.“91 Die Schriftgelehrten, sagt der Dichter (und er sagt es fast auch zum Spott der jetzigen Zeit), die Schriftgelehrten mögen versuchen, „der Welt verborgene Wunderdinge zu erklären, da vom Geist allein und von der Wissenschaft geleitet sie so gern für falsch ausgeben, was man aus dem Mund des Schiffers hört, dem einziger Leiter die Erfahrung ist“.
Das naturbeschreibende Talent des begeisterten Dichters weilt aber nicht bloß bei den einzelnen Erscheinungen, es glänzt auch da, wo es große Massen auf einmal umfaßt. Der dritte Gesang schildert mit wenigen Zügen die Gestaltung von Europa92 vom kältesten Norden an bis „zum Lusitanen-Reich [Portugal] und zu der Meerenge, wo Herkules sein letztes Werk getan“. Überall wird auf die Sitten und den Kulturzustand der Völker angespielt, welche den vielgegliederten Weltteil bewohnen. Von den Preußen, Moscovitern und den Stämmen, „que ο Rheno frio lava“, eilt er zu den herrlichen Auen von Hellas: „que creastes os peitos eloquentes, e os juizos de alta phantasia“. Im zehnten Gesang erweitert sich der Blick. Thethys führt den Gama auf einen hohen Berg, um ihm die Geheimnisse des Weltbaues (machina do mundo) und der Planeten Lauf (nach Ptolemäischen Ansichten) zu enthüllen93. Es ist ein Traumgesicht im Stil des Dante, und da die Erde das Zentrum des Bewegten bildet, so wird zuletzt bei Beschreibung des Erdglobus die ganze Kenntnis der damals erforschten Länder und ihrer Erzeugnisse dargelegt94. Es gilt hier nicht mehr Europa allein zu schildern, wie früher im dritten Gesang, alle Erdteile werden durchmustert, selbst das Land des heiligen Kreuzes (Brasilien) und die Küsten werden genannt, die Magellan entdeckte: „durch die Tat, aber nicht durch die Treue ein Sohn Lusitaniens“.
Wenn ich vorher Camoens. vorzugsweise als Seemaler rühmte, so war es, um anzudeuten, daß das Erdenleben ihn minder lebhaft angezogen hat. Schon Sismondi bemerkt mit Recht, daß das ganze Gedicht keine Spur von etwas Anschaulichem über die tropische Vegetation und ihre physiognomische Gestaltung enthält. Nur die Aromen und nützlichen Handelsprodukte werden bezeichnet. Die Episode der Zauberinsel95 bietet freilich das reizendste Gemälde einer Landschaft dar; aber die Pflanzendecke ist gebildet, wie eine Ilha de Venus es erfordert, von „Myrten, dem Zitrusbaum, duftenden Limonen und Granaten“, alle dem Klima des südlichen Europa angeeignet. Beim größten der damaligen Seefahrer, Christoph Columbus, finden wir mehr Freude an den Küstenwäldern, mehr Aufmerksamkeit auf die Formen des Gewächsreichs; aber Columbus schreibt ein Reisejournal und verzeichnet in diesem die lebendigen Eindrücke jedes Tags, während das Epos des Camoens die Großtaten der Portugiesen verherrlicht. Pflanzennamen den Sprachen der Eingeborenen zu entlehnen und sie in die Beschreibung einer Landschaft einzuflechten, in der sich wie vor einem Hintergrund die Handelnden bewegen, konnte den an harmonische Klänge gewöhnten Dichter wenig reizen.
Neben der ritterlichen Gestalt des Camoens hat man oft die ebenso romantische eines spanischen Kriegers aufgestellt, der unter dem großen Kaiser [Karl V.] in Peru und Chile diente und unter jenen Himmelsstrichen die Taten besang, an denen er rühmlichst teilgenommen. Im ganzen Epos der ›Araucana‹ des Don Alonso de Ercilla hat die unmittelbare Anschauung, der Anblick mit ewigem Schnee bedeckter Vulkane, heißer Waldtäler und weit ins Land eindringender Meeresarme fast nichts hervorgebracht, was man darstellend nennen könnte. Das übermäßige Lob, welches Cervantes bei Gelegenheit der geistreich satirischen Bücherschau des Quijote dem Ercilla gespendet hat, ist wohl nur durch leidenschaftliche Rivalität zwischen der spanischen und italienischen Poesie hervorgerufen worden. Man möchte fast sagen, es habe Voltaire und viele neuere Kritiker irregeführt. Die ›Araucana‹ ist allerdings ein Werk, welches ein edles Nationalgefühl durchdringt; die Schilderung der Sitten eines wilden Volksstamms, der im Kampf für die Freiheit des Vaterlands erliegt, ist darin nicht ohne Leben, aber die Diktion des Ercilla ist schleppend, mit Eigennamen überhäuft, ohne alle Spur dichterischer Begeisterung96.
Diese Begeisterung findet sich in mehreren Strophen des ›Romancero caballeresco‹97; in der religiösen Melancholie des Fray Luis de León z.B. in seiner „heiteren Nacht“, wenn er die ewigen Lichter (resplandores eternales) des gestirnten Himmels besingt98; und in den großen Schöpfungen des Calderón. „Als sich die Komödie der Spanier bis zu einer hohen Vollendung ausgearbeitet hatte“, sagt der tiefste Forscher aller dramatischen Literatur, mein edler Freund Ludwig Tieck, „finden wir oft bei Calderón und bei seinen Zeitgenossen in romanzen- und canzonartigen Silbenmaßen blendend schöne Schilderungen vom Meer, von Gebirgen, Gärten und waldigen Tälern, doch fast immer mit allegorischen Beziehungen und mit einem künstlichen Glanz übergossen, der uns nicht sowohl die freie Luft der Natur, die Wahrheit des Gebirges, die Schatten der Täler fühlen läßt, als daß in harmonischen, wohlklingenden Versen eine geistvolle Beschreibung gegeben wird, die mit kleinen Nuancen immer wiederkehrt.“ Im Schauspiel ›Das Leben ein Traum‹ (›La vida es sueño‹) läßt Calderón den Prinzen Sigismund das Unglück seiner Gefangenschaft in anmutigen Gegensätzen mit der Freiheit der ganzen organischen Natur beklagen. Es werden geschildert die Sitten der Vögel, „die im weiten Himmelsraum sich in raschen Flügen regen“; die Fische, „welche, kaum aus Laich und Schlamm entsprossen, schon das weite Meer suchen, dessen Unendlichkeit ihnen bei ihren kecken Zügen nicht zu genügen scheint. Selbst dem Bach, der im Ringelgang zwischen Blüten hingleitet, gewährt die Flur einen freien Pfad.“ „Und ich“, ruft Sigismund verzweiflungsvoll aus, „der mehr Leben hat, soll bei freierem Geiste mich in mindre Freiheit fügen!“ Auf ähnliche Weise, aber auch oft durch Antithesen, witzige Gleichnisse und Künsteleien aus Góngoras Schule verunstaltet, spricht im ›Standhaften Prinzen‹ Don Fernando zum Könige von Fez99. Wir erinnern an die einzelnen Beispiele, weil sie zeigen, wie in der dramatischen Dichtung, die es vornehmlich mit Begebenheiten, Leidenschaften und Charakteren zu tun hat, „die Beschreibungen nur Abbildungen des Gemüts, der Stimmung der handelnden Personen werden. Shakespeare, der im Drang seiner bewegten Handlung fast nie Zeit und Gelegenheit hat, sich auf Naturschilderungen geflissentlich einzulassen, malt durch Vorfälle, Andeutungen und Gemütsbewegung der Handelnden Landschaft und Natur, daß wir sie vor uns zu sehen glauben und in ihr zu leben scheinen. So leben wir in der ›Sommernacht‹ im Wald, sehen wir in den letzten Szenen des ›Kaufmanns von Venedig‹ den Mondschein, welcher eine warme Sommernacht erhellt, ohne daß beide geschildert werden. Eine wirkliche Naturbeschreibung ist aber die der Doverklippe im ›König Lear‹, wo der sich wahnsinnig stellende Edgar seinem blinden Vater Gloster, auf der Ebene gehend, vorbildet, sie erstiegen die Klippe. Schwindelerregend ist die Schilderung des Blicks in die Tiefe von oben hinab.“100
Wenn in Shakespeare innere Lebendigkeit der Gefühle und großartige Einfachheit der Sprache die Anschaulichkeit und den individuellen Naturausdruck so wundervoll beleben, so ist in Miltons erhabener Dichtung ›Das verlorene Paradies‹ dem Wesen einer solchen Komposition nach das Beschreibende mehr prachtvoll als darstellend. Der ganze Reichtum der Phantasie und der Sprache ist auf die Schilderung der blühenden Natur des Paradieses ausgegossen; aber hier wie in Thomsons lieblichem Lehrgedicht der ›Jahreszeiten‹ hat die Schilderung der Vegetation nur in allgemeinen, unbestimmteren Umrissen entworfen werden können. Nach dem Urteil tiefer Kenner der indischen Dichtkunst individualisiert zwar Kalidasas ähnliches indisches Gedicht ›Ritusanhara‹, das weit über anderthalbtausend Jahre älter ist, die kräftige Tropennatur mit größerer Lebendigkeit; es entbehrt aber der Anmut, welche in Thomson aus der den höheren Breiten eigenen vielfacheren Scheidung der Jahreszeiten, aus den Übergängen des obstreichen Herbstes zum Winter und des Winters zum wiederbelebenden Frühling, aus der Schilderung des arbeitsamen oder heiteren Treibens der Menschen in jedem Teil des Jahres entspringt.
Gehen wir zu der uns näheren Zeit über, so bemerken wir, daß seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sich vorzugsweise die darstellende Prosa in eigentümlicher Kraft entwickelt hat. Wenn auch bei dem nach allen Seiten hin erweiterten Naturstudium die Masse des Erkannten übermäßig angewachsen ist, so hat sie darum doch nicht bei den wenigen, die einer hohen Begeisterung fähig sind, die intellektuelle Anschauung unter dem materiellen Gewicht des Wissens erdrückt. Diese intellektuelle Anschauung (das Werk dichterischer Spontaneität) hat vielmehr selbst an Umfang und an Erhabenheit des Gegenstands zugenommen, seitdem die Blicke tiefer in den Bau der Gebirge (der geschichteten Grabstätte untergegangener Organisationen), in die geographische Verbreitung der Tiere und Pflanzen, in die Verwandtschaft der Menschenstämme eingedrungen sind. So haben zuerst durch Anregung der Einbildungskraft mächtig auf die Belebung des Naturgefühls, den Kontakt mit der Natur und den davon unzertrennlichen Trieb zu fernen Reisen gewirkt: in Frankreich Jean Jacques Rousseau, Buffon, Bernardin de St. Pierre und, um hier ausnahmsweise einen noch lebenden Schriftsteller zu nennen, mein vieljähriger Freund August von Chateaubriand, in den Britischen Inseln der geistreiche Playfair, in Deutschland Cooks Begleiter auf seiner zweiten Weltumsegelung, der beredte und dabei jeder Verallgemeinerung der Naturansicht glücklich zugewandte Georg Forster.
Es muß diesen Blättern fremd bleiben zu untersuchen, was jeden dieser Schriftsteller charakterisiert, was in ihren überall verbreiteten Werken den Schilderungen der Landschaft Reiz und Anmut verleiht, was die Eindrücke stört, die sie hervorrufen wollten; aber einem Reisenden, welcher sein Wissen hauptsächlich der unmittelbaren Anschauung der Welt verdankt, wird es erlaubt sein, hier einige zerstreute Betrachtungen über einen jüngeren und im ganzen wenig bearbeiteten Teil der Literatur einzuschalten. Buffon, großartig und ernst, Planetenbau, Organisation, Licht und magnetische Kraft gleichzeitig umfassend, in physikalischen Untersuchungen weit gründlicher, als es seine Zeitgenossen wähnten, ist, wenn er von den Sitten der Tiere zur Beschreibung des Landschaftlichen übergeht, in kunstreichem Periodenbau mehr rhetorisch pomphaft als individualisierend wahr, mehr zur Empfänglichkeit des Erhabenen stimmend, als das Gemüt durch anschauliche Schilderung des wirklichen Naturlebens gleichsam durch Anklang der Gegenwart ergreifend. Man fühlt selbst in den mit Recht bewunderten Versuchen dieser Art, daß er Mitteleuropa nie verließ, daß ihm die eigene Ansicht der Tropenwelt fehlt, die er zu beschreiben glaubt. Was wir aber besonders in den Werken dieses großen Schriftstellers vermissen, ist die harmonische Verknüpfung der Darstellung der Natur mit dem Ausdruck der angeregten Empfindung; es fehlt fast alles, was der geheimnisvollen Analogie zwischen den Gemütsbewegungen und den Erscheinungen der Sinnenwelt entquillt.
Größere Tiefe der Gefühle und ein frischerer Lebensgeist atmen in Jean Jacques Rousseau, in Bernardin de St. Pierre und in Chateaubriand. Wenn ich hier der hinreißenden Beredsamkeit des ersten, der malerischen Szenen von Ciarens und Meillerie am Leman-See [Genfer See] erwähne, so ist es, weil in den Hauptwerken des wenig gelehrten, aber eifrigen Pflanzensammlers (sie sind um zwanzig Jahre älter als Buffons phantasiereiche Weltepochen101) die Begeisterung sich hauptsächlich in der innersten Eigentümlichkeit der Sprache offenbart, ja in der Prosa ebenso überströmend ausbricht wie in Klopstocks, Schillers, Goethes und Byrons unsterblichen Dichtungen. Auch da, wo nichts beabsichtigt wird, was unmittelbar an das Studium der Natur geknüpft ist, kann doch unsere Liebe zu diesem Studium durch den Zauber einer poetischen Darstellung des Naturlebens, sei es auch in den engsten, uns wohlbekannten Erdräumen, erhöht werden.
Indem wir zu den Prosaikern wieder zurückkehren, verweilen wir gern bei der kleinen Schöpfung, welcher Bernardin de St. Pierre den schöneren Teil seines literarischen Ruhms verdankt. ›Paul und Virginias ein Werk, wie es kaum eine andere Literatur aufzuweisen hat, ist das einfache Naturbild einer Insel mitten im tropischen Meer, wo, bald von der Milde des Himmels beschirmt, bald vom mächtigen Kampf der Elemente bedroht, zwei anmutvolle Gestalten in der wilden Pflanzenfülle des Waldes sich malerisch wie von einem blütenreichen Teppich abheben. Hier und in der ›Chaumière indienne‹, ja selbst in den ›Études de la Nature‹, welche leider durch abenteuerliche Theorien und physikalische Irrtümer verunstaltet werden, sind der Anblick des Meeres, die Gruppierung der Wolken, das Rauschen der Lüfte in den Bambusgebüschen, das Wogen der hohen Palmengipfel mit unnachahmlicher Wahrheit geschildert. Bernardin de St. Pierres Meisterwerk ›Paul und Virginia‹ hat mich in die Zone begleitet, der es seine Entstehung verdankt. Viele Jahre lang ist es von mir und meinem teuren Begleiter und Freund Bonpland gelesen worden; dort nun (man verzeihe den Anruf an das eigene Gefühl) im stillen Glanz des südlichen Himmels, oder wenn in der Regenzeit am Ufer des Orinoco der Blitz krachend den Wald erleuchtete, wurden wir beide von der bewundernswürdigen Wahrheit durchdrungen, mit der in jener kleinen Schrift die mächtige Tropennatur in ihrer ganzen Eigentümlichkeit dargestellt ist. Ein solches Auffassen des einzelnen, ohne dem Eindruck des Allgemeinen zu schaden, ohne dem zu behandelnden äußeren Stoff die freie innere Belebung dichterischer Phantasie zu rauben, charakterisiert in einem noch höheren Grad den geistreichen und gefühlvollen Verfasser von ›Atala‹, ›Rene‹, der ›Märtyrer‹ und der ›Reise nach Griechenland und Palästina In seinen Schöpfungen sind alle Kontraste der Landschaft in den verschiedenartigsten Erdstrichen mit wundervoller Anschaulichkeit zusammengedrängt. Die ernste Größe historischer Erinnerungen konnte allein den Eindrücken einer schnellen Reise Tiefe und Ruhe verleihen.
In unserem deutschen Vaterland hat sich das Naturgefühl wie in der italienischen und spanischen Literatur nur zu lange in der Kunstform des Idylls, des Schäferromans und des Lehrgedichts offenbart. Auf diesem Weg wandelten oft der persische Reisende Paul Fleming, Brockes, der gefühlvolle Ewald von Kleist, Hagedorn, Salomon Geßner und einer der größten Naturforscher aller Zeiten, Haller, dessen lokale Schilderungen wenigstens bestimmtere Umrisse und eine mehr objektive Wahrheit des Kolorits darbieten. Das elegisch-idyllische Element beherrschte damals eine schwermütige Landschaftspoesie; und die Dürftigkeit des Inhalts konnte, selbst in Voß, dem edlen und tiefen Kenner des klassischen Altertums, nicht durch eine höhere und glückliche Ausbildung der Sprache verhüllt werden. Erst als das Studium der Erdräume an Tiefe und Mannigfaltigkeit gewann, als die Naturwissenschaften sich nicht mehr auf tabellarische Aufzählungen seltsamer Erzeugnisse beschränkten, sondern sich zu den großartigen Ansichten einer vergleichenden Länderkunde erhoben, konnte jene Ausbildung der Sprache zu lebensfrischen Bildern ferner Zonen benutzt werden.
Die älteren Reisenden des Mittelalters wie John Mandeville (?)III, Hans Schiltberger aus München (1394–1427) und Bernhard von Breydenbach (1483) erfreuen uns noch heute durch eine liebenswürdige Naivität, durch ihre Freiheit der Rede, durch die Sicherheit, mit welcher sie vor einem Publikum auftreten, das ganz unvorbereitet und darum um so neugieriger und leichtgläubiger zuhört, weil es sich noch nicht zu schämen gelernt hat, ergötzt oder gar erstaunt zu scheinen. Das Interesse der Reisen war damals fast ganz dramatisch, ja die notwendige und dazu so leichte Einmischung des Wunderbaren gab ihnen beinahe eine epische Färbung. Die Sitten der Völker werden minder beschrieben, als sie sich durch den Kontakt des Reisenden mit den Eingeborenen anschaulich machen. Die Vegetation bleibt namenlos und unbeachtet, wenn nicht hier und da einer sehr angenehmen oder seltsam gestalteten Frucht oder einer außerordentlichen Dimension von Stamm und Blättern gedacht wird. Unter den Tieren werden zunächst die menschenähnlichen, dann die reißenden, gefahrbringenden mit besonderer Vorliebe beschrieben. Die Zeitgenossen des Reisenden glaubten noch an alle Gefahren, die in solchen Klimaten wenige unter ihnen teilten; ja die Langsamkeit der Schiffahrt und der Mangel an Verbindungsmitteln ließ die indischen Länder (so nannte man die ganze Tropenzone) wie in einer unabsehbaren Ferne erscheinen. Columbus102 hatte noch nicht das Recht gehabt, der Königin Isabella zu schreiben: „Die Erde ist gar nicht groß, viel kleiner, denn das Volk es wähnt.“
In Hinsicht auf Komposition hatten demnach die vergessenen Reisen des Mittelalters, die wir hier schildern, bei aller Dürftigkeit des Materials viele Vorzüge vor unseren meist neueren Reisen. Sie hatten die Einheit, welche jedes Kunstwerk erfordert; alles war an eine Handlung geknüpft, alles der Reisebegebenheit selbst untergeordnet. Das Interesse entstand aus der einfachen, lebendigen, meist für glaubwürdig gehaltenen Erzählung überwundener Schwierigkeiten. Christliche Reisende, unbekannt mit dem, was Araber, spanische Juden und buddhistische Missionare vor ihnen taten, rühmten sich, alles zuerst gesehen und beschrieben zu haben. Bei der Dunkelheit, in welche der Orient und Innerasien gehüllt erschienen, vermehrte die Ferne selbst die Größe einzelner Gestalten. Eine solche Einheit der Komposition fehlt meist den neueren Reisen, besonders denen, welche wissenschaftliche Zwecke verfolgen. Die Handlung steht dann den Beobachtungen nach, sie verschwindet in der Fülle derselben. Nur mühselige, wenngleich wenig belehrende Bergbesteigungen und vor allem kühne Seefahrten, eigentliche Entdeckungsreisen in wenig erforschten Meeren oder der Aufenthalt in der schauervollen Öde der beeisten Polarzone gewähren ein dramatisches Interesse wie die Möglichkeit einer individualisierenden Darstellung. Die Einsamkeit der Umgebung und die hilflose Abgeschiedenheit der Seefahrer isolieren dann das Bild und wirken um so anregender auf die Einbildungskraft.
Wenn es nun nach den vorliegenden Betrachtungen unleugbar ist, daß in den neueren Reisebeschreibungen das Element der Handlung in den Hintergrund tritt, daß sie der größeren Zahl nach nur ein Mittel geworden sind, Natur- und Sittenbeobachtungen der Zeitfolge nach aneinander zu ketten, so bieten sie dagegen für diese teilweise Entfärbung einen vollen Ersatz durch den Reichtum des Beobachteten, die Größe der Weltansicht und das rühmliche Bestreben, die Eigentümlichkeit jeder vaterländischen Sprache zu anschaulichen Darstellungen zu benutzen. Was die neuere Kultur uns brachte, ist die unausgesetzt fortschreitende Erweiterung unseres Gesichtskreises, die wachsende Fülle von Ideen und Gefühlen, die tätige Wechselwirkung beider. Ohne den heimatlichen Boden zu verlassen, sollen wir nicht bloß erfahren können, wie die Erdrinde in den entferntesten Zonen gestaltet ist, welche Tierund Pflanzenformen sie beleben; es soll uns auch ein Bild verschafft werden, das wenigstens einen Teil der Eindrücke lebendig wiedergibt, welche der Mensch in jeglicher Zone von der Außenwelt empfängt. Dieser Anforderung zu genügen, diesem Bedürfnis einer Art geistiger Freuden, welche das Altertum nicht kannte, arbeitet die neuere Zeit entgegen; die Arbeit gelingt, weil sie das gemeinsame Werk aller gebildeten Nationen ist, weil die Vervollkommnung der Bewegungsmittel auf Meer und Land die Welt zugänglicher, ihre einzelnen Teile in der weitesten Ferne vergleichbarer macht.
Ich habe hier die Richtung zu bezeichnen versucht, in welcher das Darstellungsvermögen des Beobachters, die Belebung des naturbeschreibenden Elements und die Vervielfältigung der Ansichten auf dem unermeßlichen Schauplatz schaffender und zerstörender Kräfte als Anregungs- und Erweiterungsmittel des wissenschaftlichen Naturstudiums auftreten können. Der Schriftsteller, welcher in unsrer vaterländischen Literatur nach meinem Gefühl am kräftigsten und am gelungensten den Weg zu dieser Richtung eröffnet hat, ist mein berühmter Lehrer und Freund Georg Forster gewesen. Durch ihn begann eine neue Ära wissenschaftlicher Reisen, deren Zweck vergleichende Völker- und Länderkunde ist. Mit einem feinen ästhetischen Gefühl begabt, in sich bewahrend die lebensfrischen Bilder, welche auf Tahiti und anderen, damals glücklicheren Eilanden der Südsee eine Phantasie (wie neuerlichst wieder die von Charles Darwin103) erfüllt hatten, schilderte Georg Forster zuerst mit Anmut die wechselnden Vegetationsstufen, die klimatischen Verhältnisse, die Nahrungsstoffe in Beziehung auf die Gesittung der Menschen nach Verschiedenheit ihrer ursprünglichen Wohnsitze und ihrer Abstammung. Alles, was der Ansicht einer exotischen Natur Wahrheit, Individualität und Anschaulichkeit gewähren kann, findet sich in seinen Werken vereint. Nicht etwa bloß in seiner trefflichen Beschreibung der zweiten Reise des Kapitän Cook, mehr noch in den ›Kleinen Schriften‹ liegt der Keim zu viel Großem, das die spätere Zeit zur Reife gebracht hat104. Aber auch dieses so edle, gefühlreiche, immer hoffende Leben durfte kein glückliches sein!
Hat man die Naturschilderungen, deren sich die neuere Zeit vorzüglich in der deutschen, französischen, englischen und nordamerikanischen Literatur erfreut, mit den Benennungen „beschreibender Poesie und Landschaftsdichtung“ tadelnd belegt, so bezeichnen diese Benennungen wohl nur den Mißbrauch, welcher vermeintlichen Grenzerweiterungen des Kunstgebiets Schuld gegeben wird. Dichterische Beschreibungen von Naturerzeugnissen, wie sie am Ende einer langen und rühmlichen Laufbahn Delille geliefert hat, sind bei allem Aufwand verfeinerter Sprachkunst und Metrik keineswegs als Naturdichtungen im höheren Sinn des Worts zu betrachten. Sie bleiben der Begeisterung und damit dem poetischen Boden fremd, sind nüchtern und kalt wie alles, was nur durch äußere Zierde glänzt. Wenn demnach die sogenannte „beschreibende Poesie“ als eine eigene, für sich bestehende Form der Dichtung mit Recht getadelt worden ist, so trifft eine solche Mißbilligung gewiß nicht ein ernstes Bestreben, die Resultate der neueren inhaltsreicheren Weltbetrachtung durch die Sprache, d.h. durch die Kraft des bezeichnenden Wortes, anschaulich zu machen. Sollte ein Mittel unangewandt bleiben, durch welches uns das belebte Bild einer fernen, von anderen durchwanderten Zone, ja ein Teil des Genusses verschafft werden kann, den die unmittelbare Naturanschauung gewährt? Die Araber sagen105 figürlich und sinnig, die beste Beschreibung sei die, „in welcher das Ohr zum Auge umgewandelt wird“. Es gehört in die Leiden der Gegenwart, daß ein unseliger Hang zu inhaltloser poetischer Prosa, zu der Leere sogenannter gemütvoller Ergüsse gleichzeitig in vielen Ländern verdienstvolle Reisende und naturhistorische Schriftsteller ergriffen hat. Verirrungen dieser Art sind um so unerfreulicher, wenn der Stil aus Mangel literarischer Ausbildung, vorzüglich aber aus Abwesenheit aller inneren Anregung in rhetorische Schwülstigkeit und trübe Sentimentalität ausartet.
Naturbeschreibungen, wiederhole ich hier, können scharf umgrenzt und wissenschaftlich genau sein, ohne daß ihnen darum der belebende Hauch der Einbildungskraft entzogen bleibt. Das Dichterische muß aus dem geahnten Zusammenhang des Sinnlichen mit dem Intellektuellen, aus dem Gefühl der Allverbreitung, der gegenseitigen Begrenzung und der Einheit des Naturlebens hervorgehen. Je erhabener die Gegenstände sind, desto sorgfältiger muß der äußere Schmuck der Rede vermieden werden. Die eigentümliche Wirkung eines Naturgemäldes ist in seiner Komposition begründet; jede geflissentliche Anregung von Seiten dessen, der es aufstellt, kann nur störend sein. Wer, mit den großen Werken des Altertums vertraut, in sicherem Besitz des Reichtums seiner Sprache einfach und individualisierend wiederzugeben weiß, was er durch eigene Anschauung empfing, wird den Eindruck nicht verfehlen; er wird es um so weniger, als er, die äußere, ihn umgebende Natur und nicht seine eigene Stimmung schildernd, die Freiheit des Gefühls in anderen unbeschränkt läßt.
Aber nicht die lebendige Beschreibung jener reich geschmückten Länder der Äquinoctialzone allein, in welcher Intensität des Lichts und feuchte Wärme die Entwicklung aller organischen Keime beschleunigen und erhöhen, hat in unseren Tagen dem gesamten Naturstudium einen mächtigen Reiz verschafft. Der geheime Zauber, durch den ein tiefer Blick in das organische Leben anregend wirkt, ist nicht auf die Tropenwelt allein beschränkt. Jeder Erdstrich bietet die Wunder fortschreitender Gestaltung und Gliederung nach wiederkehrenden oder leise abweichenden Typen dar. Allverbreitet ist das furchtbare Reich der Naturmächte, welche den uralten Zwist der Elemente in der wolkenschweren Himmelsdecke wie im zarten Gewebe der belebten Stoffe zu bindender Eintracht lösen. Darum können alle Teile des weiten Schöpfungskreises vom Äquator bis zur kalten Zone, überall wo der Frühling eine Knospe entfaltet, sich einer begeisternden Kraft auf das Gemüt erfreuen. Zu einem solchen Glauben ist unser deutsches Vaterland vor allem berechtigt. Wo ist das südlichere Volk, welches uns nicht um den großen Meister der Dichtung beneiden sollte, dessen Werke alle ein tiefes Gefühl der Natur durchdringt: in den ›Leiden des jungen Werther‹ wie in den Erinnerungen an Italien, in der Metamorphose der Gewächse wie in seinen Vermischten Gedichten? Wer hat beredter seine Zeitgenossen angeregt, „des Weltalls heilige Rätsel zu lösen“, das Bündnis zu erneuern, welches im Jugendalter der Menschheit Philosophie, Physik und Dichtung mit einem Band umschlang, wer hat mächtiger hingezogen in das ihm geistige heimische Land, wo
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht?