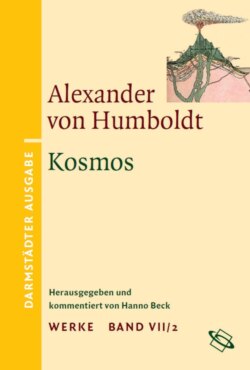Читать книгу Werke - Alexander Humboldt - Страница 13
Оглавление1 Kosmos, Bd. I, S. 43.
2 Die Formen des Kontinents von Italien, Sizilien, Griechenland, dem Kaspischen und Roten Meer. S. meine Relation Historique, Τ. Ι, p. 208.
3 Dante, Purg. I, 25–28:
Goder pareva il ciel di lor fiammelle:
Ο settentrional vedovo sito,
Poi che privato se’ de mirar quelle!
4 Schillers sämmtliche Werke, 1826, Bd. XVIII. S. 231, 473, 480 und 486; Gervinus, Neuere Gesch. der poet. National-Litteratur der Deutschen, 1840, Th. I, S. 135; Adolph Becker im Charikles, Th. I, S. 219. Vergleiche aber damit Eduard Müller, Über Sophokleische Naturanschauung und die Tiefe Naturempfindung der Griechen, 1842, S. 10 und 26.
5 Schnaase, Geschichte der bildenden Künste bei den Alten, Bd. II, 1843, S. 128–138.
6 Plut., De EI apud Delphos, cap. 9. Vgl. über eine Stelle des Apollonius Dyscolus aus Alexandrien (Mirab. Hist., cap. 40) die letzte Schrift von Otfr. Müller: Gesch. der griech. Litteratur, Bd. I, 1845, S. 31.
7 Hesiodi Opera et Dies, v. 502–561; Göttling in Hes. Carm., 1831, p. XIX; Ulrici, Gesch. der hellenischen Dichtkunst, Th. I, 1835, S. 337; Bernhardy, Grundriß der griech. Litteratur, Th. II, S. 176; doch nach dem Ausspruch von Gottfr. Hermann (Opuscula, Vol. VI, p. 239) „trägt des Hesiodus malerische Beschreibung des Winters alle Zeichen eines hohen Alterthums“.
8 Hes. Theog., v. 233–264. Auch die Nereide Mära (Od. XI, 326; II. XVIII, 48) soll vielleicht das phosphorische Leuchten der Meeresfläche ausdrücken, wie derselbe Name μαρα den funkelnden Hundsstern (Sirius) bezeichnet.
9 Vgl. Jacobs, Leben und Kunst der Alten, Bd. I, Abth. 1, S. VII.
10 Ilias VIII, 555–559; IV, 452–455; XI, 115–199. Vgl. auch im Eingang der Heerschau die gehäuften, aber lebensvollen Schilderungen der Tierwelt II, 458–475.
11 Od. XIX, 431–445; VI, 290; IX, 115–199. Vgl. „des grünenden Haines Umschattung“ bei der Felsengrotte der Kalypso: „wo ein Unsterblicher selbst würde bewunderungsvoll weilen und sich herzlich erfreuen des Anblicks“: V, 55–73; die Brandung im Land der Phäaken V, 400–442; die Gärten des Alcinous VII, 113–130. – Über den Frühlingsdithyrambus des Pindaros s. Böckh, Pindari Opera, Τ. II, Ρ 2, pp. 575–579.
12 Oed. in Kolonos, v. 668–719. Als Beschreibungen der Landschaft, in denen sich ein tiefes Naturgefühl offenbart, muß ich hier noch erwähnen die Schilderung des Cithäron in Euripides, Bacchen, v. 1045 (Leake, North Greece, Vol. II, p. 370), wo der Bote aus dem Asopostal aufsteigt, den Sonnenaufgang im Delphischen Tal bei Euripides, Ion, v. 82; den Anblick der heiligen Delos, mit trüben Farben gemalt: „von Möwen umflattert, von stürmischen Wellen gegeißelt“, bei Kallimachus im Hymnos auf Delos, v. 11.
13 Nach Strabo (lib. VIII, pag. 366 Casaub.), wo er den Tragiker wegen einer geographisch unrichtigen Begrenzung von Elis anklagt. Die schöne Stelle des Euripides ist aus dem ›Kresphontes‹, und die Beschreibung der Trefflichkeit Messenes stand mit der Exposition der politischen Verhältnisse (der Teilung der Länder unter die Herakliden) in genauer Verbindung. Die Naturschilderung war also auch hier, wie Böckh scharfsinnig bemerkt, an menschliche Verhältnisse geknüpft.
14 Meleagri Reliquiae, ed. Manso, p. 5. Vgl. Jacobs, Leben und Kunst der Alten, Bd. 1, Abth. 1, S. XV, Abth. 2, S. 150–190. Das Frühlingsgedicht des Meleager glaubte Zenobetti (Mel. Gardareni in Ver Idyllion, 1759, p. 5) um die Mitte des 18. Jahrhunderts zuerst entdeckt zu haben. S. Brunckii, Anal., T. III, p. 105. – Zwei schöne Waldgedichte des Marianos stehen in der ›Anthol. graeca‹ II, 511 und 512. Mit dem Meleager kontrastriert das Lob des Frühlings in den Eklogen des Himerius, eines Sophisten, der unter Julian Lehrer der Rhetorik zu Athen war. Der Stil ist im ganzen kalt und geziert; aber im einzelnen, besonders in der beschreibenden Form kommt er bisweilen der modernen Weltanschauung sehr nahe. Himerii Sophistae Eclogae et Declamationes, ed. Wernsdorf, 1790 (Oratio III, 3–6 und XXI, 5). Man muß sich wundern, daß die herrliche Lage von Konstantinopel den Sophisten gar nicht begeistert habe (Orat. VII,5–7; XVI,3–8). – Die im Text bezeichneten Stellen des Nonnus finden sich Dionys., ed. Petri Cunaei, 1610, lib. II, p. 70, VI p. 199, XXIII pp. 16 und 619, XXVI p. 694. (Vgl. auch Ouwaroff, Nonnos von Panopolis, der Dichter, 1817, S. 3, 16 und 21.)
15 Aeliani Var. Hist. et Fragm. lib. III, cap. 1, pag. 139 Kühn. Vgl. A. Buttmann, Quaest. de Dicaearcho (Naumb. 1832), p. 32 und Geogr. gr. min. ed. Gail, Vol. II, pp. 140–145. – Eine merkwürdige Naturliebe, besonders eine Blumenliebhaberei, die William Jones schon mit der der indischen Dichter zusammengestellt hat, bemerkt man bei einem Tragiker, dem Chäremon; s. Welcker, Griechische Tragödien, Abth. III, S. 1088.
16 Longi Pastoralia (Daphnis et Chloe, ed. Seiler 1843), lib. I, 9; III, 12 und IV,1–3; pag. 92, 125 und 137. Vgl. Villemain, Sur les Romans grecs, in seinen Mélanges de Littérature, T. II, pp. 435–448, wo Longus mit Bernardin de St. Pierre verglichen ist.
17 Pseudo-Aristot., De Mundo, cap. 3, 14–20, pag. 392 Bekker.
18 S. Aristoteles bei den Römern von Stahr 1834, S. 173–177; Osann, Beiträge zur griech. und röm. Litteraturgeschichte, Bd. I, 1835, S. 165–192. Stahr vermutet (S. 172) wie Heumann, daß der heutige griechische Text eine umgestaltete Übersetzung des lateinischen Textes des Apulejus sei. Letzterer (de Mundo, p. 250 Bip.) sagt bestimmt: er habe sich in der Abfassung seines Buchs an Aristoteles und Theophrast gehalten.
19 Osann a.a.O., S. 194–226.
20 Cicero, De Natura Deorum, II, 37. Eine Stelle, in welcher Sextus Empiricus (Adversus Physicos, lib. IX, 22, p. 554 Fabr.) eine ähnliche Äußerung des Aristoteles anführt, verdient um so mehr Aufmerksamkeit, als Sextus kurz vorher (IX, 20) auf einen anderen, für uns ebenfalls verlorenen Text (über Divination und Träume) anspielt.
21 Aristoteles flumen orationis aureum fundeus, Cic., Acad. Quaest. II, cap. 38. (Vgl. Stahr, Aristotelia, Th. II, S. 161 und in desselben Schrift Aristoteles bei den Römern, S. 53.)
22 Menandri rhetoris comment. de Encomiis ex rec., Heeren 1785, sect. I, cap. 5, pp. 38 und 39. Der strenge Kritiker nennt das didaktische Naturgedicht ψυχοότεον, eine frostige Komposition, in der die Naturkräfte ihrer Persönlichkeit entkleidet auftreten: Apoll das Licht, Hera der Inbegriff der Lufterscheinungen, Zeus die Wärme ist. Auch Plutarch (De aud. poet., p. 27 Steph.) verspottet die sogenannten Naturgedichte, welche nur die Form der Poesie haben. Nach dem Stagiriten (De Poet., cap. 1) ist Empedokles mehr Physiologe als Dichter, er hat mit Homer nichts gemein als das Versmaß.
23 „Es mag wunderbar scheinen, die Dichtung, die sich überall an Gestalt, Farbe und Mannigfaltigkeit erfreut, gerade mit den einfachsten und abgezogensten Ideen verbinden zu wollen; aber es ist darum nicht weniger richtig. Dichtung, Wissenschaft, Philosophie, Tatenkunde sind nicht in sich und ihrem Wesen nach gespalten; sie sind eins, wo der Mensch auf seinem Bildungsgang noch eins ist oder sich durch wahrhaft dichterische Stimmung in jene Einheit zurückver setzt.“ Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Werke, Bd. I, S. 98–102 (vgl. auch Bernhardy, Röm. Litteratur, S. 215–218 und Fried. Schlegels sämmtliche Werke, Bd. I, S. 108–110). Cicero (Ad. Quint. fratrem II, 11) schrieb freilich, wo nicht mürrisch, doch mit vieler Strenge, dem von Virgil, Ovid und Quintilian so hochgepriesenen Lucretius mehr Kunst als schöpferisches Talent (ingenium) zu.
24 Lucret., lib. V, v. 930–1455.
25 Plato, Phaedr., p. 230; Cicero, De Leg. I. 5, 15; II. 2.1–3; II. 3, 6 (vgl. Wagner, Comment. perp. in Cic. de Leg. 1804, p. 6); Cic., De Oratore I. 7, 28 (pag. 15 Ellendt).
26 S. die vortreffliche Schrift von Rudolph Abeken, Rektor des Gymnasiums zu Osnabrück, welche unter dem Titel Cicero in seinen Briefen im Jahr 1835 erschienen ist, S. 431–434. Diese wichtige Zugabe über Ciceros Geburtsstätte ist von H. Abeken, dem gelehrten Neffen des Verfassers, ehemals preußischem Gesandtschaftsprediger in Rom, jetzt teilnehmend an der wichtigen ägyptischen Expedition des Professor Lepsius. Vgl. auch über die Geburtsstätte des Cicero Valery, Voy. hist. en Italie, T. III, p. 421.
27 Cic., Epist. ad Atticum XII, 9 und 15.
28 Die Stellen des Virgilius, welche Malte-Brun (Annales des Voyages, T. III, 1808, pp. 235–266) als Lokalbeschreibungen anführt, beweisen bloß, daß der Dichter die Erzeugnisse der verschiedenen Länder, den Safran des Berges Tmolus, den Weihrauch der Sabäer, die wahren Namen vieler kleinen Flüsse, ja die mephitischen Dämpfe kannte, welche aus einer Höhle in den Apenninen bei Amsanctus aufsteigen.
29 Virg., Georg. I, 356–392; III, 349–380; Aen. III, 191–211; IV, 246–251; IV, 522–528; XII, 684–689.
30 S. Kosmos, Bd. I, S. 215f.; S. 216 Anm. 200. (Vgl. als einzelne Naturbilder Ovid., Met. I, 568–576; III, 155–164; III, 407–412; VII, 180–188; XV, 296–306. Trist., lib. I El. 3, 60; lib. III El. 4, 49; El. 12, 15. Ex Ponto, lib. III Ep.7–9.) Zu den seltenen Beispielen von individuellen Naturbildern, solchen, die sich auf eine bestimmte Landschaft beziehen, gehört, wie Roß zuerst erwies, die anmutige Schilderung einer Quelle am Hymettus, welche mit dem Vers anhebt: Est prope purpureos colles florentis Hymetti … (Ovid., De arte am. III, 687). Der Dichter beschreibt die bei den Alten berühmte, der Aphrodite geheiligte Quelle Kallia, die an der Westseite des sonst sehr wasserarmen Hymettus ausbricht. (S. Roß, Brief an Prof. Vuros in der Griech. Medicin. Zeitschrift, Juni 1837.)
31 Tibullus, ed. Voß 1811, Eleg., lib. I. 6, 21–34; lib. II, 1, 37–66.
32 Lucan., Phars. III, 400–452 (Vol. I, pp. 374–384 Weber).
33 S. oben Kosmos, Bd. I, S. 256.
34 S. a.a.O., S. 455. Das Gedicht ›Aetna‹ des Lucilius, sehr wahrscheinlich Teil eines größeren Gedichts über die Naturmerkwürdigkeiten Siziliens, wurde von Wernsdorf dem Cornelius Severus zugeschrieben. Eine besondere Aufmerksamkeit verdienen das Lob des allgemeinen Naturwissens, als „Früchte des Geistes“ betrachtet, v. 270–280, die Lavaströme v. 360–370 und 474–515, die Wasserausbrüche am Fuß des Vulkans (?) v. 395, die Bildung des Bimssteins v. 425 (pag. XVI – XX, 32, 42, 46, 50 und 55 ed. Jacob 1826).
35 Decii Magni Ausonii Mosella, v. 189–199, pag. 15 und 44 Böcking. Vgl. auch die in naturhistorischer Hinsicht nicht unwichtige, von Valenciennes scharfsinnig benutzte Notiz über die Fische der Mosel v. 85–150, pag.9–12, ein Gegenstück zu Oppian (Bernhardy, Griech. Litt., Th. II, S. 1049). Zu dieser trocken didaktischen Dichtungsart, welche sich mit Naturprodukten beschäftigte, gehörten auch die nicht auf uns gekommenen ›Ornithogonia‹ und ›Theriaca‹ des Aemilius Macer aus Verona, den Werken des Kolophoniers Nicander nachgebildet. Anziehender als des Ausonius’ ›Mosella‹ war eine Naturbeschreibung der südlichen Küste von Gallien, welche das Reisegedicht des Claudius Rutilius Numatianus, eines Staatsmanns unter Honorius, enthielt. Durch den Einbruch der Barbaren von Rom vertrieben, kehrte Rutilius nach Gallien auf seine Landgüter zurück. Wir besitzen leider nur ein Fragment des zweiten Buchs, welches nicht weiter als bis zu den Steinbrüchen von Carrara führt. S. Rutilii Claudii Numatiani de Reditu suo (e Roma in Galliam Narbonensem) libri duo; rec. A. W. Zumpt, 1840, pp. XV, 31 und 219 (mit einer schönen Karte von Kiepert); Wernsdorf, Poetae lat. min., T. V, P. 1, p. 125.
36 Tac., Ann. II, 23–24; Hist. V, 6. Das einzige Fragment, das uns der Rhetor Seneca (Suasor. I, p. 11 Bipont.) aus einem Heldengedicht erhalten hat, in welchem Ovids Freund Pedo Albinovanus die Taten des Germanicus besang, beschreibt ebenfalls die unglückliche Schiffahrt auf der Ems (Ped. Albinov. Elegiae, Amst. 1703, p. 172). Seneca hält diese Schilderung des stürmischen Meers für malerischer als alles, was die römischen Dichter hervorgebracht haben. Freilich sagt er selbst: latini declamatores in Oceani descriptione non nimis viguerunt; nam aut tumide scripserunt aut curiose.
37 Curt. in Alex. Magno VI, 16. (Vgl. Droysen, Gesch. Alexanders des Großen, 1833, S. 265.) In dem nur zu rhetorischen Lucius Annaeus Seneca (Quaest. Natur., lib. III c., 27–30, pag. 677–686 ed. Lips, 1741) findet sich die merkwürdige Beschreibung eines der verschiedenen Untergänge des einst reinen, dann sündhaft gewordenen Menschengeschlechts durch eine fast allgemeine Wasserflut: Cum fatalis dies diluvii venerit … bis: peracto exitio generis humani exstinctisque pariter feris in quarum homines ingenia transierant … Vgl. die Schilderung chaotischer Erdrevolutionen im Bhagavata-Purana, Buch III, cap. 17 (ed. Burnouf, T. I, p. 441).
38 Plin., Epist. II, 17; V, 6; IX, 7; Plin., Hist. Nat. XII, 6; Hirt, Gesch. der Baukunst bei den Alten, Bd. II, S. 241, 291 und 376. Die Villa Laurentina des jüngeren Plinius lag bei der jetzigen Torre di Paterno im Küstental la Palombara östlich von Ostia; s. Viaggio da Ostia a la Villa di Plinio, 1802, p. 9 und Le Laurentin par Haudebourt, 1838, p. 62. Den Ausbruch eines tiefen Naturgefühls enthalten die wenigen Zeilen, welche Plinius vom Laurentinum aus an Minutius Fundanus schrieb: Mecum tantum et cum libellis loquor. Rectam sinceramque vitam! dulce otium honestumque! Ο mare, ο littus, verum secretumque μονσεον! quam multa invenitis, quam multa dictatis! (I, 9.) Hirt hatte die Überzeugung, daß, wenn in Italien im 15. und 16. Jahrhundert die streng geregelte Gartenkunst aufkam, welche man lange die französische genannt und der freien Landschaftsgärtnerei der Engländer entgegengestellt hat, die Ursache dieser früheren Neigung zu langweilig geregelten Anlagen in dem Wunsch zu suchen sei, nachzuahmen, was der jüngere Plinius in seinen Briefen beschrieben hatte (Geschichte der Baukunst bei den Alten, Th. II, S. 366).
39 Plin., Epist. III, 19; VIII, 16.
40 Sueton, in Julio Caesare, cap. 56. Das verlorene Gedicht des Cäsar (›Iter‹) beschrieb die Reise nach Spanien, als er zu seiner letzten Kriegstat sein Heer, nach Sueton in 24, nach Strabo und Appian in 27 Tagen zu Lande von Rom nach Córdoba führte, weil die Reste der in Afrika geschlagenen Pompejanischen Partei sich in Spanien wieder gesammelt hatten.
41 Sil. Ital., Punica, lib. III, v. 477.
42 A.a.O., lib. IV, v. 348, lib. VIII, v. 399.
43 S. über das elegische Gedicht Nicol. Bach in der Allg. Schul-Zeitung 1829, Abth. II, No. 134, S. 1097.
44 Minucii Felicis Octavius ex rec. Gron. (Roterod. 1743), cap. 2 und 3 (pag. 12–28), cap. 16–18 (pag. 151–171).
45 Über den Tod des Naucratius um das Jahr 357 s. Basilii Magni Opera omnia, ed. Par. 1730, T. III, p. XLV. Die jüdischen Essener führten zwei Jahrhunderte vor unserer Zeitrechnung ein Einsiedlerleben am westlichen Ufer des Toten Meers in Verkehr mit der Natur. Plinius sagt schön von ihnen (V, 15): mira gens, socia palmarum. Die Therapeuten wohnten ursprünglich, und in mehr klösterlicher Gemeinschaft, in einer anmutigen Gegend am See Möris (Neander, Allg. Geschichte der christl. Religion und Kirche, Bd. I, Abth. 1, 1842, S. 73 und 103).
46 Basilii M. Epist. XIV, p. 93, Ep. CCXXIII, p. 339. Über den schönen Brief an Gregorius von Nazianz und über die poetische Stimmung des heil. Basilius s. Villemain: De l’éloquence chrétienne dans le quatriéme siècle, in seinen Mélanges historiques et littéraires, T. III, pp. 320–325. Der Iris, an dessen Ufern die Familie des großen Basilius alten Länderbesitz hatte, entspringt in Armenien, durchströmt die pontischen Landschaften und fließt, mit den Wassern des Lycus gemischt, ins Schwarze Meer.
47 Gregorius von Nazianz ließ sich jedoch nicht durch die Beschreibung der Einsiedelei des Basilius am Iris reizen; er zog Arianzus in der Tiberina Regio vor, obgleich sein Freund diesen Ort mürrisch ein unreines βάαον nennt.,S. Basilii, Ep. II, p. 70 und die Vita Sancti Basil., pp. XLVI und LIX der Ausg. von 1730.
48 Basilii Homil. in Hexaem. VI, 1 und IV, 6 (Bas. Opp. omnia, ed. Inl. Garnier, 1839, T. I, pp. 54 und 70). Vgl. damit den Ausdruck der tiefsten Schwermut in dem schönen Gedicht des Gregorius von Nazianz unter der Überschrift ›Von der Natur des Menschen‹ (Gregor. Naz., Opp. omnia, ed. Par. 1611, T. II, Carm. XIII, p. 85).
49 Die im Text zitierte Stelle des Gregorius von Nyssa ist aus einzelnen, hier wörtlich übersetzten Fragmenten zusammengetragen. Es finden sich dieselben in S. Gregorii Nysseni Opp., ed. Par. 1615, T. I, p. 49 C, p. 589 D, p. 210 C,p. 780 C; T. II, p. 860 B, p. 619 B, p. 619 D, p. 324 D. „Sei milde gegen die Regungen der Schwermut“, sagt Thalassius in Denksprüchen, welche von seinen Zeitgenossen bewundert wurden (Biblioth. Patrum, ed. Par. 1624, T. II, p. 1180 C).
50 S. Joannis Chrysostomi Opp. omnia, Par. 1838 (8°), T. IX, p. 687 Α, Τ. II, pp. 821 Α und 851 E, T. I, p. 79. Vgl. auch Joannis Philoponi in cap. I Geneseos de creatione mundi libri septem, Viennae Austr. 1630, pp. 192, 236 und 272; wie auch Georgii Pisidae, Mundi opificium, ed. 1596, v. 367–375, 560, 933 und 1248. Die Werke des Basilius und des Gregorius von Nazianz hatten schon früh, seitdem ich anfing, Naturschilderungen zu sammeln, meine Aufmerksamkeit gefesselt; aber alle angeführten trefflichen Übersetzungen von Gregorius von Nyssa, Chrysostomus und Thalassius verdanke ich meinem vieljährigen, mir immer so hilfreichen Kollegen und Freund, Herrn Hase, Mitglied des Instituts und Konservator der Königl. Bibliothek zu Paris.
51 Über das Consilium Turonense unter Papst Alexander III. s. Ziegelbauer, Hist. Rei litter. ordinis S. Benedicti, T. II, p. 248, ed. 1754; über das Konzil zu Paris von 1209 und die Bulle Gregors IX. vom Jahr 1231 s. Jourdain, Recherches crit. sur les traductions d’ Aristote, 1819, pp. 204–206. Es war das Lesen der physikalischen Bücher des Aristoteles mit strengen Strafen belegt worden. Im Concilium Lateranense von 1139 (Sacror. Concil. Nova Collectio, ed. Ven. 1776, T. XXI, p. 528) wurde den Mönchen bloß die Ausübung der Medizin untersagt. Vgl. die gelehrte und anmutige Schrift des jungen Wolfgang von Goethe: Der Mensch und die elementarische Natur, 1844, S. 10.
52 Fried. Schlegel über nordische Dichtkunst in seinen sämmtlichen Werken, Bd. X, S. 71 und 90. Aus der sehr frühen Zeit Karls des Großen ist noch die dichterische Schilderung des waldigen, wieseneinschließenden Tiergartens bei Aachen anzuführen im Leben des großen Kaisers von Angilbertus, Abt von St. Riquier (s. Pertz, Monum. Germaniae historica, T. II, pag. 393–403).
53 S. der Vergleich beider Epen, der ›Nibelungen‹ (die Rache der Krimhild schildernd, der Gemahlin des hörnenen Siegfried) und der ›Gudrun‹ (der Tochter Königs Hetel), in Gervinus, Gesch. der deutschen Litt., Bd. I, S. 354–381.
54 Über die romantische Schilderung der Höhle der Liebenden im ›Tristan‹ des Gottfried von Straßburg s. Gervinus a.a.O., Bd. I, S. 450.
55 Vridankes [Freidanks] Bescheidenheit von Wilhelm Grimm, 1834, S. L und CXXVIII. Das ganze Urteil über das deutsche Volksepos und über den Minnegesang (im Text von S. 27 bis S. 30) habe ich einen Brief von Wilhelm Grimm an mich (Okt. 1845) entlehnt. Aus einem sehr alten angelsächsischen Gedicht über die Namen der Runen, welches Hickes zuerst bekannt gemacht und das eine gewisse Verwandschaft mit eddischen Liedern hat, schalte ich hier noch eine recht charakteristische Beschreibung der Birke ein: „Beorc ist in Ästen schön; an den Spitzen rauscht sie lieblich bewachsen mit Blättern von den Lüften bewegt.“ Einfach und edel ist die Begrüßung des Tags: „Tag ist des Herren Bote, teuer dem Menschen, herrliches Licht Gottes, Freude und Zuversicht Reichen und Armen, allen gedeihlich!“ Vgl. Wilhelm Grimm, Über deutsche Runen, 1821, S. 94, 225 und 234.
56 Jacob Grimm in Reinhart Fuchs, 1834, S. CCXCIV. (Vgl. auch Christian Lassen in seiner Indischen Alterthumskunde, Bd. I, 1843, S. 296.)
57 Die Unechtheit der Lieder Ossians und des Macphersonschen Ossians insbesondere, von Talvj (1840), der geistreichen Übersetzerin der serbischen Volkspoesien. Die erste Publikation des ›Ossian‹ von Macpherson ist von 1760. Die Finnianischen Lieder ertönen allerdings in den schottischen Hochlanden wie in Irland, aber sie sind nach O’Reilly und Drummond von Irland aus dahin übertragen worden.
58 Lassen, Ind. Alterthumskunde, Bd. I, S. 412–415.
59 Über die indischen Waldeinsiedler, Vanaprasthen (sylvicolae) und Sramanen (ein Name, der in Sarmanen und Garmanen verstümmelt wurde), s. Lassen, De nominibus quibus veteribus appelantur Indorum philosophi im Rhein. Museum für Philologie, 1833, S. 178–180. Wilhelm Grimm findet eine indische Färbung in der Waldbeschreibung, die der Pfaffe Lambrecht vor 1200 Jahren [gemeint ist: um 1200 n. Chr.] in seinem ›Alexanderlied‹ gibt, das zunächst nach einem französischen Vorbild gedichtet ist. Der Held kommt in einen wunderbaren Wald, wo aus großen Blumen übernatürliche, mit allen Reizen ausgeschmückte Mädchen hervorwuchsen. Er verweilte so lange bei ihnen, bis Blumen und Mädchen wieder hinwelkten. (Vgl. Gervinus, Bd. I, S. 282 und Maßmann, Denkmäler deutscher Spr. und Lit., Bd. I, S. 16.) Das sind die Mädchen aus Edrisis östlichster Zauberinsel Vacvac, die ein Ausfuhrartikel sind und in der lateinischen Übertragung des Masudi Chothbeddin puellae vasvakienses heißen. (Humboldt, Examen crit. de l’hist. de la Geographie, Τ. Ι, p. 53.)
60 Kalidasa, am Hof des Vikramaditya, lebte ungefähr 56 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Das Alter der beiden großen Heldengedichte, des ›Ramayana‹ und ›Mahabharata‹, reicht sehr wahrscheinlich weit über die Erscheinung Buddhas, d. i. weit über die Mitte des 6. Jahrhunderts vor Chr., hinauf (Burnouf, Bhagavata-Purana, T. I, pp. CXI und CXVIII; Lassen, Ind. Alterthumskunde, Bd. I, S. 356 und 492). Georg Forster hat durch die Übersetzung der ›Sakuntala‹, d. i. durch die geschmackvolle Verdeutschung einer englischen Übertragung von William Jones (1791), viel zu dem Enthusiasmus beigetragen, welcher damals zuerst für indische Dichtkunst in unserem Vaterland ausbrach. Ich erinnere gern an zwei schöne Distichen Goethes, die 1792 erschienen:
Willst du die Blüte des frühen, die Früchte des späteren Jahres;
Willst du, was reizt und entzückt, willst du, was sättigt und nährt;
Willst du den Himmel, die Erde mit einem Namen begreifen:
Nenn’ ich, Sakontala, Dich, und so ist alles gesagt.
Die neueste deutsche Übersetzung des indischen Dramas nach den wichtigen, von Brockhaus aufgefundenen Urtexten ist die von Otto Böhtlingk (Bonn 1842).
61 Humboldt, Über Steppen und Wüsten, in den Ansichten der Natur, s. in unserer Studienausgabe Band V, S.3–127; S. 369f.
62 Um das wenige zu vervollständigen, was im Text der indischen Literatur entlehnt ist, und um (wie früher bei der griechischen und römischen Literatur geschehen ist) die Quellen einzeln angeben zu können, schalte ich hier nach den freundlichen handschriftlichen Mitteilungen eines ausgezeichneten und philosophischen Kenners der indischen Dichtungen, Herrn Theodor Goldstücker, allgemeinere Betrachtungen über das indische Naturgefühl ein:
„Unter allen Einflüssen, welche die geistige Entwicklung des indischen Volks erfuhr, scheint mir derjenige der erste und wichtigste, welchen die reiche Natur des Landes auf das Volk ausgeübt hat. Das tiefste Naturgefühl ist zu allen Zeiten der Grundzug des indischen Geistes gewesen. Drei Epochen lassen sich mit Bezug auf die Weise angeben, in welcher sich dieses Naturgefühl offenbart hat. Jede derselben hat ihren bestimmten, im Leben und in der Tendenz des Volks tiefbegründeten Charakter. Daher können wenige Beispiele hinreichen, um die fast dreitausendjährige Tätigkeit der indischen Phantasie zu bezeichnen. Die erste Epoche des Ausdrucks eines regen Naturgefühls offenbaren die ›Vedas‹. Aus dem ›Rigveda‹ führen wir an die einfach erhabenen Schilderungen der Morgenröte (Rigveda-Sanhitâ, ed. Rosen, 1838, hymn. XLVI, p. 88, hymn. XLVIII, p. 92, hymn. XCII, p. 184, hymn. CXIII, p. 233; vgl. auch Höfer, Ind. Gedichte, 1841, Lese 1, S. 3) und der „goldhändigen“ Sonne (s. a.a.O., hymn. XXII, p. 31, hymn. XXXV, p. 65). Die Verehrung der Natur war hier wie bei anderen Völkern der Beginn des Glaubens; sie hat aber in den ›Vedas‹ die besondere Bestimmtheit, daß der Mensch sie stets in ihrem tiefsten Zusammenhang mit seinem eigenen äußeren und inneren Leben auffaßt. – Sehr verschieden ist die zweite Epoche. In ihr wird eine populäre Mythologie geschaffen; sie hat den Zweck, die Sagen der ›Vedas‹ für das der Urzeit schon entfremdete Bewußtsein faßlicher auszubilden und mit historischen Ereignissen, die in das Reich der Mythe erhoben werden, zu verweben. Es fallen in die zweite Epoche die beiden großen Heldengedichte ›Ramayana‹ und ›Mahabharata‹, von denen das letztere, jüngere, noch den Nebenzweck hat, die Brahmanen-Kaste unter den vieren, welche die Verfassung des alten Indiens konstituieren, zu der einflußreichsten zu machen. Darum ist das ›Ramayana‹ auch schöner, an Naturgefühl reicher; es ist auf dem Boden der Poesie geblieben und nicht genötigt gewesen, Elemente, die diesem fremd, ja fast widersprechend sind, aufzunehmen. In beiden Dichtungen ist die Natur nicht mehr wie in den ›Vedas‹ das ganze Gemälde, sondern nur ein Teil desselben. Zwei Punkte unterscheiden die Auffassung der Natur in dieser Epoche der Heldengedichte wesentlich von derjenigen, welche die ›Vedas‹ dartun: des Abstands in der Form nicht zu gedenken, welche die Sprache der Verehrung von der Sprache der Erzählung trennt. Der eine Punkt ist die Lokalisierung der Naturschilderung (z.B. im ›Ramayana‹ nach Wilhelm von Schlegel, das erste Buch oder „Balakanda“ und das zweite Buch oder „Ayodhyakanda“; s. auch über den Unterschied der genannten beiden großen Epen Lassen, Ind. Alterthumskunde, Bd. I, S. 482); der andere Punkt, mit dem ersten nahe verbunden, betrifft den Inhalt, um den sich das Naturgefühl bereichert hat. Die Sage und zumal die historische brachte es mit sich, daß Beschreibung bestimmter Örtlichkeiten an die Stelle allgemeiner Naturschilderung trat. Die Schöpfer der großen epischen Dichterformen, sei es Valmiki, der die Taten Ramas besingt, seien es die Verfasser des ›Mahabharata‹, welche die Tradition unter dem Gesamtnamen Vyasa zusammenfaßt, alle zeigen sich beim Erzählen wie vom Naturgefühl überwältigt. Die Reise Ramas von Ayuthia nach der Residenzstadt Dschanakas, sein Leben im Wald, sein Aufbruch nach Lanka (Ceylon), wo der wilde Ravana, der Räuber seiner Gattin Sita, haust, bieten wie das Einsiedlerleben der Panduiden dem begeisterten Dichter Gelegenheit dar, dem ursprünglichen Trieb des indischen Gemüts zu folgen und an die Erzählung der Heldentaten Bilder einer reichen Natur zu knüpfen (Ramayana, ed. Schlegel, lib. I, cap. 26, v. 13–15, lib. II, cap. 56, v. 6–11; vgl. Nalus, ed. Bopp, 1832, Ges. XII, v.1–10). Ein anderer Punkt, in welchem sich in Hinsicht auf das Naturgefühl diese zweite Epoche von der der ›Vedas‹ unterscheidet, betrifft den reicheren Inhalt der Poesie selbst. Dieser ist nicht mehr wie dort die Erscheinung der himmlischen Mächte; er umfaßt vielmehr die ganze Natur: den Himmelsraum und die Erde, die Welt der Pflanzen und Tiere in ihrer üppigen Fülle und in ihrem Einfluß auf das Gemüt des Menschen. – In der dritten Epoche der poetischen Literatur Indiens (wenn wir die ›Puranen‹ ausnehmen, welche die Aufgabe haben, das religiöse Element im Geist der Sekten fortzubilden) übt die Natur die alleinige Herrschaft, aber der beschreibende Teil der Dichtkunst ist auf eine gelehrtere und örtliche Beobachtung gegründet. Um einige der großen Gedichte zu nennen, welche zu dieser Epoche gehören, erwähnen wir hier das ›Bhattikavya‹, d. i. das Gedicht von Bhatti, das gleich dem ›Ramayana‹ die Taten des Rama zum Gegenstand hat und in welchem erhabene Schilderungen des Waldlebens während einer Verbannung, des Meeres und seiner lieblichen Gestade wie des Morgenanbruchs in Lanka aufeinander folgen (Bhattikavya, ed. Calc., P. I, Ges. VII, p. 432, Ges. X, p. 715, Ges. XI, p. 814; vgl. auch Schütz, Prof. zu Bielefeld, Fünf Gesänge des Bhatti-Kâvya, 1837, S.1–18); das ›Sisupalabadha‹ von Magha mit einer anmutigen Beschreibung der Tageszeiten, das ›Naischada-tscharita‹ von Sri Harscha, wo aber in der Geschichte des Nalus und der Damayanti der Ausdruck des Naturgefühls in das Maßlose übergeht. Mit diesem Maßlosen kontrastiert die edle Einfachheit des ›Ramayana‹, wenn z.B. Visvamitra seinen Zögling an die Ufer des Sona führt (Sisupalabadha, ed. Calc., pp. 298 und 372, vgl. Schütz a.a.O., S. 25–28; Raischada-tscharita, ed. Calc. Ρ I. v. 77–129; Ramayana ed. Schlegel, lib. I, cap. 35, v. 15–18). Kalidasa, der gefeierte Dichter der ›Sakuntala‹, ist Meister in der Darstellung des Einflusses, welchen die Natur auf das Gemüt der Liebenden ausübt. Die Waldszene, die er in dem Drama ›Vikrama und Urvasi‹ geschaffen hat, gehört zu den schönsten dichterischen Erzeugnissen, welche je eine Zeit hervorbrachte (Vikramorvasi, ed. Calc. 1830, p. 71; Übersetzung in Wilson, Select specimens of the Theatre of the Hindus, Calc. 1827, Vol. II, p. 63). Im Gedicht der ›Jahreszeiten‹, besonders der Regenzeit und des Frühlings (Ritusanhära, ed. Bohlen 1840, pp. 11–18 und 37–45, Übersetzung von Bohlen, S. 80–88 und S. 107–114), wie im ›Wolkenboten‹ (alles Schöpfungen des Kalidasa) ist der Einfluß der Natur auf die Gefühle des Menschen wieder der Hauptgegenstand der Komposition. Der Wolkenbote (›Meghaduta‹), den Wilson und Gildemeister edierten, auch Wilson und Chézy übersetzt haben, schildert die Trauer eines Verbannten auf dem Berg Ramagiri. In der Sehnsucht nach der Geliebten, von welcher er getrennt ist, bittet er eine vorüberziehende Wolke, sie möge Nachricht von seinem Schmerz geben. Er bezeichnet der Wolke den Weg, welchen sie nehmen soll, und schildert die Landschaft, wie sie sich in einem tiefen aufgeregten Gemüt abspiegelt. Unter den Schätzen, welche die indische Poesie in dieser dritten Periode dem Naturgefühl des Volks verdankt, gebührt dem ›Gitagovinda‹ des Dschayadeva (Rückert in der Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes, Bd. I, 1837, S. 129–173; Gitagovinda Jayadevae poetae indici drama lyricum, ed. Chr. Lassen 1836) die rühmlichste Erwähnung. Wir besitzen von diesem Gedicht, einem der anmutigsten und schwierigsten der ganzen Literatur, Rückerts meisterhafte rhythmische Übersetzung; es gibt dieselbe mit bewundernswürdiger Treue den Geist des Originals und eine Naturauffassung wieder, deren Innigkeit alle Teile der großen Komposition belebt.“
63 Journ. of the Royal Geogr. Soc. of London, Vol. X, 1841, pp.2–3; Rükkert, Makamen Hariri’s, S. 261.
64 Goethe im Kommentar zum west-östlichen Divan, in seinen Werken, Bd. VI, 1828, S. 73, 78 und 111.
65 S. Le Livre de Rois, publié par Jules Mohl, T. I, 1838, p. 487.
66 Vgl. in Jos. von Hammer, Gesch. der schönen Redekünste Persiens, 1818, S. 96 Ewhadeddin Enweri aus dem 12. Jahrhundert, in dessen Gedicht an Schedschai man eine denkwürdige Anspielung auf die gegenseitige Attraktion der Himmelskörper entdeckt hat; S. 183 Dschelaleddin Rumi den Mystiker; S. 259 Dschelaleddin Adhad und S. 403 Feisi, welcher als Verteidiger der Brahmareligion an Akbars Hof auftrat und in dessen Ghaselen eine indische Zartheit der Gefühle wehen soll.
67 „Die Nacht bricht ein, wenn die Tintenflasche des Himmels umgestürzt ist“; dichtet geschmacklos Chodschah Abdullah Wassaf, der aber das Verdienst hat, die große Sternwarte von Meragha mit ihrem hohen Gnomon zuerst beschrieben zu haben. Hilali aus Asterabad läßt „die Mondscheibe vor Hitze glühen“ und hält so den Tau für „den Schweiß des Mondes“ (Jos. v. Hammer, S. 247 und 371).
68 Tûirja oder Turan sind Benennungen unentdeckter Herleitung. Doch hat Burnouf (Yaçna, Τ I, pp. 427–430) scharfsinnig an die bei Strabo (lib. XI, p. 517 Cas.) genannte baktrische Satrapie Turiua oder Turiva erinnert. Du Theil und Groskurd (letzterer Th. II, S. 410) wollen aber Tapyria lesen.
69 Über ein finnisches Epos von Jacob Grimm, 1845, S. 5.
70 Ich bin in den Psalmen der trefflichen Übertragung von Moses Mendelssohn (s. dessen Gesammelte Schriften, Bd. VI, S. 220, 238 und 280) gefolgt. Edle Nachklänge der althebräischen Poesie finden sich noch im 11. Jahrhundert in den Hymnen des spanischen Synagogendichters Salomo ben Jehudah Gabirol, die eine dichterische Umschreibung des Pseudoaristotelischen Buches von der Welt darbieten. S. Michael Sachs, Die religiöse Poesie der Juden in Spanien, 1845, S. 7, 217 und 229. Auch die dem Naturleben entnommenen Züge in Mose ben Jakob ben Esra sind voll Kraft und Größe (S. 69, 77 und 285).
71 Die Stellen aus dem Buch ›Hiob‹ habe ich der Übersetzung und Auslegung von Umbreit (1824), S. XXIX-XLII und 290–314 entlehnt. (Vgl. über das Ganze Gesenius, Geschichte der hebr. Sprache und Schrift, S. 33 und Jobi antiquissimi carminis hebr. natura atque virtutes, ed. Ilgen, p. 28.) Die längste und am meisten charakteristische Tierbeschreibung im ›Hiob‹ (XL, v. 25–XLI, v. 26) ist die des Krokodils; und doch ist gerade in dieser (Umbreit, S. XLI und 308) einer der Beweise enthalten, daß der Verfasser des Buchs ›Hiob‹ aus Palästina selbst gebürtig war. Da Nilpferde und Krokodile ehemals im ganzen Nildelta gefunden wurden, so darf man sich nicht wundern, daß die Kenntnis von so seltsam gestalteten Tieren sich bis in das nahe Palästina verbreitet hatte.
72 Goethe im Kommentar zum west-östlichen Divan, S. 8.
73 Antar, Α bedoueen Romance, transl. from the arabic by Terrick Hamilton, Vol. I, p. XXVI; Hammer in den Wiener Jahrbüchern der Litteratur, Bd. VI, 1819, S. 229; Rosenmüller in den Charakteren der vornehmsten Dichter aller Nationen, Bd. V (1798), S. 251.
74 Antara cum schol. Zouzenii, ed. Menil, 1816, v. 15.
75 Amrulkeisi Moallakat, ed. E. G. Hengstenberg, 1823; Hamasa, ed. Freytag, P. I, 1828, lib. VII, p. 785. Vgl. auch das poetische Werk: Amrilkais, Der Dichter und König, übersetzt von Fr. Rückert, 1843, S. 29 und 62, wo zweimal die südlichen Regenschauer überaus naturwahr geschildert sind. Der königliche Dichter besuchte mehrere Jahre vor der Geburt Mohammeds den Hof des Kaisers Justinian, um Hilfe gegen seine Feinde zu erbitten. S. Le Diwan d’Amro’lkïas, accomp. d’une traduction par le Bon Mac Guckin de Slane, 1837, p. 111.
76 Nabeghah Dhobyani in Silvestre de Sacy, Chrestom. arabe, 1806, T. III, p. 47. Vgl. über die früheste arabische Literatur im allgemeinen Weil, Die poet. Litteratur der Araber vor Mohammed, 1837, S. 15 und 90, wie auch Freytags Darstellung der arabischen Verskunst, 1830, S. 372–392. Eine herrliche und vollständige Übertragung der arabischen Naturpoesie aus der ›Hamasa‹ haben wir von unserem großen Dichter Friedrich Rückert bald zu erwarten.
77 Hamasae carmina ed. Freytag, P. I, 1828, p. 788. Es ist hier vollendet, heißt es ausdrücklich p. 796, „das Capitel der Reise und der Schläfrigkeit“.
78 Dante, Purgatorio, canto I, v. 115:
L’alba vinceva l’ora mattutina,
Che fuggia innanzi, sì che di lontano
Conobbi il tremolar della marina …
79 Purg., canto V, v. 109–127:
Ben sai come nell’ aer si raccoglie
Quell’ umido vapor, che in acqua riede,
Tosto che sale, dove’l freddo il coglie …
80 Purg., canto XXVIII, v. 1–24.
81 Parad., canto XXX, v. 61–69:
Ε vidi lume in forma di riviera,
Fulvido di fulgore intra duo rive,
Dipinte dimirabil primavera.
Di tal fiumana uscian faville vive,
Ε d’ogni parte si mettean ne’ fiori,
Quasi rubin, che oro circonscrive.
Poi, come inebriate dagli odori,
Riprofondavan se nel miro gurge,
Ε s’ una entrava, un’ altra n’uscia fuori.
Vgl. die Übertragung des als Dichter und Maler vielbegabten August Kopisch, 1842, S. 399–401. Ich habe nichts aus den Canzonen der ›Vita nuova‹ entlehnt, weil die Gleichnisse und Bilder, die sie enthalten, nicht in den reinen Naturkreis irdischer Erscheinungen gehören.
82 Ich erinnere an das Sonett des Bojardo ›Ombrosa selva, che il mio duolo ascolti …‹ und an die herrlichen Stanzen der Vittoria Colonna, welche anheben:
Quando miro la terra ornata e bella,
Di mille vaghi ed odorati fiori …
Eine schöne und sehr individuelle Naturbeschreibung des Landsitzes des Fracastoro am Hügel von Incassi (Mons Caphius) bei Verona gibt dieser als Arzt, Mathematiker und Dichter ausgezeichnete Mann in seinem ›Naugerius de poetica dialogus‹ (Hieron. Francastorii Opp., 1591, P. I, pp. 321–326). Vgl. auch in einem seiner Lehrgedichte, lib. II, v. 208–219 (Opp., p. 636) die anmutige Stelle über die Kultur des Citrus in Italien. Mit Verwunderung vermisse ich dagegen allen Ausdruck von Naturgefühl in den Briefen des Petrarca, sei es, daß er 1345, also drei Jahre vor dem Tod der Laura, von Vaucluse aus den Mont Ventoux zu besteigen versucht und sehnsuchtsvoll hofft, in sein Vaterland hinüberzublicken, oder daß er die Rheinufer bis Köln oder den Golf von Baja besucht. Er lebte mehr in den klassischen Erinnerungen an Cicero und die römischen Dichter oder in den begeisternden Anregungen seiner asketischen Schwermut als in der ihn umgebenden Natur (s. Petrarchae Epist. de Rebus familiaribus, lib. IV, 1; V 3 und 4, pag. 119, 156 und 161, ed. Lugdun. 1601). Nur die Beschreibung eines großen Sturms, den Petrarca in Neapel 1343 beobachtete (lib. V, 5, p. 165), ist überaus malerisch.
83 Humboldt, Examen critique de l’histoire de la Géographie du Nouveau Continent,T. III, pp. 227–248.
84 S. oben Kosmos, Bd. I, S. 255 mit Anm. 299.
85 Tagebuch des Columbus auf der ersten Reise (29. Okt. 1492, 25.–29. Nov., 7.–16. Dez., 21. Dez.); auch sein Brief an Dona Maria de Guzmán, ama del Principe D. Juan, Dez. 1500; in Navarrete, Colección de los Viages que hiciéron por mar los Españoles, T. I, pp. 43, 65–72, 82, 92,100 und 266.
86 A.a.O., pp. 303–304 (Carta del Almirante a los Reyes escrita en Jamaica a 7 de Julio 1503); Humboldt, Examen crit., T. III, pp. 231–236.
87 Tasso, canto XVI, Stanze 9–16.
88 S. Friedrich Schlegels Sämmtl. Werke, Bd. II, S. 96; und über den freilich störenden Dualismus der Mythik, das Gemisch der alten Fabel mit christlichen Anschauungen, Bd. X, S. 54. Camoens hat in den nicht genug beachteten Stanzen 82–84 diesen mythischen Dualismus zu rechtfertigen versucht. Tethys gesteht auf eine fast naive Weise, doch in dem herrlichsten Schwung der Poesie, „daß sie selbst, wie Saturn, Jupiter und aller Götter Schar, eitle Fabeleien sind, die blinder Wahn den Sterblichen gebar; sie dienen bloß, dem Liede Reiz zu geben. Α Sancta Providencia que em Jupiter aqui se representa …“
89 Os Lusiadas de Camões, canto I, est. 19, canto VI, est. 71–82. S. auch das Gleichnis in der schönen Beschreibung des Sturmes, welcher in einem Wald wütet: canto I, est. 35.
90 Das Elmsfeuer: „o lume vivo, que a maritima gente tem por santo, em tempo de tormenta …“ canto V, est. 18. Eine Flamme, Helena des griechischen Seevolks, bringt Unglück (Plin. II, 37); zwei Flammen, Castor und Pollux: mit Geräusch erscheinend, „als flatterten Vögel“, sind heilsame Zeichen (Stob., Eclog. phys. I, p. 514; Seneca, Nat. Quaest. I,1). Über den hohen Grad eigentümlicher Anschaulichkeit in den Naturbeschreibungen des Camoens s. die große Pariser Edition von 1818 in der ›Vida de Camões‹ von Dom Jozé Maria de Souza, p. CII.
91 Die Wasserhose (Wettersäule) canto V, est. 19–22 ist zu vergleichen mit der ebenfalls sehr dichterischen und naturwahren Beschreibung des Lucretius VI, 423–442. Über das süße Wasser, welches gegen Ende des Phänomens scheinbar aus dem oberen Teil der Wasserhose herabstürzt, s. Ogden, On Water Spouts (nach Beobachtungen auf einer im Jahr 1820 gemachten Reise der Havanna nach Norfolk), in Silliman’s Amer. Journal of Science, Vol. XXIX, 1836, pp. 254–260.
92 Canto III, est.7–21. Ich befolge immer den Text des Camoens der Editio princeps von 1572, welche die vortreffliche und splendide Ausgabe des Dom Jozé Maria de Souza-Botelho (Paris 1818) uns wiedergegeben hat. In den deutschen Zitaten bin ich meist der Übertragung Donners (1833) gefolgt. Der Hauptzweck der Lusiaden des Camoens war die Verherrlichung seiner Nation. Es wäre ein Monument, eines solchen dichterischen Ruhms und einer solchen Nation würdig, wenn, nach dem edlen Beispiel der Säle von Schiller und Goethe im großherzoglichen Schloß zu Weimar, in Lissabon selbst die zwölf grandiosen Kompositionen meines hingeschiedenen geistreichen Freundes Gerard, welche Souzas Ausgabe schmücken, in recht beträchtlichen Dimensionen als Fresken an wohlbeleuchteten Wänden ausgeführt würden. Das Traumgesicht des Königs Dom Manoel, in welchem ihm die Flüsse Indus und Ganges erscheinen, der Gigant Adamastor über dem Vorgebirge der Guten Hoffnung schwebend („Eu sou aquelle occulto e grande Cabo, Α quem chamais vós outros Tormentorio“), der Mord der Ignes de Castro und die liebliche Ilha de Venus würden von der herrlichsten Wirkung sein.
93 Canto X, est. 79–90. Camoens nennt wie Vespucci die dem Südpol nächste Himmelsgegend sternenarm: canto V, est. 14; auch kennt er das Eis der südlichen Meere: canto V, est. 27.
94 Canto X, est. 91–141.
95 Canto IX, est. 51–63. (Vgl. Ludwig Kriegk, Schriften zur allgemeinen Erdkunde, 1840, S. 338.) Die ganze Insel Ilha de Venus ist eine allegorische Mythe, wie est. 89 ausdrücklich angedeutet wird. Nur der Anfang der Erzählung des Traums von Dom Manoel schildert eine indische Berg- und Waldgegend, canto IV, est. 70.
96 Aus Vorliebe für die alte spanische Literatur und für den reizenden Himmelsstrich, in welchem die ›Araucana‹ des Alonso de Ercilla y Zúñiga gedichtet wurde, habe ich gewissenhaft das leider 42.000 Verse lange Epos zweimal gelesen: einmal in Peru, das andere Mal neuerlichst in Paris, als ich zum Vergleich mit dem Ercilla durch die Güte eines gelehrten Reisenden, Herrn Ternaux Com – pans, ein sehr seltenes, 1596 in Lima gedrucktes Buch, die neunzehn Gesänge des ›Arauco domado, compuesto por el Licenciado Pedro de Oña, natural de los Infantes de Engol en Chile‹ erhielt. Von dem Epos des Ercilla, in dem Voltaire eine „Ilias“, Sismondi eine „Zeitung in Reimen“ zu sehen glauben, sind die ersten fünfzehn Gesänge zwischen 1555 und 1563 gedichtet und schon 1569 erschienen; die letzten wurden erst 1590 gedruckt, nur sechs Jahre vor dem elenden Gedicht von Pedro de Oña, das denselben Titel führt wie eines der dramatischen Meisterwerke des Lope de Vega, in welchem aber der Kazike Caupolican wieder die Hauptrolle spielt. Ercilla ist naiv und treuherzig, besonders in den Teilen seiner Komposition, die er im Feld aus Mangel an Papier auf Baumrinde und Tierfelle schrieb. Die Schilderung seiner Dürftigkeit und des Undanks, welchen er an König Philipps Hof erfuhr, ist überaus rührend, besonders am Schluß des 37. Gesangs:
Climas passè, müdè constelaciones,
Golfos inavegables navegando,
Estendiendo, Señor, Vuestra Corona
Hasta la austral frigida zona …
„Die Blütezeit meines Lebens ist dahin; ich werde spät belehrt, dem Irdischen zu entsagen, zu weinen und nicht mehr zu singen.“ Die Naturbeschreibungen (der Garten des Zauberers, der Sturm, den Eponamon erregt, die Schilderung des Meers; P. I, pp. 80, 135 und 173, P. II, pp. 130 und 161 in der Ausgabe von 1733) entbehren allen Naturgefühls; die geographischen Wortregister (canto XXVII) sind so gehäuft, daß in einer Ottave 27 Eigennamen unmittelbar aufeinanderfolgen. Die Parte II der ›Araucana‹ ist nicht von Ercilla, sondern eine Fortsetzung in 20 cantos von Diego de Santistevan Osorio, den 37 cantos des Ercilla folgend und diesen angeheftet.
97 Im Romancero de Romances caballerescos é historicos, ordenado por D. Augustin Duran, P. I, p. 189 und P. II, pp. 237 erinnere ich an die schönen Strophen: „Yba declinando el dia – Su curso y ligeras horas …“ und an die Flucht des Köngis Rodrigo, welche beginnt:
Quando las pintadas aves
Mudas estan y la tierra
Atenta escucha los rios …
98 Fray Luis de León, Obras proprias y traducciones dedicadas á Don Pedro Portocarrero, 1681, p. 120: Noche serena. Ein tiefes Naturgefühl offenbart sich bisweilen auch in den alten mystischen Poesien der Spanier (Fray Luis de Granada, Santa Teresa de Jesús, Malón de Chaide); aber die Naturbilder sind meist nur die Hülle, in der ideale religiöse Anschauungen symbolisiert sind.
99 Calderón im Standhaften Prinzen über Annäherung der spanischen Flotte, Akt I, Szene 1, und über das Königtum des Wildes in den Wäldern, Akt III, Szene 2.
100 Was im Text im Urteil über Calderón und Shakespeare von Anführungszeichen begleitet ist, habe ich aus einem ungedruckten, an mich gerichteten Brief von Ludwig Tieck entlehnt.
101 Dies ist die Zeitfolge, nach welcher die Werke erschienen sind: Jean Jacques Rousseau 1759 (Nouvelle Héloïse), Buffon 1778 (Époques de la Nature, aber die Histoire Naturelle schon 1749–1767); Bernardin de St. Pierre: Études de la Nature 1784, Paul et Virginie 1788, Chaumière indienne 1791; Georg Forster: Reise nach der Südsee 1777, Kleine Schriften 1794. Mehr als ein halbes Jahrhundert vor dem Erscheinen der ›Nouvelle Héloïse‹ hatte schon Madame de Sévigné in ihren anmutigen Briefen die Lebendigkeit eines Naturgefühls offenbart, das im großen Zeitalter von Ludwig XIV. sich so selten aussprach. Vgl. die herrlichen Naturschilderungen in den Briefen vom 20. April, 31. Mai 15. August, 16. September und 6. November 1671; vom 23. Oktober und 28. Dezember 1689 (Aubenas, Hist. de Madame de Sévigné, 1842, pp. 201 und 427). – Wenn ich später im Text (S. 59) den alten deutschen Dichter Paul Fleming erwähnt habe, der von 1633 bis 1639 Adam Olearius auf seiner moskowitischen und persischen Reise begleitete, so ist es, weil nach dem gewichtigen Ausspruch meines Freundes Varnhagen von Ense (Biographische Denkm. Bd. IV, S. 4, 75 und 129) „der Charakter von Flemings Dichtungen eine gesunde und frische Kraft ist“, weil seine Naturbilder zart und voll Leben sind. – Adam Olearius: Moskowitische und Persische Reise. Hrsg. von Detlef Haberland. Stuttgart u. Wien 1986. Anm. d. Hrsg.
102 Brief des Admirals aus Jamaica vom 7. Juli 1503: „El mundo es poco; digo que el mundo no es tan grande como dice el vulgo.“ (Navarrete, Colección de Viages esp., Τ. Ι, p. 300.)
103 S. Journal and Remarks by Charles Darwin 1832–1836 im ›Narrative of the Voyages of the Adventure and Beagle‹, Vol. III, pp. 479–490; wo eine überaus schöne Schilderung von Tahiti gegeben ist.
104 Über die Verdienste Georg Forsters als Mensch und als Schriftsteller s. Gervinus, Gesch. der poet. National-Litteratur der Deutschen, Th. V, S. 390–392.
105 Freytags Darstellung der arabischen Verskunst, 1830, S. 402.
106 Herodot IV, 88.
107 Ein Teil der Werke des Polygnot und des Mikon (das Gemälde der Schlacht von Marathon in der Poikile zu Athen) wurde nach dem Zeugnis des Himerius noch am Ende des 4. Jahrhunderts (nach dem Anfang unsrer Zeitrechnung) gesehen; diese Werke waren damals also gegen 850 Jahre alt (Letronne, Lettres sur la Peinture historique murale, 1835, pp. 202 und 453).
108 Philostratorum Imagines, ed. Jacobs und Welcker, 1825, pp. 79 und 485. Beide gelehrte Herausgeber verteidigen gegen ältere Verdächtigung die Wahrhaftigkeit der Gemäldebeschreibung in der alten neopolitanischen Pinakothek (Jacobs, pp. XVII und XLVI, Welcker, pp. LV und LXVI). Otfried Müller vermutet, daß Philostrats Gemälde der Inseln (II, 17) wie die der Sumpfgegend (I, 9), des Bosporus und der Fischer (I, 12 und 13) in der Darstellung viel Ähnlichkeit mit dem Mosaik von Palestrina hatten. Auch Plato erwähnt im Eingang des ›Kritias‹ (p. 107) die Landschaftsmalerei, wie sie Berge, Flüsse und Waldungen darstellt.
109 Vorzüglich durch Agatharchus oder wenigstens nach dessen Vorschrift: Aristot., Poet IV, 16; Vitruv, lib. V, cap. 7, lib. VII in praef. (ed. Alois. Marinius, 1836, T. I, p. 292, T. II, p. 56); vgl. Letronne a.a.O., pp. 271–280.
110 Objekte der rhopographia: s. Welcker ad Philostr. Imag., p. 397.
111 Vitruv., lib. VII, cap. 5 (T. II, p. 91).
112 Hirt, Gesch. der bildenden Künste bei den Alten, 1833, S. 332, Letronne, pp. 262 und 468.
113 Ludius qui primus (?) instituit amoenissimam parietum picturam: Plin. XXXV, 10. Die topiaria opera des Plinius und varietates topiorum des Vitruvius waren kleine landschaftliche Dekorationsgemälde. – Die im Text zitierte Stelle des Kalidasa steht in ›Sakuntala‹, Akt VI (Böhtlings Übers., 1842, S. 90).
114 Otfried Müller, Archäologie der Kunst, 1830, S. 609. – Da früher im Text des ›Kosmos‹ der in Pompeji und Herculaneum aufgefundenen Malereien gedacht worden ist als einer Kunst, die der freien Natur wenig zugewandt war, so muß ich doch einige wenige Ausnahmen bezeichnen, welche durchaus als Landschaften im modernen Sinn des Worts gelten können. S. Pitture d’Ercolano, Vol. II, Tab. 45, Vol. III, Tab. 53 und als Hintergrund in reizenden historischen Kompositionen, Vol. IV, Tab. 61, 62 und 63. Ich erwähne nicht die merkwürdigen Darstellungen in den ›Monumenti dell’Istituto di Corrispondenza archeologica‹, Vol. III, Tab. 9, deren antike Echtheit schon von einem scharfsinnigen Archäologen, Raoul-Rochette, bezweifelt worden ist.
115 Gegen die Behauptung von du Theil (Voyage en Italie, par I’Abbé Barthélemy, p. 284), daß Pompeji noch mit Glanz unter Hadrian bestand und erst am Ende des 5. Jahrhunderts völlig zerstört worden sei, s. Adolph von Hoff, Geschichte der Veränderungen der Erdoberfläche, Th. II, 1824, S. 195–199.
116 S. Waagen, Kunstwerke und Künstler in England und Paris, Th. III, 1839, S. 195–201, und besonders S. 217–224: wo das berühmte Psalterium der Pariser Bibliothek (aus dem 10. Jahrhundert) beschrieben wird, welches beweist, wie lange in Konstantinopel sich „die antike Auffassungsweise“ erhalten hat. – Den freundschaftlichen und leitenden Mitteilungen dieses tiefen Kunstkenners (des Professor Waagen, Direktors der Gemäldegalerie in meiner Vaterstadt) habe ich zur Zeit meiner öffentlichen Vorträge im Jahr 1828 interessante Notizen über die Kunstgeschichte nach der römischen Kaiserzeit verdankt. Was ich später über die allmähliche Entwicklung der Landschaftsmalerei aufgeschrieben habe, teilte ich im Winter 1835 dem berühmten, leider uns so früh entrissenen Verfasser der › Italienischen Forschungen‹, Freiherrn von Rumohr in Dresden, mit. Ich erhielt von dem edel mitteilenden Mann eine große Zahl historischer Erläuterungen, die er mir sogar, wenn es nach der Form meines Werks geschehen könnte, vollständig zu veröffentlichen erlaubte.
117 Waagen a.a.O.,Th. I, 1837, S. 59, Th. III, 1839, S. 352–359.
118 „Im Belvedere des Vatikan malte schon Pinturicchio Landschaften als selbständige Verzierung; sie waren reich und komponiert. Er hat auf Raphael eingewirkt, in dessen Bildern viele landschaftliche Seltsamkeiten nicht von Perugino abzuleiten sind. Bei Pinturicchio und bei dessen Freunden finden sich auch schon die sonderbaren spitzigen Bergformen, welche Sie früher in Ihren Vorlesungen geneigt waren, von den durch Leopold von Buch so berühmt gewordenen Tiroler Dolomitkegeln abzuleiten, die auf reisende Künstler bei dem steten Verkehr zwischen Italien und Deutschland könnten Eindruck gemacht haben. Ich glaube vielmehr, daß diese Kegelformen auf den frühesten italienischen Landschaften entweder sehr alte konventionelle Übertragungen sind aus Bergandeutungen in antiken Reliefs und musivischen Arbeiten, oder daß sie als ungeschickt verkürzte Ansichten des Soracte und ähnlicher isolierter Gebirge in der Campagna di Roma betrachtet werden müssen.“ (Aus einem Brief von Carl Friedrich von Rumohr an mich im Oktober 1832.) – Um die Kegel- und Spitzberge näher zu bezeichnen, von denen hier die Rede ist, erinnere ich an die phantastische Landschaft, welche in Leonardo da Vincis allgemein bewundertem Bild der Mona Lisa (Gemahlin des Francesco del Giocondo) den Hintergrund bildet. – Unter denen, welche in der niederländischen Schule die Landschaft vorzugsweise als eine eigene Gattung ausgebildet haben, sind noch Pateniers Nachfolger Herry de Bles, wegen seines Tiermonogramms Civetta genannt, und später die Brüder Matthäus und Paul Bril zu erwähnen, die bei ihrem Aufenthalt in Rom große Neigung zu diesem abgesonderten Zweig der Kunst erweckten. In Deutschland behandelte Albrecht Altdorfer, Dürers Schüler, die Landschaftsmalerei noch etwas früher und mit größerem Erfolg als Patenier.
119 Gemalt für die Kirche San Giovanni e Paolo zu Venedig.
120 Wilhelm von Humboldt, Gesammelte Werke, Bd. IV, S. 37. Vgl. auch über die verschiedenen Stadien des Naturlebens und die durch die Landschaft hervorgerufenen Gemütsstimmungen Carus in seinen geistreichen ›Briefen über die Landschaftsmalerei‹ 1831, S. 45.
121 Das große Jahrhundert der Landschaftsmalerei vereinigte: Johann Breughel 1569–1625, Rubens 1577–1640, Domenichino 1581–1641, Philippe de Champaigne 1602–1674, Nicolas Poussin 1594–1655, Gaspard Poussin (Dughet) 1613–1675, Claude Lorrain 1600–1682, Albert Cuyp 1606–1672, Jan Both 1610–1650, Salvator Rosa 1615–1673, Everdingen 1621–1675, Nicolaus Berghem 1624–1683, Swanevelt 1620–1690, Ruysdael 1635–1681, Minderhoot Hobbema, Jan Wynants, Adriaan van de Velde 1639–1672, Carl Dujardin 1644–1687.
122 Wunderbar phantastische Darstellungen der Dattelpalme, die in der Mitte der Laubkrone einen Knopf haben, zeigt mir ein altes Bild von Cima da Conegliano aus der Schule des Bellino (Dresdner Galerie 1835, No. 40).
123 A. a. Ο., Νο. 917.
124 Franz Post war zu Harlem 1620 geboren. Er starb daselbst 1680. Sein Bruder begleitete ebenfalls den Grafen Moritz von Nassau-Siegen als Architekt. Von den Gemälden waren einige, die Ufer des Amazonenstroms darstellend, in der Bildergalerie von Schleißheim zu sehen; andere sind in Berlin, Hannover und Prag. Die radierten Blätter (in Barlaeus, Reise des Prinzen Moritz von Nassau, und in der königlichen Sammlung der Kupferstiche zu Berlin) zeugen von schönem Naturgefühl in Auffassung der Küstenform, der Beschaffenheit des Bodens und der Vegetation. Sie stellen dar: Musazeen, Kaktus, Palmen, Ficus-Arten mit den bekannten bretterartigen Auswüchsen am Fuß des Stamms, Rhizophora und baumartige Gräser. Die malerische brasilianische Reise endet (Blatt LV) sonderbar genug mit einem deutschen Kiefernwald, der das Schloß Dillenburg umgibt. – Die früher im Text (S. 72) gemachte Bemerkung über den Einfluß, den die Gründung botanischer Gärten in Oberitalien gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts auf die physiognomische Kenntnis tropischer Pflanzengestaltung ausgeübt haben kann, veranlaßt mich, in dieser Note an die wohlbegründete Tatsache zu erinnern, daß der für die Belebung der aristotelischen Philosophie und der Naturkunde gleich verdiente Albertus Magnus im 13. Jahrhundert im Dominikanerkloster zu Köln wahrscheinlich ein warmes Treibhaus besaß. Der berühmte, schon wegen seiner Sprechmaschine der Zauberkunst verdächtige Mann gab nämlich am 6. Januar 1249 dem römischen König Wilhelm von Holland bei seiner Durchreise ein Fest in einem weiten Raum des Klostergartens, in dem er bei angenehmer Wärme Fruchtbäume und blühende Gewächse den Winter hindurch unterhielt. Die Erzählung dieses Gastmahls, ins Wunderbare übertrieben, findet sich in der ›Chronica Joannis de Beka‹ aus der Mitte des 14. Jahrhunderts. (Beka et Heda de Episcopis Ultrajectinis recogn. ab Arn. Buchelio, 1643, p. 79; Jourdain, Recherches critiques sur l’âge des traductions d’Aristote, 1819, p. 331; Buhle, Gesch. der Philosophie, Th. V, S. 296.) Obgleich die Alten, wie einzelne Beispiele aus den Pompejanischen Ausgrabungen lehren, Glasscheiben in Gebäuden anwendeten, so ist bisher doch wohl nichts aufgefunden worden, was in der antiken Kunstgärtnerei den Gebrauch von erwärmten Glas- und Treibhäusern bezeugte. Die Wärmeleitung der caldaria in Bädern hätte auf Anlegung solcher Treibereien und Gewächshäuser leiten können, aber bei der Kürze des griechischen und italienischen Winters wurde das Bedürfnis der künstlichen Wärme im Gartenbau weniger gefühlt. Die Adonisgärten (κήποι Άδώνιδος), für den Sinn des Adonisfestes so bezeichnend, waren nach Böckh „Pflanzungen in kleinen Töpfen, die ohne Zweifel den Garten darstellen sollten, in welchem Aphrodite sich zum Adonis gesellte, dem Symbol der schnell hinwelkenden Jugendblüte, des üppigen Wachstums und des Vergehens. Die Adonien waren also ein Trauerfest der Frauen, eines jener Feste, durch welche das Altertum die hinsterbende Natur betrauerte. Wie wir von Treibhauspflanzen reden im Gegensatz des Naturwüchsigen, so haben die Alten oft sprichwörtlich das Wort Adonisgarten gebraucht, um damit schnell emporgesprossenes, aber nicht zu tüchtiger Reife und Dauer Gediehenes zu bezeichnen. Die Pflanzen, nicht vielfarbige Blumen, nur Lattich, Fenchel, Gerste und Weizen, wurden mit emsiger Pflege zu schnellem Wachstum gebracht, auch nicht im Winter, sondern im vollen Sommer, und in einer Zeit von acht Tagen.“ Creuzer (Symbolik und Mythologie, Th. II, 1841, S. 427, 430, 479 und 481) glaubt indes, daß zur Beschleunigung des Wachstums der Pflanzen in den Adonisgärtchen „starke natürliche und auch wohl künstliche Wärme im Zimmer angewendet wurde“. – Der Klostergarten des Dominikanerklosters in Köln erinnert übrigens an ein grönländisches oder isländisches Kloster des heil. Thomas, dessen immer schneeloser Garten durch natürliche heiße Quellen erwärmt war, wie die fratelli Zeni in ihren, freilich der geographischen Örtlichkeit nach sehr problematischen Reisen (1388–1404) berichten. (Vgl. Zurla, Viaggiatori Veneziani, T. II, pp. 63–69 und Humboldt, Examen crit. de l’hist. de la Géographie, Τ II, p. 127.) – In unseren botanischen Gärten scheint die Anlage eigentlicher Treibhäuser viel neuer zu sein, als man gewöhnlich glaubt. Reife Ananas wurden erst am Ende des 17. Jahrhunderts erzielt (Beckmann, Geschichte der Erfindungen, Bd. IV, S. 287); ja Linné behauptet sogar in der ›Musa Cliffortiana florens Hartecampi‹, daß man Pisang [Banane] in Europa zum ersten Mal zu Wien im Garten des Prinzen Eugen 1731 habe blühen sehen.
125 Diese Ansichten der Tropenvegetation, welche die Physiognomik der Gewächse charakterisieren, bilden im Königl. Museum zu Berlin (Abteilung der Miniaturen, Handzeichnungen und Kupferstiche) einen Kunstschatz, der seiner Eigentümlichkeit und malerischen Mannigfaltigkeit nach bisher mit keiner anderen Sammlung verglichen werden kann. Des Freiherrn von Kittlitz edierte Blätter führen den Titel ›Vegetations-Ansichten der Küstenländer und Inseln des stillen Oceans, aufgenommen 1827–1829 auf der Entdeckungsreise der kais. russ. Corvette Senjäwin‹ (Siegen 1844). Von einer großen Naturwahrheit zeugen auch die Zeichnungen von Carl Bodmer, welche, meisterhaft gestochen, eine Zierde des großen Reisewerks des Prinzen Maximilian zu Wied in das Innere von Nordamerika sind.
126 Humboldt, Ansichten der Natur, 2. Ausg. 1826, Bd. I, S. 7, 16, 21, 36 und 42. Vgl. auch zwei sehr lehrreiche Schriften: Carl Friedrich Philipp von Martius, Physiognomie des Pflanzenreiches in Brasilien, 1824 und Ignaz von Olfers, Allgemeine Uebersicht von Brasilien in Feldners Reisen, 1828, Th. I, S. 18–23.
127 Wilhelm von Humboldt in seinem Briefwechsel mit Schiller, 1830, S. 470.
128 Diodor II, 12. Er gibt aber dem berühmten Garten der Semiramis nur 12 Stadien im Umkreis. Die Paßgegend des Bagistanos heißt noch der Bogen oder Umfang des Gartens, Tauk-i bostan (Droysen, Gesch. Alexanders des Großen, 1833, S. 553).
129 Im Schahnameh des Firdusi heißt es: „Eine schlanke Zypresse, dem Paradies entsprossen, pflanzte Zerduscht vor die Tür des Feuertempels (zu Kischmer in Chorassan). Geschrieben hatte er auf diese hohe Zypresse: Guschtasp habe angenommen den guten Glauben; ein Zeuge wurde somit der schlanke Baum; so verbreitet Gott die Gerechtigkeit. Als viele Jahre darüber verflossen waren, entfaltete sich die hohe Zypresse und wurde so groß, daß des Jägers Fangschnur ihren Umfang nicht faßte. Als ihren Gipfel vielfaches Gezweig umgab, umschloß er sie mit einem Palast von reinem Gold … und ließ ausbreiten in der Welt: ‚Wo auf Erden gibt es eine Zypresse wie die von Kischmer? Aus dem Paradies sandte sie mir Gott und sprach: Neige dich von dort zum Paradies.‘“ (Als der Chalif Motewekkil die den Magiern heilige Zypresse abhauen ließ, gab man ihr ein Alter von 1450 Jahren.) Vgl. Vullers, Fragmente über die Religion des Zoroaster 1831, S. 71 und 114; Ritter, Erdkunde, Th. VI, 1, S. 242. Die ursprüngliche Heimat der Zypresse (arab. Ararholz, persisch serw kohi) scheinen die Gebirge von Busih westlich von Herat zu sein: s. Edrisi, Géogr., trad. par Jaubert, 1836, T. I, p. 464.
130 Achill. Tat. I, 25; Longus, Past. IV, p. 108 Schäfer. „Gesenius (Thes. linguae hebr. T. II, p. 1124) stellt sehr richtig die Ansicht auf, daß das Wort Paradies ursprünglich der altpersischen Sprache angehört habe; in der neupersischen Sprache ist sein Gebrauch verloren gegangen. Firdusi (obgleich sein Name selbst daher genommen) bedient sich gewöhnlich nur des Wortes behischt; aber für den altpersischen Ursprung zeugen sehr ausdrücklich Pollux im Onomast., IX, 3 und Xenophon, Oecon. 4, 13 und 21; Anab. I. 2, 7 und I. 4, 10; Cyrop. I. 4, 5. Als Lustgarten oder Garten ist wahrscheinlich aus dem Persischen das Wort in das Hebräische (pardês Cant. 4, 13; Nehem. 2, 8 und Eccl. 2, 5), Arabische (firdaus, Plur. farâdîsu; vgl. Alcoran 23, 11 und Luc. 23, 43), Syrische und Armenische (partês: s. Ciakciak, Dizionario armeno, 1837, p. 1194 und Schröder, Thes. ling. armen., 1711, praef., p. 56) übergegangen. Die Ableitung des persischen Worts aus dem Sanskrit (pradêa oder paradêa: Bezirk, Gegend oder Ausland), welche Benfey (Griech. Wurzellexikon, Bd. I, 1839, S. 138), Bohlen und Gesenius auch schon anführen, trifft der Form nach vollkommen, der Bedeutung nach aber wenig zu.“ – Buschmann.
131 Herodot VII, 31 (zwischen Kallatebus und Sardes).
132 Ritter, Erdkunde, Th. IV, 2, S. 237, 251 und 681; Lassen, Indische Alterthumskunde, Bd. I, S. 260.
133 Pausanias, I. 21, 9. Vgl. auch Arboretum sacrum in Meursii Opp. ex. recensione Joannis Lami, Vol. X (Florent. 1753), pp. 777–844.
134 Notice historique sur les Jardins des Chinois, in den Mémoires concernant les Chinois, T. VIII, p. 309.
135 A.a.O., pp. 318–320.
136 Sir George Staunton, Account of the Embassy of the Earl of Macartney to China, Vol. II, p. 245.
137 Hermann Fürst von Pückler-Muskau, Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, 1834; vgl. damit seine malerischen Beschreibungen der alten und neuen englischen Parks wie die der ägyptischen Gärten von Schubra.
138 Éloge de la Ville de Moukden, poème composé par l’Empereur Kienlong, traduit par le P. Amiot, 1770, pp. 18, 22–25, 37, 63–68, 73–87, 104 und 120.
139 Mémoires concernant les Chinois, T. II, pp. 643–650.
140 Ph. Fr. von Siebold, Kruidkundige Naamlijst van japansche en chineesche Planten, 1844, p. 4. Welch ein Abstand, wenn man die Mannigfaltigkeit der in Ostasien seit so vielen Jahrhunderten kultivierten Pflanzenformen mit dem Material vergleicht, das Columella in seinem nüchternen Gedicht ›De cultu hortorum‹ (v. 95–105, 174–176, 25–271, 295–306) aufzählt, und auf welches zu Athen die berühmtesten Kranzwinderinnen beschränkt waren! Erst unter den Ptolemäern scheint in Ägypten, besonders in Alexandrien, das Bestreben nach Mannigfaltigkeit und Winterkultur bei den Kunstgärten größer geworden zu sein. (Vgl. Athen. V, p. 196.)