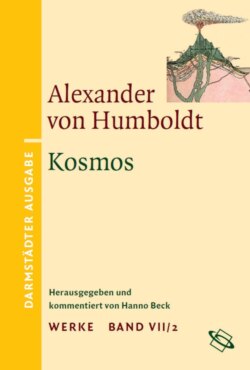Читать книгу Werke - Alexander Humboldt - Страница 12
III Kultur von Tropengewächsen – Kontrastierende Zusammenstellung der Pflanzengestalten – Eindruck des physiognomischen Charakters der Vegetation, soweit Pflanzungen diesen Eindruck hervorbringen können
ОглавлениеDie Wirkung der Landschaftsmalerei ist trotz der Vervielfältigung ihrer Erzeugnisse durch Kupferstiche und durch die neueste Vervollkommnung der Lithographie doch beschränkter und minder anregend als der Eindruck, welchen der unmittelbare Anblick exotischer Pflanzengruppen in Gewächshäusern und freien Anlagen auf die für Naturschönheit empfänglichen Gemüter macht. Ich habe mich schon früher auf meine eigene Jugenderfahrung berufen; ich habe daran erinnert, wie der Anblick eines kolossalen Drachenbaums und einer Fächerpalme in einem alten Turm des Botanischen Gartens bei Berlin den ersten Keim unwiderstehlicher Sehnsucht nach fernen Reisen in mich gelegt hatte. Wer ernst in seinen Erinnerungen zu dem hinaufsteigen kann, was den ersten Anlaß zu einer ganzen Lebensbestimmung gab, wird diese Macht sinnlicher Eindrücke nicht verkennen.
Ich unterscheide hier den pittoresken Eindruck der Pflanzengestaltung von den Hilfsmitteln des anschaulichen botanischen Studiums; ich unterscheide Pflanzengruppen, die sich durch Größe und Masse auszeichnen (aneinander gedrängte Gruppen von Pisang und Helikonien, abwechselnd mit Koryphapalmen, Araukarien und Mimosazeen; moosbedeckte Stämme, aus denen Drakontien, feinlaubige Farnkräuter und blütenreiche Orchideen hervorsprossen), von der Fülle einzeln stehender niederer Kräuter, welche familienweise in Reihen zum Unterricht in der beschreibenden und systematischen Botanik kultiviert werden. Dort ist die Betrachtung vorzugsweise geleitet auf die üppige Entwicklung der Vegetation in Cekropien, Karolineen und leichtgefiederten Bambusen, auf die malerische Zusammenstellung großer und edler Formen, wie sie den oberen Orinoco oder die von Martius und Eduard Poeppig so naturwahr beschriebenen Waldufer des Amazonenflusses und des Huallaga schmücken, auf die Eindrücke, welche das Gemüt mit Sehnsucht nach den Ländern erfüllen, in denen der Strom des Lebens reicher fließt und deren Herrlichkeit unsere Gewächshäuser (einst Krankenanstalten für halbbelebte gärende Pflanzenstoffe) in schwachem, doch freudigem Abglanz darbieten.
Der Landschaftsmalerei ist es allerdings gegeben, ein reicheres, vollständigeres Naturbild zu liefern, als die künstlichste Gruppierung kultivierter Gewächse es zu tun vermag. Die Landschaftsmalerei gebietet zauberisch über Masse und Form. Fast unbeschränkt im Raum, verfolgt sie den Saum des Waldes bis in den Duft der Ferne; sie stürzt den Bergstrom herab von Klippe zu Klippe und ergießt das tiefe Blau des tropischen Himmels über die Gipfel der Palmen wie über die wogende, den Horizont begrenzende Grasflur. Die Beleuchtung und die Färbung, welche das Licht des dünnverschleierten oder reinen Himmels unter den Wendekreisen über alle irdischen Gegenstände verbreitet, gibt der Landschaftsmalerei, wenn es dem Pinsel gelingt, diesen milden Lichteffekt nachzuahmen, eine eigentümliche, geheimnisvolle Macht. Bei tiefer Kenntnis vom Wesen des griechischen Trauerspiels hat man sinnig den Zauber des Chors in seiner allvermittelnden Wirkungsweise mit dem Himmel in der Landschaft verglichen127.
Die Vervielfältigung der Mittel, welche der Malerei zu Gebote steht, um die Phantasie anzuregen und die großartigsten Erscheinungen von Meer und Land gleichsam auf einen kleinen Raum zu konzentrieren, ist unseren Pflanzungen und Gartenanlagen versagt; aber wo in diesen der Totaleindruck des Landschaftlichen geringer ist, entschädigen sie im einzelnen durch die Herrschaft, welche überall die Wirklichkeit über die Sinne ausübt. Wenn man im Palmenhaus von Loddiges oder in dem der PfaueninselVIII bei Potsdam (einem Denkmal des einfachen Naturgefühls unseres edlen, hingeschiedenen Monarchen) vom hohen Altan bei heller Mittagssonne auf die Fülle schilf- und baumartiger Palmen herabblickt, so ist man auf Augenblicke über die Örtlichkeit, in der man sich befindet, vollkommen getäuscht. Man glaubt unter dem Tropenklima selbst, vom Gipfel eines Hügels herab ein kleines Palmengebüsch zu sehen. Man entbehrt freilich den Anblick der tiefen Himmelsbläue, den Eindruck einer größeren Intensität des Lichts; dennoch ist die Einbildungskraft hier noch tätiger, die Illusion größer als beim vollkommensten Gemälde. Man knüpft an jede Pflanzenform die Wunder einer fernen Welt; man vernimmt das Rauschen der fächerartigen Blätter, man sieht ihre wechselnd schwindende Erleuchtung, wenn, von kleinen Luftströmen sanft bewegt, die Palmengipfel wogend einander berühren. So groß ist der Reiz, den die Wirklichkeit gewähren kann, wenn auch die Erinnerung an die künstliche Treibhauspflege wiederum störend einwirkt. Vollkommenes Gedeihen und Freiheit sind unzertrennliche Ideen auch in der Natur; und für den eifrigen, vielgereisten Botaniker haben die getrockneten Pflanzen eines Herbariums, wenn sie auf den Cordilleren von Südamerika oder in den Ebenen Indiens gesammelt wurden, oft mehr Wert als der Anblick derselben Pflanzenart, wenn sie einem europäischen Gewächshaus entnommen ist. Die Kultur verwischt etwas vom ursprünglichen Naturcharakter, sie stört in der gefesselten Organisation die freie Entwicklung der Teile.
Die physiognomische Gestaltung der Gewächse und ihre kontrastierende Zusammenstellung ist aber nicht bloß ein Gegenstand des Naturstudiums oder ein Anregungsmittel zu demselben; die Aufmerksamkeit, welche man der Pflanzenphysiognomik schenkt, ist auch von großer Wichtigkeit für die Landschaftsgärtnerei, d.h. für die Kunst, eine Gartenlandschaft zu komponieren. Ich widerstehe der Versuchung, in dieses, freilich sehr nahegelegene Feld zu überschweifen, und begnüge mich hier, nur in Erinnerung zu bringen, daß, wie wir bereits am Anfang dieser Abhandlung Gelegenheit fanden, die häufigeren Ausbrüche eines tiefen Naturgefühls bei den semitischen, indischen und iranischen Völkern zu preisen, so uns auch die Geschichte die frühesten Parkanlagen im mittleren und südlichen Asien zeige. Semiramis hatte am Fuß des Berges Bagistanos Gärten anlegen lassen, welche Diodor beschreibt128 und deren Ruf Alexander auf seinem Zug von Kelonä nach den Nysäischen Pferdeweiden veranlaßte, sich vom geraden Weg zu entfernen. Die Parkanlagen der persischen Könige waren mit Zypressen geschmückt, deren obeliskartige Gestalt an Feuerflammen erinnerte und die deshalb nach der Erscheinung des Zerduscht (Zoroaster) zuerst von Guschtasp um das Heiligtum der Feuertempel gepflanzt wurden. So leitete die Baumform selbst auf die Mythe vom Ursprung der Zypresse aus dem Paradies129. Die asiatischen irdischen Paradiese (παράδεισοι) hatten schon früh einen Ruf in den westlichen Ländern130; jeder Baumdienst steigt bei den Iranern bis zu den Vorschriften des Hom, des im ›Zend-Avesta‹ angerufenen Verkünders des alten Gesetzes, hinauf. Man kennt aus Herodot die Freude, welche Xerxes noch an der großen Platane in Lydien hatte131, die er mit goldenem Schmuck beschenkte und der er in der Person eines der „zehntausend Unsterblichen“ einen eigenen Wächter gab. Die uralte Verehrung der Bäume hing wegen des erquickenden und feuchten Schattens eines Laubdachs mit dem Dienst der heiligen Quellen zusammen.
In einen solchen Kreis des ursprünglichen Naturdienstes gehören bei den hellenischen Völkern der Ruf des wundergroßen Palmbaums auf Delos wie der einer alten Platane in Arkadien. Die Buddhisten auf Ceylon verehren den kolossalen indischen Feigenbaum (Banyane) von Anurahdepura. Es soll derselbe aus Zweigen des Urstamms entsprossen sein, unter welchem Buddha als Bewohner des alten Magadha in Seligkeit (Selbstverlöschung, nirwâna) versunken war132. Wie einzelne Bäume wegen ihrer schönen Gestalt ein Gegenstand der Heiligung waren, so wurden es Gruppen von Bäumen als Haine der Götter. Pausanias ist voll des Lobs von einem Hain des Apollotempels zu Grynion in Aeolis133; der Hain von Kolonos wird im berühmten Chor des Sophokles gefeiert.
Wie sich nun das Naturgefühl in der Auswahl und sorgfältigen Pflege geheiligter Gegenstände des Pflanzenreichs aussprach, so offenbarte es sich noch lebendiger und mannigfaltiger in den Gartenanlagen früh kultivierter ostasiatischer Völker. Im fernsten Teil des Alten Kontinents scheinen sich die chinesischen Gärten am meisten dem genähert zu haben, was wir jetzt englische Parks zu nennen pflegen. Unter der siegreichen Dynastie der Han hatten freie Gartenanlagen so viele Meilen im Umfang, daß der Ackerbau durch sie gefährdet134 und das Volk zum Aufruhr angeregt wurde. „Was sucht man“, sagt ein alter chinesischer Schriftsteller, Lieutscheu, „in der Freude an einem Lustgarten? In allen Jahrhunderten ist man darin übereingekommen, daß die Pflanzung den Menschen für alles Anmutige entschädigen soll, was ihm die Entfernung vom Leben in der freien Natur, seinem eigentlichen und liebsten Aufenthalt, entzieht. Die Kunst, den Garten anzulegen, besteht also im Bestreben, Heiterkeit (der Aussicht), Üppigkeit des Wachstums, Schatten, Einsamkeit und Ruhe so zu vereinigen, daß durch den ländlichen Anblick die Sinne getäuscht werden. Die Mannigfaltigkeit, welche der Hauptvorzug der freien Landschaft ist, muß also gesucht werden in der Auswahl des Bodens, im Wechsel von Hügelketten und Talschluchten, von Bächen und Seen, die mit Wasserpflanzen bedeckt sind. Alle Symmetrie ist ermüdend; Überdruß und Langeweile werden in Gärten erzeugt, in welchen jede Anlage Zwang und Kunst verrät.“135 Eine Beschreibung, welche uns Sir George Staunton vom großen kaiserlichen Garten von Zhe-hol136, nördlich von der Chinesischen Mauer, gegeben hat, entspricht jenen Vorschriften des Lieu-tscheu: Vorschriften, denen einer unserer geistreichen Zeitgenossen, der Schöpfer des anmutigen Parks von Muskau137, seinen Beifall nicht versagen wird.
In dem großen beschreibenden Gedicht, in welchem der Kaiser Kienlong um die Mitte des verflossenen Jahrhunderts die ehemalige mandschurische Residenzstadt Mukden und die Gräber seiner Vorfahren verherrlichen wollte, spricht sich ebenfalls die innigste Liebe zu einer freien, durch die Kunst nur sehr teilweise verschönerten Natur aus. Der poetische Herrscher weiß in gestaltender Anschaulichkeit zu verschmelzen die heiteren Bilder von der üppigen Frische der Wiesen, von waldbekränzten Hügeln und friedlichen Menschenwohnungen mit dem ernsten Bild der Grabstätte seiner Ahnherrn. Die Opfer, welche er diesen bringt, nach den von Konfuzius vorgeschriebenen Riten, die fromme Erinnerung an die hingeschiedenen Monarchen und Krieger sind der eigentliche Zweck dieser merkwürdigen Dichtung. Eine lange Aufzählung der wildwachsenden Pflanzen wie der Tiere, welche die Gegend beleben, ist wie alles Didaktische ermüdend; aber das Verweben des sinnlichen Eindrucks von der Landschaft, die gleichsam nur als Hintergrund des Gemäldes dient, mit erhabenen Objekten der Ideenwelt, mit der Erfüllung religiöser Pflichten, mit Erwähnung großer geschichtlicher Ereignisse gibt der ganzen Komposition einen eigentümlichen Charakter. Die beim chinesischen Volk so tief eingewurzelte Heiligung der Berge führt Kein-long zu sorgfältigen Schilderungen der Physiognomik der unbelebten Natur, für welche die Griechen und Römer keinen Sinn hatten. Auch die Gestaltung der einzelnen Bäume, die Art ihrer Verzweigung, die Richtung der Äste, die Form ihres Laubs werden mit besonderer Vorliebe behandelt138.
Wenn ich der leider (!) zu langsam unter uns verschwindenden Abneigung gegen die chinesische Literatur nicht nachgebe und bei den Naturansichten eines Zeitgenossen Friedrichs des Großen nur zu lange verweilt bin, so ist es hier um so mehr meine Pflicht, sieben und ein halbes Jahrhunderte weiter hinaufzusteigen und an das Gartengedicht des See-ma-kuang, eines berühmten Staatsmanns, zu erinnern. Die Anlagen, welche das Gedicht beschreibt, sind freilich teilweise voller Baulichkeiten, nach Art der alten italischen Villen; aber der Minister besingt auch eine Einsiedelei, die zwischen Felsen liegt und von hohen Tannen umgeben ist. Er lobt die freie Aussicht auf den breiten, vielbeschifften Strom Kiang; er fürchtet selbst die Freunde nicht, wenn sie kommen, ihm ihre Gedichte vorzulesen, weil sie auch die seinigen anhören139. See-ma-kuang schrieb um das Jahr 1086, als in Deutschland die Poesie, in den Händen einer rohen Geistlichkeit, nicht einmal in der vaterländischen Sprache auftrat.
Damals, und vielleicht ein halbes Jahrtausend früher, waren die Bewohner von China, Hinterindien und Japan schon mit einer großen Mannigfaltigkeit von Pflanzenformen bekannt. Der innige Zusammenhang, welcher sich zwischen den buddhistischen Mönchsanstalten erhielt, übte auch in diesem Punkt seinen Einfluß aus. Tempel, Klöster und Begräbnisplätze wurden von Gartenanlagen umgeben, welche mit ausländischen Bäumen und einem Teppich vielfarbiger, vielgestalteter Blumen geschmückt war. Indische Pflanzen wurden schon früh nach China, Korea und Nippon verbreitet. Siebold, dessen Schriften einen weitumfassenden Überblick aller japanischen Verhältnisse liefern, hat zuerst auf die Ursache einer Vermischung der Floren entlegener buddhistischer Länder aufmerksam gemacht140.
Der Reichtum von charakteristischen Pflanzenformen, welche unsere Zeit der wissenschaftlichen Beobachtung wie der Landschaftsmalerei darbietet, muß lebhaft anreizen, den Quellen nachzuspüren, welche uns diese Erkenntnis und diesen Naturgenuß bereiten. Die Aufzählung dieser Quellen bleibt der nächstfolgenden Abteilung dieses Werks, der Geschichte der Weltanschauung, vorbehalten. Hier kam es darauf an, im Reflex der Außenwelt auf das Innere des Menschen, auf seine geistige Tätigkeit und seine Empfindungsweise die Anregungsmittel zu schildern, welche bei fortschreitender Kultur so mächtig auf die Belebung des Naturstudiums eingewirkt haben. Die urtiefe Kraft der Organisation fesselt trotz einer gewissen Freiwilligkeit im Entfalten einzelner Teile alle tierische und vegetabilische Gestaltung an feste, ewig wiederkehrende Typen; sie bestimmt in jeder Zone den ihr eingeprägten, eigentümlichen Charakter, d. i. die Physiognomik der Natur. Deshalb gehört es unter die schönsten Früchte europäischer Völkerbildung, daß es dem Menschen möglich geworden ist, sich fast überall, wo ihn schmerzliche Entbehrung bedroht, durch Kultur und Gruppierung exotischer Gewächse, durch den Zauber der Landschaftsmalerei und durch die Kraft des begeisterten Worts einen Teil des Naturgenusses zu verschaffen, den auf fernen, oft gefahrvollen Reisen durch das Innere der Kontinente die wirkliche Anschauung gewährt.
| I | Der Begriff des Allgemeinen ist von größter Bedeutung für das Verständnis des Kosmos. Er war schon für die Idee der Physikalischen Geographie grundlegend. |
| II | Humboldt kannte mehrere Ursachen der Entdeckungen, worunter diese durchaus berechtigt erscheint, vor allem, wenn man die Naivität und Einseitigkeit ideologischer Geschichtsschreibung bedenkt. |
| III | John Mandeveille (eigentlich Jean de Bourgoigne, gest. 1372) hatte zwar nur Ägypten selbst gesehen, errang aber als Autor neben Marco Polo vor dem Zeitalter der großen Entdeckungen den größten Erfolg aufgrund geschickter Auswertung schriftlicher und mündlicher Quellen; bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts wurde seine Darstellung irrtümlich als Primärquelle betrachtet. – Die Zahlen in Klammern bedeuten hier die jeweilige Reisezeit; s. Dietmar Henze: Enzyklopädie der Entdecker und Erforscher der Erde, a.a.O., Bd. III, S. 363. |
| IV | Zum gesamten vorhergehenden Zusammenhang s. Hanno Beck: Einführung. Die Kunst entdeckt einen Kontinent. Südamerika im Spiegel der „Physiognomik“ Alexander von Humboldts. Reisegeschichte – Wissenschaft – Kunst. In: Deutsche Künstler in Lateinamerika, Berlin 1978, S.9–12. |
| V | S. Studienausgabe Bd. V, S. 175–297, S. 371–375. |
| VI | S. hierzu Wolf Jobst Siedler: Auf der Pfaueninsel. Spaziergänge in Preußens Arkadien. Berlin 1987; kenntnisreich, leider ohne Hinweis auf Humboldt. |
| VII | S. Hanno Beck: Alexander von Humboldt (1769–1859), Förderer der frühen Photographie. In: Silber und Salz. Köln und Heidelberg 1989, S. 40–59. |
| VIII | Dazu grundlegend Hans Conrad Escher von der Linth: Ansichten und Panoramen der Schweiz. Die Ansichten 1780–1822. Hrsg. v. Gustav Solar. Zürich 1974; Textband unter dem Titel: Die Panoramen und ihre Vorentwicklung. Zürich 1976. |