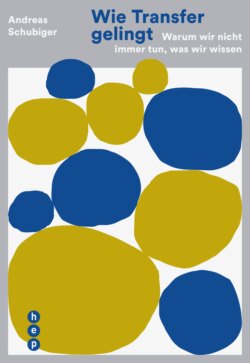Читать книгу Wie Transfer gelingt (E-Book) - Andreas Schubiger - Страница 4
1Vorwort
ОглавлениеLiebe Leserinnen und Leser!
Unter dem Titel «Denn sie tun nicht, was sie wissen» hat Prof. Dr. Dieter Euler (1997) seine Antrittsvorlesung an der Universität Nürnberg gehalten. Seit rund zwanzig Jahren beschäftige ich mich theoretisch wie praktisch mit den Gelingensbedingungen von Transfer im Allgemeinen und im Spezifischen mit der Gestaltung von transferwirksamen Lernumgebungen für auszubildende Lehrpersonen.
Dieter Euler (1997) hat schon in der oben erwähnten Antrittsvorlesung darauf hingewiesen, dass wirtschaftspädagogische Theorien sich nicht in der Berufsschulpraxis niederschlagen, sie teils bewusst ignoriert werden und sich auch nicht in Lehrplanentwicklungen entfalten. Wissen, welches nicht in Handeln umgesetzt wird, wurde im gleichen Jahrzehnt mit dem Begriff des «trägen Wissens» umschrieben (Renkl, 1996). Euler sah bereits damals die Gründe in der
•Unzulänglichkeit der Theorien selbst, weil sie von Natur aus allgemein formuliert sind und in der Praxis wieder ins Spezifische transformiert werden müssen. Theorien sind von Natur aus keine konkreten Handlungsanweisungen.
•Diskrepanz zwischen intersubjektiven Theorien und den subjektiven Vorstellungen von gutem Lehren und Lernen und den dazugehörenden schwer veränderbaren Einstellungen.
•Unvollständigkeit der Theorie durch ihre Vergangenheitsorientierung und eher fachlogischen Ausrichtung – die Praxis ist jedoch aktuell, mehrdimensional, multidisziplinär und komplex.
•Unübersichtlichkeit und Widersprüchlichkeit einer Vielzahl von Theorien, die Praktiker überfordern.
Als Lösungsansatz zur Bewältigung dieser Schwierigkeit schlägt Euler eine neue Theorie-Praxis-Kooperation vor, wonach die Ausbildung von Lehrpersonen weniger dem Primat der Praxisanwendung von Theorie dient, sondern vielmehr der Veränderung der Praxis unter kritischer Reflexion der Theorie. Die Praxis ist nicht nur Produkt, sondern vielmehr auch Ausgangspunkt der Ausbildung.
Genau in diesem Sinne beginne ich mein Buch mit fünf Geschichten aus dem Alltag, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Sie beschreiben das Gelingen und Misslingen der Umsetzung von guten Absichten im Sinne von Wissen und Theorien. Die Geschichten sind soweit anonymisiert und verfremdet, dass die tatsächlich dahinter liegenden Ereignisse nicht identifizierbar sind. Diejenigen, die mich ein wenig besser kennen, werden ein paar autobiographische Elemente entdecken. Sollten Sie sich als Leserin oder Leser in der einen oder anderen Geschichte entdecken, dann ist dies rein zufällig, jedoch vom Autor nicht unbedingt ungewollt.
Transfer ist nicht einfach die Umsetzung guter Theorien in kompetentes Handeln. Transfer vollzieht sich in beide Richtungen, in unterschiedlichsten Formen und Distanzen. Die aktuelle Diskussion im Rahmen der Digitalisierungsdebatte wirft die Frage auf, welche Kompetenzen im 21. Jahrhundert von Berufsleuten gefordert werden. In diesem Kontext taucht das Konzept der «transversalen Kompetenzen» auf, die zwar in einer spezifischen Situation gelernt wurden, aber auch in neuen und andersartigen Anforderungssituationen abrufbar sein sollen (Schweri u. a., 2018). Diese Diskussion und Forderung nach generell anwendbaren Kompetenzen sind nicht neu. Bereits in den 80er-Jahren des letzten Jahrhunderts war das Konzept der Schlüsselqualifikationen eine ähnliche Antwort auf die sich immer schneller ändernden Anforderungen der Arbeitswelt.
Ich werde immer wieder gefragt, warum ich nochmals ein Buch schreibe. Nebst vielen mir wahrscheinlich unbewussten oder teilbewussten Beweggründen ist es für mich auch ein Ordnen der vielen Gedanken, Theorien, Erfahrungen und Konzepte aus meiner täglichen beruflichen Tätigkeit. Insofern sind die Kapitel über den Begriff des Transfers, die empirische Forschung bezüglich des Transfers und die theoretischen Begründungen, warum Transfer misslingt oder eben auch gelingen kann, auch für mich geschrieben – in der Annahme, dass diese Auslegordnung für Interessierte wie Ausbilderinnen und Ausbilder von Ausbildern, Lehrpersonen, Curriculumsentwickler und Lebensoptimierer anschlussfähig ist.
Der praktische Teil versucht eine Didaktik des Transfers zu entwickeln, die die rezipierten Theorien und empirischen Ergebnisse in handlungsleitendes Wissen für Praktiker überführt. Susan Rosen und ich entwickelten vor fünf Jahren das didaktische Konzept PERLE, das den Transfer an den Anfang und als Leitgedanken für die Ausarbeitung eines Ausbildungskonzeptes nahm. Wir konnten dieses Konzept erfolgreich in einem zweijährigen Bildungsgang umsetzen.
PERLE steht als Akronym für
•Projektorientierung
•Entwicklungsorientierung
•Ressourcenorientierung
•Lernen
•Ergebnisorientierung
Die PERLE ist aber nicht nur ein Akronym, sondern steht auch für ein Wunder der Natur.
Perlen entstehen ja auf natürliche Weise in spezifischen Muschelarten wie z. B. der Perlenauster. Wenn ein fremdes Objekt wie z. B. ein Sandkorn in die Schale der Auster hineinschlüpft, stösst die Muschel entweder den Eindringling aus oder schützt sich selbst, indem sie den Fremdkörper über eine längere Zeit mit Schichten von Perlmutt – der Substanz, aus dem ihre Schale besteht – umhüllt. Die Zufälligkeit, die Seltenheit und die grosse Nachfrage haben den Menschen seit je dazu bewegt, die Perle künstlich in Muscheln zu züchten, indem sie durch Implantieren von Fremdkörpern die Muscheln zur Perlenbildung animieren. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Ausbildung von Perlen von 1:15’000 auf 1:100.
Auch wenn Vergleiche dieser Art immer auch etwas gewagt sind – und häufig missverstanden werden – versuche ich in Analogie zur Perlenzucht dieses Wagnis doch:
•Transfer geschieht in der bidirektionalen Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Individuum und Lern- und Funktionsumgebung. Er geschieht spontan, aber sehr selten – wie die Bildung einer Naturperle oder wie bei der Zucht einer Perle initiiert durch eine Transferdidaktik.
•Die Transferwahrscheinlichkeit kann durch äussere Interventionen erhöht werden. Mit einem angeleiteten Transfer setzen wir das Sandkorn.
•Die Ausbildung eines weiten Transfers ist wie bei der Ausbildung einer Perle eine langwierige Angelegenheit.
•Ein weiter Transfer ist ein nicht alltägliches Ereignis – die Auftretenswahrscheinlichkeit kann durch eine geschickte Transferdidaktik wie bei der Zuchtperle erhöht werden.
•Das Sandkorn ist der Kristallisationspunkt eines Prozesses, der zuerst als störend (Widerstand, Aufwand, Verunsicherung) empfunden werden kann. Schlussendlich entsteht aus der Störung etwas Neues. Auch beim Transfer kann die Anforderung für das betroffene Individuum störend sein, Widerstände auslösen und von ihr einen grossen Veränderungsaufwand verlangen.
Ich hoffe, dass ich mit diesem Buch die eine oder andere Anregung zur «Perlenzucht» im eigenen Ausbildungs- und Lebensalltag geben kann. Für den konkreten Alltag soll die bewährte Methodensammlung auch eine ganz praktische Hilfestellung sein – im Wissen, dass aber das alleinige Anwenden dieser Methoden den Transfer noch nicht realisiert. In dem Moment, indem ich diese Zeilen zum Vorwort schreibe, lese ich über «Spiegel online», dass Finnland ab der Oberstufe die Fächer abschaffen will. Zukünftig arbeiten Lernende nur noch in interdisziplinärem «Phänomenunterricht». Vielleicht noch interessant: Mitarbeitende Lehrpersonen erhalten dafür eine Lohnerhöhung (2018, Spiegel online).
Ich habe die Arbeit an diesem Buchprojekt vor vier Jahren begonnen. Das Ziel, das Buch bereits Ende 2016 zu publizieren, verpasste ich deutlich. In diesen vier Jahren verschwand das Schreiben in den Hintergrund, weil das Leben mir gesundheitliche und berufliche Herausforderungen bereitstellte. Die Erfahrung der Endlichkeit und die Erkenntnis, dass Anhaften Leiden schafft, nehme ich mit grösster Demut an. All den lieben Menschen, die mich in dieser anspruchsvollen Zeit aktiv unterstützten und einfach da waren, bin ich mit grösster Dankbarkeit verbunden.