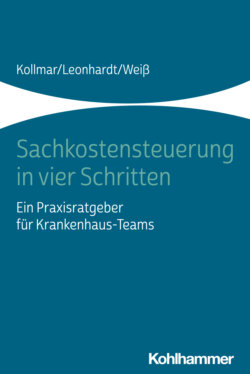Читать книгу Sachkostensteuerung in vier Schritten - Andreas Weis - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление2 Wie sind Sachkosten definiert? Welche Sachkosten können wir beeinflussen und steuern?
2.1 Definition
Wenn wir von Sachkosten-Controlling sprechen, müssen wir uns zunächst klarmachen, was mit Sachkosten gemeint ist. Eine Definition liefert das Statistische Bundesamt (Destatis) in seiner jährlich aktualisierten Reihe »Kostennachweis der Krankenhäuser – Fachserie 12 Reihe 6.3«. Demnach werden als Sachkosten die folgenden Kostenarten bezeichnet:
Lebensmittel und bezogene Leistungen
Medizinischer Bedarf
Wasser, Energie und Brennstoffe
Wirtschaftsbedarf
Verwaltungsbedarf
Zentrale Verwaltungsdienste
Zentrale Gemeinschaftsdienste
Wiederbeschaffte Gebrauchsgüter
Pflegesatzfähige Instandhaltung
Versicherungen
Sonstige Abgaben
Sonstige Sachkosten
Nachrichtliche Sachkosten
Diese Sachkosten umfassen insgesamt mehr als ein Drittel der Krankenhauskosten (2017: 37,0 %) und verteilen sich wie in Abbildung 2.1 dargestellt (Abb. 2.1).
Uns interessiert hier insbesondere der zweite Punkt, der medizinische Bedarf. Dazu gehören laut Destatis:
Arzneimittel
Blut/Blutkonserven/Blutplasma
Verband-, Heil- und Hilfsmittel
Ärztliches und pflegerische Verbrauchsmaterial/Instrumente
Narkose- und sonstiger OP-Bedarf
Laborbedarf
Implantate
Transplantate
Dialysebedarf
Kosten für Krankentransporte
Sonstiger medizinischer Bedarf
In der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) ist der medizinische Bedarf der Kontenklasse 66 zugeordnet, die in Kapitel 5.3 beschrieben wird ( Kap. 5.3). Die Gliederung nach der KHBV ist umfassender als die Destatis-Definition. Mehrere KHBV-Positionen, z. B. Untersuchungen in fremden Instituten, sind in der Krankenhausstatistik vom Destatis nicht zu identifizieren.
Abb. 2.1: Verteilung der Sachkosten (Statistisches Bundesamt, Destatis 2018)
2.2 Pseudo-Sachkosten
Die Definitionen nach Destatis und KHBV decken sich größtenteils, aber nicht vollständig mit dem, was auch Ärzte und Pflegekräfte üblicherweise unter »Sachbedarf« verstehen: nämlich die Artikel, die unmittelbar für die Patientenversorgung eingesetzt werden, d. h. »alles, was man anfassen kann«. Es gibt allerdings einige Positionen, die nicht unmittelbar diesem Allgemeinverständnis von »Sachkosten« entsprechen, z. B. Transportkosten, insbesondere aber die »Untersuchungen in fremden Instituten«, also z. B. Aufwendungen für externe Laboratorien, und »Honorare für nicht im Krankenhaus angestellte Ärzte«. Wir bezeichnen diese Positionen hier als »Pseudo-Sachkosten«. Buchhalterisch ist es korrekt und erforderlich, diese Aufwendungen als Sachkosten zu buchen. Wenn wir allerdings mit den klinisch Verantwortlichen über die Mengensteuerung »vor Ort« auf den Stationen, im OP usw. diskutieren, so möchten wir uns in der Regel mit dem Sachbedarf im engeren Sinn beschäftigen. Die Pseudo-Sachkosten könnten bei der Analyse des Sachkostenberichts einer Abteilung störend und verzerrend wirken.
Offensichtlich ist dies beim Einsatz von Personaldienstleistern. In der Regel arbeiten diese nicht längerfristig im gleichen Krankenhaus, sondern werden bei Bedarf, also bei Unterbesetzung häufig in der Pflege, mehr oder wenig kurzfristig verpflichtet. Der Einsatz der Personaldienstleister ist nur begrenzt von den vor Ort für den Sachkosteneinsatz verantwortlichen ärztlichen und pflegerischen Mitarbeitern beeinflussbar, da er vorwiegend von der Situation auf dem Arbeitsmarkt abhängt. Somit würden in einer Darstellung des gesamten medizinischen Bedarfs die Kosten für diese Dienstleistungen die eigentliche Zielgröße, nämlich den vor Ort beeinflussbaren Materialeinsatz, verfälschen. Insbesondere erschwert die Integration der Pseudo-Sachkosten einen Krankenhausvergleich. Der Einsatz von externem Personal und die Inanspruchnahme externer Institute fällt von Haus zu Haus äußerst unterschiedlich aus.
2.3 Bereinigter medizinischer Sachbedarf (BMES)
Wenn wir nun ein Controlling des medizinischen Sachbedarfs aufbauen, so müssen wir uns grundsätzlich überlegen, ob und wie die oben beschriebenen Pseudo-Sachkosten im eigenen Krankenhaus berücksichtigt werden sollen. Wir empfehlen, diese Positionen sowohl im Sachkostenbericht ( Kap. 5) als auch bei der Definition der relevanten Kennzahlen und bei der Diskussion der Ergebnisse in den Sachkostendialogen separat zu betrachten und nicht mit den Sachkosten im engeren Sinn zu vermischen. Zu diesem Zweck führen wir den Begriff des »Bereinigten medizinischen Sachbedarfs« (BMES) ein. Den BMES definieren wir als Differenz der Sachkosten im Sinne der Kontenklasse 66 abzüglich der Pseudo-Sachkosten – sofern diese auf Kontenebene differenziert werden können. Eine mögliche Definition des BMES ist wie folgt:
Summe der Kontengruppe 66 abzüglich
Aufwand zur Bildung von Rückstellungen
Untersuchungen in fremden Instituten
Konsile
Bezogenes Personal, Honorare
Sekundärleistungen
Transportkosten
Wareneinsatz für Externe
= Bereinigter medizinischer Sachbedarf (BMES).
Für die Umsetzung im Krankenhaus bietet es sich an, den BMES als Positivliste auf Basis der vierstelligen Kontengruppen zu definieren. Das bedeutet, dass z. B. die folgenden Bereiche dem BMES zugeordnet werden:
6600 Arzneimittel (außer Implantate und Dialysebedarf)
6602 Blut, Blutkonserven und Blutplasma
6603 Verbandmittel, Heil- und Hilfsmittel
6604 Ärztliches und pflegerisches Verbrauchsmaterial, Instrumente
6606 Narkose- und sonstiger OP-Bedarf
6608 Laborbedarf
6613 Implantate
6614 Transplantate
Diese Differenzierung zwischen BMES und Pseudo-Sachkosten sollte im Reporting-Tool (Data Warehouse) relativ einfach darzustellen sein, indem die genannten Kontengruppen einmalig entsprechend gekennzeichnet werden. Sie können dann auf den verschiedenen Berichtsebenen (s. u.) isoliert ausgewertet werden.
Praxistipp
Definieren Sie für Ihr Sachkosten-Controlling, was zum BMES gehört, und verwenden Sie diese Definition auf allen Berichtsebenen immer einheitlich!
Die Ausgliederung der Pseudo-Sachkosten im Sinne des BMES bedeutet aber nicht, dass diese Positionen im Sachkostenbericht und in den Sachkostendialogen unberücksichtigt bleiben sollten. Vielmehr bietet es sich an – wenn die Kosten im jeweiligen Bereich relevant sind – eigene Statistiken z. B. für die Untersuchungen in fremden Instituten zu erstellen. Wie auch bei den anderen Sekundärleistungen (Labor, Radiologie usw.) handelt sich bei den Untersuchungen in fremden Instituten um beeinflussbare Kosten, die transparent gemacht und interdisziplinär besprochen werden sollten.
2.4 Entwicklung der Sachkosten in deutschen Krankenhäusern
Die Gesamtaufwendungen für medizinische Sachkosten in deutschen Krankenhäusern liegen mit 19,9 Mrd. Euro (hier Jahr 2017) fast genauso hoch wie für den gesamten Ärztlichen Dienst (20,44 Mrd. Euro) und höher als der Pflegedienst (19,16 Mrd. Euro). Die Steigerungsrate liegt bei 5,8 % pro Jahr über die letzten 15 Jahre hinweg.
Zur Frage, wie sich die Sachkosten in deutschen Krankenhäusern entwickeln, können unterschiedliche Datenquellen herangezogen werden, u. a. die Daten des Statistischen Bundesamtes (Destatis 2019), welche in Tabelle 2.1a und Tabelle 2.1b zusammengefasst sind ( Tab. 2.1a, Tab. 2.1b).
Tab. 2.1a: Entwicklung der Personal- und Sachkosten in den deutschen Krankenhäusern
Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis 2019
Tab. 2.1b: Entwicklung der wichtigsten Kostenarten des medizinischen Sachbedarfs in deutschen Krankenhäusern
Quelle: Statistisches Bundesamt Destatis 2019
Andere Datenquellen sind die InEK-Kalkulation (Sachkostenanteile im Report Browser) oder Studien. So analysiert die Inverto GmbH regelmäßig die Destatis-Daten (Inverto 2017). Die wesentlichen Ergebnisse dieser Analysen sind:
1. Die Sachkosten steigen in den letzten Jahren deutlich stärker als die Personalkosten ( Abb. 2.2).
2. Große Krankenhäuser weisen generell höhere Kosten pro Bett auf als mittlere und kleine Häuser.
3. In großen Krankenhäusern steigen die Sachkosten erheblich weniger stark als bei kleineren Häusern.
4. Privat geführte Kliniken haben eine deutlich geringere Kostenbasis pro Bett.
Abb. 2.2: Entwicklung der Sach- und Personalkosten in deutschen Krankenhäusern. (Quelle: Destatis, Darstellung: Inverto GmbH)
Die beschriebene Entwicklung widerspricht auf den ersten Blick der Aussage vieler Krankenhaus-Geschäftsführungen, dass vor allem die Personalkosten in den letzten Jahren gegenüber der Entwicklung der Basisfallwerte überproportional gestiegen seien. Bei der Bewertung der Studienergebnisse ist zu berücksichtigen, dass, wie oben beschrieben, nach Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) auch externe Dienstleistungen, Honorarärzte, Leistungen ausgegründeter Abteilungen usw. als Sachkosten gebucht werden. Wenn also in den deutschen Krankenhäusern in den letzten Jahren vermehrt Honorarkräfte beschäftigt wurden, Sekundärleistungen wie z. B. Radiologie und Labor an externe Dienstleister vergeben wurden oder Küche, Wäscherei etc. als Servicegesellschaften ausgegründet wurden, so erklärt dies zumindest teilweise den überproportionalen Sachkostenanstieg.