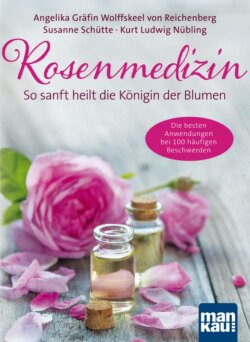Читать книгу Rosenmedizin. So sanft heilt die Königin der Blumen - Angelika Gräfin von Wolffskeel von Reichenberg - Страница 13
ОглавлениеEXTRA Segeln unter falscher Flagge
Pfingstrosen ähneln mit ihren prächtigen Blüten zwar Rosen. Doch die Päonien gehören zu den Hahnenfuß-Gewächsen. Die Blume, die auch als Bauernrose bekannt ist, gibt es in 32 verschiedenen Sorten.
Christrosen, die auch als Schneerosen oder Weihnachtsrosen bekannt sind, gehören zu den Nieswurzen.
Zistrosen bilden eine eigene Gattung, die Zistrosen-Gewächse (Cistaceae), und haben eine starke Heilwirkung z. B. gegen Erkältung.
Die Rose von Jericho (→ Foto), eine Wüstenpflanze, gehört zu den Kreuzblütlern und bildet im Winter eine Rosette mit kleinen weißen Blüten aus. In der Trockenzeit rollt sie sich zu einer apfelgroßen Kugel zusammen und überlebt sehr lange ohne Wasser. Bei Regen erblüht sie.
Christrose, Pfingstrose, Zistrose – klingt alles sehr nach Rose, sie alle sind aber Mogelpackungen.
Keine Rose ohne Dornen … sagt zwar das alte Sprichwort. Doch der Botaniker gruselt sich: Rosen haben Stacheln, keine Dornen. Der feine Unterschied: Dornen wie bei Kakteen sind umgewandelte Blätter. Stacheln dagegen sind Auswüchse der obersten Zellschicht von Sprossen oder Blättern. Beide aber piksen. Der kleine Botanicus würde sicher auch darauf hinweisen, dass die Rose keine Blume ist, sondern ein Gehölz. Stimmt. Aber für jeden, der sie sieht und bewundert, bleibt sie dennoch die schönste Blume des Planeten.
Und was ist mit der berühmten Gedichtzeile »Eine Rose ist eine Rose ist eine Rose« von Gertrude Stein (1874 – 1946)? Es geht nicht um eine Blume, sondern um ein kleines Mädchen namens Rose, das sich darüber wundert, dass sich alles dreht: Mond, Sonne, Erde, immer rundherum. Und so schnitzt sie ihren Namen in einen Baum: »… aber rundum werde ich Rose ist eine Rose ist eine Rose ist eine Rose einschnitzen …«
Zuerst tauchen die Zeilen 1913 in dem Gedicht »Sacred Emily« auf. Berühmt wurden sie aber in einer Kindergeschichte, die Gertrude Stein 1939 veröffentlichte.
EIN MITTELALTERLICHES RÄTSEL: WAS IST DAS?
Fünf Brüder sind zur gleichen Zeit geboren,doch zweien nur erwuchs ein voller Bart,zwei anderen blieb die Wange unbehaart,dem fünften ist der Bart zur Hälfte abgeschoren.
Antwort: die Rose. So ganz stimmt es nicht, aber die Beobachtungen sind schon recht genau. Die fünf Brüder, die Kelchblätter der Rose, sind nicht zur gleichen Zeit geboren, sondern sie bildeten sich, wie auch die Laubblätter, der Reihenfolge nach Dem ersten und dem zweiten Blatt erwächst auf beiden Seiten eine ausgeprägte Fiederung. Das dritte ist nur an einer Seite gefiedert, weil die andere Seite, als die Knospe noch geschlossen war, vom ersten Blatt überlappt wurde. Das vierte und das fünfte Blatt wurden jeweils von ihren vorhergehenden Blättern überlappt Sie haben deshalb kahle Ränder.
Die Hundsrose, allgemein unter Hagebutte bekannt, ziert viele Gärten und Wege.
»Rosenwasser und Fledermausflügel«
Der römische Gelehrte Plinius der Ältere (23 /24–79 n. Chr.), der bei dem größten Vesuv-Ausbruch aller Zeiten starb, empfahl in seinem Naturkunde-Werk »Naturalis historia« die Rose als Heilmittel bei mehr als 32 Krankheiten. So riet er Männern mit Haarproblemen, die Rosengalle der Hundsrose Rosa canina gegen ihre Kahlköpfigkeit zu benützen. Schwerer zu ertragen war sein zweiter Tipp: Eine Tinktur aus Fledermausflügeln, gekocht in Rosenwasser, sollte helfen. Die Heilkundigen der Antike glaubten, fälschlicherweise, mit einem Therapeutikum aus den Wurzeln der Pflanze die Tollwut, ausgelöst durch Hundebisse, behandeln zu können. Ganz am Rande: Der botanische Beiname canina weist nicht auf den Hund hin, sondern sagt, dass die Pflanze »hundsgemein« ist, also überall wächst. Möglicherweise als Arznei brachten dann römische Soldaten Rosen in ihrem Marschgepäck über die Alpen und nach Großbritannien.
Karl der Große – Vater des Rosenanbaus
Nach dem Untergang des Weströmischen Reiches geriet die Rose weitgehend in Vergessenheit. Sie fiel Jahrhunderte in einen Dornröschen-Schlaf. Erst Kaiser Karl der Große (768–814) holte sie wieder aus der Versenkung. In seiner Landgüterverordnung »Capitulare de villis vel curtis imperii« legt er im Jahr 812 fest: In jedem seiner Güter sollen etwa 80 Nutzpflanzen und Heilkräuter, dazu knapp 20 Obstbäume angebaut und gepflegt werden. Auf der Pflanzenliste standen auch »Rosas«, also Rosen. Gemeint damit war die einheimische Wildrose Rosa canina, die als Hundsrose überall in Mittel und Nordeuropa blühte und Hagebutten austrieb. Bei Kindern sind die haarigen Kerne, die wahren Früchte, bis heute als Juckpulver beliebt. Karl der Große dürfte eher an das leckere Fleisch der Schalen gedacht haben. Durchaus eigensüchtig, denn er hatte als Kaiser keinen festen Wohnsitz und zog mit seinen Truppen, seinen Beratern, Köchen, Priestern, Küchenhilfen und Astrologen von einer burgartigen Palastanlage zur anderen. Und brauchte überall etwas zu essen – aber auch Medizin. Das Wissen darum, dass die süßsäuerlichen Hagebutten vor Mangelkrankheiten wie Skorbut schützten, war unter den Heilern der damaligen Zeit sicherlich weitverbreitet.
Karl dem Großen ist die Rosensorte »Charlemagne« gewidmet.
»Sammle sie bei Tagesanbruch …«
Die Rose wurde jetzt nicht nur in den kaiserlichen Parks, sondern auch in Klostergärten intensiv angebaut. Und Kreuzritter brachten ab 1100 von ihren Raubzügen ins Heilige Land neue, spannende Rosensorten mit ungewohnten Farben aus dem Orient nach Europa. Als der arabische Feldherr und Stratege Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub ad-Dawini, der spätere Sultan Saladin, die Stadt Jerusalem im Jahre 1187 zurückeroberte, ließ er, laut Überlieferung, auf 500 Kamelen Rosenwasser herbeischaffen und die Wände und Säulen der Moschee sowie den Fels, auf dem sie stand, damit waschen. Die Universalgelehrte, Dichterin und Benediktiner-Nonne Hildegard von Bingen (1098 –1179) hielt zwar im Gegensatz zu heutigen Erkenntnissen nicht viel vom Olivenöl, dafür umso mehr von der Heilkraft der Rosen. Sie empfahl sie zur Magenstärkung, gegen Fieber, Husten, Blutspeien und Scharbock (Skorbut), bei Hautentzündungen, Ekzemen sowie gereizten und überanstrengten Augen. »Sammle die Rosenblätter bei Tagesanbruch, und lege sie über die Augen, sie machen dieselben klar und ziehen das ›Triefen‹ heraus«, riet die fromme Frau. Die heiliggesprochene Äbtissin wusste aber auch den besänftigenden Rosenduft als Therapiemittel gegen seelische Befindlichkeitsstörungen zu schätzen: »… und wer jähzornig ist, der nehme die Rose und weniger Salbei und zerreibe es zu Pulver. Und in jener Stunde, wenn ihm der Zorn aufsteigt, halte es an seine Nase. Denn der Salbei tröstet, die Rose erfreut … «
»Was ist ein Name? Was uns Rose heißt, wie es auch hieße, würde lieblich duften.« William Shakespeare (1564–1616, aus: Romeo und Julia)
Der neue Grundpfeiler der Heilkunde
In der Festungsstadt Provins, rund 80 Kilometer südöstlich von Paris, wurde die Rosa gallica officinalis, die rote Apotheker- oder Essig-Rose, auf weiten Flächen systematisch angebaut. Sie galt als bestes Heilmittel gegen Schlafstörungen und seelisches Leid. Noch heute sind in der Rosarie von Provins mehr als 300 alte und neue Rosenarten in einem 3,5 Hektar großen Garten zu bewundern. Damit geplagte Frauen und Männer nachts zur Ruhe kommen, rieten die Heiler um 1500 dazu, ein paar erwärmte Rosenblütenblätter auf die Stirn oder Rosengallen unter das Kopfkissen zu legen. Schwangere Frauen sollten einen Monat vor der Niederkunft ein Rosensitzbad nehmen, damit sich die Gebärmutter öffne. Zusätzlich auch noch den Leib mit Rosenöl einreiben und getrocknete Rosenblütenblätter ins Feuer geben. Moderne Hebammen wissen um die alten Erkenntnisse. Sie verdampfen immer öfter das Öl der Rose in einer Duftlampe und beruhigen so die Gebärenden, und ganz nebenbei wirkt der Duft auch hypernervösen werdenden Vätern direkt aufs Gemüt.
Die Essig-Rose, Rosa gallica, wurde zu Heilzwecken gezüchtet.
Als Columbus Amerika entdeckte (genauer: die Karibikinsel San Salvador), bildeten Rosen bereits einen Grundpfeiler der Heilkunde. Sie waren fester Bestandteil aller Kräuterbücher von frühen Botanikern wie Otto Brunfels (1488–1534), Hieronymus Bock (1498–1554) und Leonhart Fuchs (1501–1566). Bocks »News Kreütterbuch« von 1539 nannte sogar erste ausführliche Angaben zur Heilwirkung der Rose. Um 1550 sagte der englische Astrologe und Naturforscher Anthony Ascham (vor 1540 geboren, Todeszeitpunkt unbekannt), der in Cambridge studiert hat, in seiner Kräuterkunde »A Little Herbal«: »Der Duft von getrockneten Rosen tröstet den Verstand und das Herz und vertreibt böse Geister.« Der englische Arzt und Astrologe Nicholas Culpeper (1616–1654) wusste um die Wirksamkeit der Rose bei Blutungen, Kopf- und Zahnschmerzen. Dann wurde es wieder lange Zeit still um das schönste Heilmittel der Welt.
Die meisten verkauften Schnittrosen, etwa 84 Prozent, stammen aus EU-Ländern. Bei den Importen aus Afrika, vor allem aus Kenia, erobern zunehmend die Rosen mit Fair-Trade-Siegel den Markt. Bereits 25 Prozent der Blumenköniginnen kommen aus »fairer« Produktion – 365 Millionen Stück im Jahr 2015. Tendenz steigend -um jährlich rund sechs Prozent.
Rosenrenaissance Ende des 19. Jahrhunderts
Ein neues Wissenschaftsverständnis, der Wunsch, Heilkräfte der Natur bis ins letzte Molekül zu erforschen, brachte die Rosenmedizin wieder zurück ins Bewusstsein. Welche enormen Wirkungen ätherische Öle haben können, bewiesen 1887 bis 1889 französische Wissenschaftler. Sie erbrachten den Nachweis, dass ätherisches Thymianöl Kolibakterien, Staphylokokken oder sogar Meningokokken zerstören kann. Wissenschaftler entdeckten auch, dass Rosenöle im Limbischen System den Thalamus anregen, mehr körpereigene Opiate zu produzieren: Neurotransmitter, die gute Laune und das Wohlbefinden fördern. Als Mittel, das seelische Zustände wie Antriebslosigkeit, Apathie oder Niedergeschlagenheit beheben und austarieren kann, empfahl der britische Arzt Edward Bach (1886–1936) die Hundsrose (»Wild Rose«) in der von ihm entwickelten Bachblütentherapie. Vielleicht ahnte Bach, der eigentlich Schulmediziner war, bereits, welches Heilpotenzial in der Pflanze steckt.
Öle aus Kräutern: schmackhaft, wohltuend und schön anzusehen.
So sind im natürlichen Rosenöl bisher insgesamt circa 230 Molekülarten gefunden worden. Welche Vorteile die wunderschönen Blumen uns in der Zukunft noch bringen werden, liegt größtenteils noch in der Forschungs-Pipeline. In den 30er-Jahren des vergangenen Jahrhunderts entdeckte der amerikanische Nobelpreisträger Linus Pauling (1901–1994) die Wirkung von Vitamin C auf das Immunsystem – und die Hagebutte, prall gefüllt mit dem ImmunVitalstoff, erlebte ihr Comeback als Heilmittel. Bis heute entdecken Pharmakologen auf der Jagd nach neuen Heilsubstanzen immer mehr vielversprechende Inhaltsstoffe. Aktuell wird beispielsweise auch getestet, ob Rosenwirkstoffe Schutz gegen HIV bieten können. Es sieht gut aus …