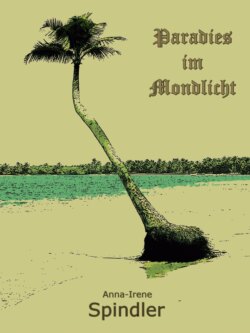Читать книгу Paradies im Mondlicht - Anna-Irene Spindler - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Endlich da
Оглавление„Land in Sicht! Steuerbord voraus!“ Ruckartig setzte sich Marie-Helene in ihrer Koje auf. Es musste noch sehr früh am Morgen sein. Die Umrisse der wenigen Möbel waren im grauen Dämmerlicht kaum zu erkennen. Es war so heiß und stickig in der winzig kleinen Kajüte, dass sie das runde Bullauge nachts immer offen ließ. So konnte sie den lauten Ruf des Matrosen, der vermutlich im Ausguck Wache hatte, deutlich hören. Sie warf die Zudecke zur Seite, sprang aus dem Bett, riss die Tür auf und rannte barfuß und im Nachthemd so schnell sie konnte den engen Gang entlang. Flink wie ein Wiesel kletterte sie die steile, enge Treppe nach oben. Sie lief quer über das Deck bis ganz nach vorn zum Bug. Erst konnte sie in dem trüben Zwielicht des frühen Tages nicht das Geringste erkennen. Aber als ihre Augen ganz langsam und sorgfältig den Horizont absuchten, sah sie es auch. Eigentlich sah sie es nicht richtig. Sie erahnte es vielmehr. Der dunkle Umriss eines kegelförmigen Berges zeichnete sich vor dem grauen Morgenhimmel ab. „Ja, kleines Fräulein. Schau es dir nur genau an. Das ist deine neue Heimat. Das ist der Vulkan Fito auf der Insel Upolu.“ Kapitän Gustafsson war neben sie getreten und hielt ihr auffordernd sein Fernglas hin. Er schien kein bisschen überrascht zu sein, dass sie zu dieser frühen Stunde an Deck war. Und dass sie nur im Nachthemd unterwegs war, störte ihn offensichtlich auch nicht. Marie-Helene nahm das Fernglas. Sie hielt es an ihr rechtes Auge, während sie das linke fest zukniff. Am Anfang sah sie nur Wasser und Himmel. Aber plötzlich, wie aus dem Nichts tauchte es auf! Leicht verschwommen, fast wie hinter einem dünnen Schleier verborgen: Das Ziel ihrer geheimen Träume und Sehnsüchte! Die Insel der Freiheit! Samoa! „Wie lange dauert es noch, bis wir dort sind?“ Sie stellte die Frage ohne dabei das Fernglas abzusetzen. „Ich denke kurz nach zwölf Uhr werden wir im Hafen vor Anker gehen“, antwortete der Kapitän. „Bis zwölf? So lange noch?“ Marie-Helene riss die Augen auf und starrte ihn ungläubig an. „Nach den vielen Wochen auf See werden ja wohl ein paar Stunden mehr nichts ausmachen“, schmunzelte er und nahm ihr das Fernrohr aus der Hand. Ihre Aufregung amüsierte ihn. „Ich kann es doch kaum erwarten!“, rief sie. Sie streckte ihre Arme in die Luft und tanzte vor Begeisterung mit ihren nackten Füßen auf dem Deck herum wie ein Irrwisch. Die Matrosen kamen von allen Seiten herbei, klatschten Beifall und feuerten sie mit lauten Pfiffen und Gegröle an. Marie-Helene warf ihnen Kusshände zu und jauchzte. Die pure Lebensfreude sprach aus ihrem fröhlichen Auftritt. Kapitän Gustafsson rief seine Mannschaft mit einem lauten „Alle Mann auf Station!“ zurück an die Arbeit. Ihm war sehr wohl bewusst, dass das Mädchen einfach nur von ihrer Freude und Begeisterung überwältigt worden war. Aber ihm war auch klar, dass sie für die Matrosen eine halbnackte junge Frau war, die vor ihren Augen so einladend hin und her hüpfte, wie eine unvorsichtige Maus vor dem Maul einer hungrigen Katze. „Nun ist es aber genug“, sagte er. Es tat ihm wirklich leid, wie ein langweiliger Spielverderber den Freudentanz des Mädchens beenden zu müssen. Während der gesamten Fahrt hatte er sie beobachtet und heimlich bedauert. Er war zwar ein strenger Mann, der innerhalb seiner Mannschaft nicht den kleinsten Anflug von Ungehorsam duldete, aber die Art und Weise wie die Kleine von ihrer Mutter und dem steifen Pastor behandelt wurde, missfiel ihm gewaltig. Besonders die Tatsache, dass sich ihre beiden Brüder beinahe alles erlauben durften, während sie immer nur bevormundet und gegängelt wurde, ging ihm gewaltig gegen den Strich. Wenn er sie in ihrem züchtigen Kleid, den Schnürstiefeln, den Handschuhen und dem unvermeidlichen Sonnenschirm an Deck stehen sah, wie sie mit sehnsüchtigen Blicken ihre Brüder beobachtete, tat sie ihm von Herzen leid. Er fand diese Art der Erziehung durch und durch widernatürlich um nicht zu sagen brutal und er war sehr froh, dass seine eigenen Töchter sehr viel ungezwungener und natürlicher aufwachsen konnten. „Ich glaube es ist besser du gehst jetzt nach unten und ziehst dich ordentlich an. Wenn dich deine Mutter oder der Pastor in diesem Aufzug sehen, wirst du reichlich Ärger bekommen.“ Mit einem tiefen Seufzer nickte Marie-Helene, warf einen letzten sehnsüchtigen Blick in Richtung Samoa und trottete dann mit hängenden Schultern zum Niedergang. Ehe ihr Kopf in der schmalen Luke verschwand, drehte sie sich noch einmal um. „Sie werden mich doch nicht verpetzen, oder?“ Er legte den Zeigefinger auf seinen Mund. „Meine Lippen sind versiegelt“, antwortete er mit verschwörerischem Grinsen. Kapitän Gustafssons Schätzung erwies sich als ziemlich exakt. Kurz nach zwölf Uhr hörte Marie-Helene das Rasseln der Ankerkette, während sie ungeduldig die letzten Kleidungsstücke in die große lederne Reisetasche stopfte. Ihre Mutter hatte sie ziemlich unwirsch am Arm gepackt und gewaltsam nach unten in ihre Kabine gezerrt, weil sie auch die vierte Aufforderung ihre Sachen zu packen geflissentlich ignoriert hatte. Sofort nach dem Frühstück hatte sie sich einen Platz an der Reling gesucht und die Insel nicht mehr aus den Augen gelassen, beinahe so als hätte sie Angst, das Eiland könnte sich in Luft auflösen, wenn sie es auch nur einen winzigen Augenblick aus den Augen ließ. Endlich! Das Messingschloss war eingeschnappt. Die Tasche war zu. Sie sah sich in der Kabine um, ob sie auch wirklich nichts vergessen hatte. Der kleine Raum sah jetzt genauso leer und öde aus, wie an dem Tag, als sie ihn zum ersten Mal betreten hatte. Kaum zu glauben, dass dies erst einige Wochen her war. Es kam ihr vor wie eine Ewigkeit. Hamburg, ihr Elternhaus in der vornehmsten Wohngegend der alten Hansestadt, ihre Freundinnen, die Näh- und Singkränzchen ihrer Mutter, das Höhere Töchter Institut, Frau von Berlitz! Alles hatte sie in dieser kurzen Zeitspanne hinter sich gelassen. Es waren für sie nur noch verschwommene Erinnerungen an eine längst vergangene Zeit. Eine hoffentlich für immer in der Versenkung verschwundene Episode ihres Lebens, die niemals wiederkehren würde. Energisches Klopfen riss sie aus ihren Gedanken. Es war einer der Seeleute. „Ich soll die Sachen des gnädigen Fräuleins holen.“ Marie-Helene deutete auf die Tasche. „Danke schön“, sagte sie und lächelte ihm fröhlich zu. Bedauerlich, dass ihre Mutter das jetzt nicht sehen konnte. Sie hätte das Lächeln als höchst ungebührliche Vertraulichkeit eingestuft und sich sicher sehr über das undamenhafte Verhalten ihrer Tochter geärgert. Oben herrschte geschäftiges Treiben. Sämtliche Matrosen waren an Deck. Sie schienen vollkommen ziel- und planlos hin und her zu rennen, in die Wanten hinauf zu klettern nur um dann in affenartiger Geschwindigkeit an irgendwelchen Tauen wieder herunter zu rutschen. Das ganze Schiff hallte wider von lauten Rufen und Geschrei. Sie vermutete zwar, dass jeder wusste was er tat und ein gewisses System hinter dem Ganzen stecken musste, aber in ihren Augen war es nichts anderes als ein wildes, heilloses Durcheinander. Marie-Helene suchte sich einen Platz an der Reling, wo sie nicht im Weg stand und von wo sie deshalb auch keiner vertreiben konnte und sie in Ruhe alles beobachten konnte. Aber es war nicht das Schiffsdeck, dem ihre ganze Aufmerksamkeit galt. Es war der Hafen. Eigentlich war es kein richtiger Hafen. Zumindest nicht so wie der in Hamburg, mit riesigen Lagerhäusern und vielstöckigen Kontoren, turmhohen Ladekränen und unzähligen Schiffen aus aller Welt. Es war eine halbmondförmige Bucht, in der die ‚Kläre-Auguste‘ vor Anker gegangen war. Sie schätzte die Entfernung bis zum Ufer auf fünfhundert Meter. Wobei sie sich auch leicht irren konnte. Entfernungen zu schätzen war nicht unbedingt eine ihrer Stärken. Das also war Apia! So hatte sie es sich in ihrer Phantasie ausgemalt: Weiß gestrichene Holzhäuser mit flachen Dächern und rundumlaufenden Veranden, Kokospalmen, deren Wedel sacht im warmen Wind schaukelten, haushoch wuchernde Bananenstauden, die jede noch so kleine Lücke zwischen den Häusern auszufüllen schienen, ein blendend weißer Sandstrand, der von einer Spitze des Halbmonds bis zur anderen reichte, eingerahmt von grün überwucherten Bergen und über allem ein so tief dunkelblauer Himmel, wie ihn Marie-Helene noch nie gesehen hatte. Als sie ihr neues Zuhause einer etwas intensiveren Betrachtung unterzog, stellte sie ziemlich ernüchtert fest, dass es eigentlich kaum mehr als zehn dieser weißen Kolonialvillen gab. Der Rest waren Hütten. Nein, wenn sie genauer hinsah, waren es noch nicht einmal Hütten. Es waren lediglich riesige, mit Palmwedeln gedeckte Dächer, die auf dicken roh zugehauenen Baumstämmen ruhten. Der eigentliche Hafen bestand aus zwei großen, hölzernen Lagerhäusern, die zwar richtige Wände hatten, aber nicht zu vergleichen waren mit den riesigen, festgefügten Backsteingebäuden in Hamburg. ‚Deutsche Handels- & Plantagengesellschaft‘ war in großen, weißen Lettern auf das Holz gepinselt. Vor jedem der beiden Häuser ragte ein vielleicht fünfzig Meter langer gemauerter Pier in die Bucht hinein. Eine leise Enttäuschung machte sich in ihr breit. Ganz so übersichtlich hatte sie sich die Hauptstadt ihrer neuen Heimat nicht vorgestellt. „Hallo mein kleiner Schatz!“ Der laute Ruf riss sie aus ihren Gedanken. Diese Stimme kannte sich doch! Aufgeregt wanderten ihre Augen hin und her. Die Bucht war jetzt übersät mit merkwürdigen, hölzernen Booten. Sie waren schmal und lang. Vorwärts getrieben wurden sie von Männern mit kurzen hölzernen Paddeln. An einer Seite waren zwei gebogene Stangen angebracht. Sie endeten in einer langen, ebenfalls hölzernen Kufe, die wie ein Schlitten über das Wasser glitt. Und im längsten und größten dieser Boote saß ihr Vater und winkte ihr mit beiden Armen aufgeregt zu. „Papa!“, schrie sie vor Begeisterung, streckte ihm ihre behandschuhte Hand entgegen und schwenkte ihren Sonnenschirm wie das Fähnchen bei der alljährlichen Geburtstagsparade des Kaisers – Möge Gott ihm ein langes Leben schenken! Es war eine solche Freude, ihren Vater nach dieser langen Zeit endlich wieder zu sehen. Erst jetzt wurde ihr bewusst, wie schmerzlich sie ihn vermisst hatte. Stolz erfüllte sie, als sie bemerkte, wie gut er aussah. Seine blonden Haare leuchteten in der Sonne und sein schneidiger Schnurrbart stand in krassem Gegensatz zu seinem braungebrannten Gesicht. Der weiße Leinenanzug sah makellos und adrett aus und nicht einmal ihre Mutter würde irgendetwas zum Herumkritisieren finden, selbst wenn sie ihren Mann durch die Lorgnette hindurch eindringlich mustern würde. Das Boot kam längsseits und Baron von Schlingenhard kletterte geschickt eine der Strickleitern herauf, die jetzt an vielen Stellen über die Reling des Schiffes ins Wasser hingen. „Meine Nene! Dass ich dich endlich wieder habe!“ Marie-Helene konnte deutlich die Rührung in der Stimme ihres Vaters hören, als er sie in die Arme nahm, hochhob und fest an seine breite Brust drückte. „Oh Papa, du hast mir so gefehlt!“, schluchzte sie. Sie ließ den Sonnenschirm los und warf ihm stürmisch die Arme um den Hals. Mit großer Befriedigung stellte sie fest, dass er noch genauso gut roch, wie am Tag seines Abschieds. Es war eine Mischung aus Rasierwasser, Zigarrenrauch und Lagerhaus-Gewürz-Hafen-Duft. „Gut siehst du aus meine Kleine“, stellte er anerkennend fest. Er hatte sie wieder auf das Deck gestellt und eine Armeslänge von sich geschoben. „Mir geht es auch gut. Besonders jetzt da ich dich wieder habe.“ Marie-Helene strahlte über das ganze Gesicht. „Wo ist deine Mutter? Und wo sind die Jungs?“ Suchend sah sich ihr Vater um. „Mama wird vermutlich noch in ihrer Kabine sein. Das unziemliche Getümmel an Deck ist nichts für sie.“ Demonstrativ rümpfte Marie-Helene die Nase und rollte mit den Augen. Dabei grinste sie ihren Vater verschwörerisch an. „Ah, ich verstehe“, nickte er und grinste ebenfalls. „Die Jungs findest du irgendwo bei den Matrosen. Vermutlich im hintersten Laderaum.“ „Na, dann werde ich zuerst deine Mutter begrüßen und Pastor Rieflein. Kommst du mit?“ „Eigentlich würde ich lieber an Deck bleiben.“ Verständnisheischend sah sie ihn an. „War es schlimm?“ Niedergeschlagen nickte sie mit dem Kopf. „Ziemlich.“ „Jetzt hast du es ja überstanden. Und zukünftig bin ich auch wieder da.“ Aufmunternd tätschelte er ihr die Wange. „Gott sei Dank!“, stieß sie hervor und warf ihrem Vater eine Kusshand zu, ehe dieser im Niedergang verschwand. Sie lehnte sich wieder an die Reling. Jetzt hatte sie Zeit die Menschen in den Booten genauer in Augenschein zu nehmen. Atemloses Staunen erfasste sie, als ihr Blick langsam vom Einen zum Anderen wanderte. Noch nie in ihrem Leben hatte sie so viele schöne Menschen gesehen. Es war auch in Hamburg vorgekommen, dass sie Leuten begegnet war die ihren Blick fesselten, weil sie sich wegen ihres guten Aussehens von den Anderen unterschieden hatten. Aber das war nicht zu vergleichen mit dem, was sich hier ihren Augen darbot. Jedes einzelne Gesicht war von ebenmäßiger Schönheit. Alle, sowohl Männer als auch Frauen, hatten lange schwarze Haare. In weichen sanften Wellen flossen sie ihnen über die Schultern und den Rücken. Sie konnte sehen, dass bei einigen Frauen die in den Booten saßen, die Haare sogar bis zum Boden reichten. Alle Frauen hatten sich über den Ohren Blüten in die Haare gesteckt. Dicke Blumenketten schmückten ihre Hälse. Sie trugen einfache weiße Baumwollkleider ohne Ärmel. Diese bildeten einen herrlichen Kontrast zu ihrer wunderbaren Haut, die in der Farbe dunklen Milchkaffees schimmert. Die Männer waren mit knielangen weiten Hosen und kurzärmligen Hemden bekleidet. Die Hemden hatten keine Knöpfe und wurden nur durch Stoffgürtel zusammengehalten. Das leuchtende Weiß des Stoffes wurde auch bei ihnen durch die dunkle Bräune der Haut noch betont. In dem Boot, das ihren Vater gebracht hatte, saß ein Mann, der sich von allen anderen auffällig unterschied. Er war nur mit einem bunten Stück Stoff bekleidet, das wie ein Rock um seine Hüften gewickelt war. Im Gegensatz zu den anderen Männern hatte er kein Paddel in der Hand. Seine Haltung war aufrecht und gerade. Der ganze Oberkörper war überzogen von einem feinen Muster, das aussah als wäre es mit schwarzer Farbe auf seine Haut gemalt. Selbst sein Gesicht war über und über mit diesen dünnen Linien verziert. Er erinnerte Marie-Helene an eine Statue aus dunklem Ebenholz. Das einzig Lebendige an ihm schienen seine langen grauen Haare zu sein, die sich leicht in der sanften Brise bewegten. Selbst der Kaiser in seiner prächtigen Uniform - Möge Gott ihm ein langes Leben schenken! - wirkte nicht halb so würdevoll und vornehm wie dieser halbnackte Wilde. Kapitän Gustafsson war neben sie getreten. „Und was sagst du? Gefällt es dir?“ Fragend sah er sie an. „Es ist ja so aufregend“, stammelte sie. „Na dann pass mal auf. Gleich wird es noch viel aufregender.“ Er hob die Hand. Der würdevolle Mann nickte leicht zum Zeichen, dass er verstanden hatte. Dann gab er dem vor ihm sitzenden Mann einen kleinen Wink. Dieser hob ein höchst seltsam geformtes Schneckenhaus hoch, setzte es an die Lippen, blähte die Backen auf und blies mit aller Macht hinein. Es war unfassbar, was aus dem kleinen Ding für ein gewaltiges Dröhnen herauskam. Diesen Ton würde sie nie in ihrem Leben je wieder vergessen, selbst wenn sie hundert Jahre alt werden würde. Es klang so, als schickten sämtliche Nebelhörner Hamburgs gleichzeitig ihren klagenden Ton in den Himmel. Ein lautes, fröhliches Geschrei war die Antwort und wie auf Kommando stürzte sich von jedem der Boote einer der Männer ins Wasser. Mit langen kräftigen Armzügen schwammen sie zur ‚Kläre-Auguste‘ und kletterten mit einer affenartigen Geschwindigkeit an den Strickleitern hoch an Deck. Die Seeleute unterbrachen ihre Arbeit und kamen lachend an die Reling. Marie-Helene sah, dass jeder von ihnen ein paar Münzen in der Hand hielt. „Vorwärts!“, brüllte einer der Matrosen. Gleichzeitig warf er seine Münzen über Bord. Sofort kletterte einer der Samoaner auf die Reling und stürzte sich mit einem gekonnten Kopfsprung in das blaue Wasser der Bucht. Aufgeregt beugte sich Marie-Helene über die Reling. Nach ein paar Sekunden tauchte der Mann wieder auf. Mit einem triumphierenden Ruf streckte er die rechte Hand in die Luft. Auf der nassen Handfläche glitzerten die Münzen im hellen Sonnenlicht. Ein lautes Beifallgeschrei sowohl von den Booten als auch vom Deck der ‚Kläre-Auguste‘ war die Antwort. Nach und nach warfen alle Matrosen ihre Geldstücke ins Wasser. Jedes Mal verschwand ein anderer der eleganten Springer im tiefen klaren Blau des Ozeans um dann alsbald mit seiner Beute wieder aufzutauchen. Marie-Helene war sehr erstaunt als auch Kapitän Gustafsson ein Geldstück aus der Tasche zog. „Es sind doch schon alle gesprungen“, sagte sie. „Nicht alle“, meinte der Kapitän. Als sie sich suchend umsah, schüttelte er den Kopf und zeigte lächelnd senkrecht nach oben. Sie legte ihren Kopf in den Nacken. Zuerst konnte sie nichts erkennen. Aber dann entdeckte sie genau über sich auf der obersten Rah des Großmasts eine Gestalt, die rittlings auf dem äußersten Ende saß. „Oh mein Gott!“, flüsterte sie atemlos und krallte sich am Ärmel des Kapitäns fest. „Er will doch nicht etwa..?“ Marie-Helene konnte ihren Satz nicht beenden. „Aber natürlich will er!“, rief Kapitän Gustafsson. „Pass gut auf!“ Er hob den Arm und warf die Münze über Bord. Im gleichen Augenblick stellte sich die Gestalt hoch über Marie-Helene auf die Rah. Sie konnte erkennen, dass es ein junger Mann war. Auch er war nur mit einem Tuch bekleidet, das er um die Hüften gebunden hatte. Er breitete die Arme weit aus und ließ sich rückwärts nach unten kippen. Die Beine kerzengerade gestreckt, den Rücken zum Hohlkreuz durchgebogen, so sah ihn Marie-Helene fallen. Unmittelbar vor dem Aufprall streckte er die Arme nach vorn und tauchte unter dem jubelnden Beifall der Matrosen in das Wasser ein. Marie-Helene atmete tief durch. Sie stieß einen Seufzer der Erleichterung aus, als der dunkle Kopf wieder an der Wasseroberfläche erschien. Noch nie zuvor hatte sie etwas ähnlich Waghalsiges und Verrücktes gesehen wie diesen Sprung. Ihre Blicke folgten dem tollkühnen Springer, als dieser mit kräftigen Armzügen zu dem Boot mit der würdevollen Statue schwamm. Er kletterte hinein und legte mit einer leichten Verbeugung das Geldstück, das er vom Grund des Ozeans geholt hatte, in den Schoß des bemalten Mannes. Obwohl das Boot gefährlich schaukelte, konnte der Junge selbst im Stehen vollkommen mühelos das Gleichgewicht halten. Da Kapitän Gustafsson sich wieder seiner Arbeit zugewandt hatte und sie sich vor den missbilligenden Blicken ihrer Mutter in Sicherheit wusste, gönnte es sich Marie-Helene, den Jungen ungeniert und nach Herzenslust zu betrachten. Sie wusste natürlich, dass dies in höchstem Maße unangemessen, undamenhaft und ungebührlich war. Als sittsames Mädchen hätte sie sich unverzüglich abwenden und ihre Augen angesichts derartig unkeuscher Zurschaustellung nackter Haut züchtig verschließen müssen. Aber der Gegenstand ihrer Betrachtung war einfach viel zu schön und die Versuchung einfach viel zu groß, als dass sie die strengen Regeln ihrer Erziehung hätte einhalten können. Der Junge war mit Sicherheit das Schönste, was sie in ihrem bisherigen Leben jemals gesehen hatte. Die Eleganz und Geschmeidigkeit seiner Bewegungen, das Spiel der Muskeln unter seiner dunkelbraunen Haut, auf der die Wassertropfen wie glitzernde Edelsteine schimmerten, die strahlend weißen Zähne in seinem wunderschönen Gesicht, die nassen Haare die wie ein schwarzer Schleier über seinen Schultern lagen – all dies war von einer solchen Vollkommenheit, dass es Marie-Helene den Atem raubte. Der weit zurückliegende Tag fiel ihr wieder ein, als sie sich mit ihrer besten Freundin Friedericke von Zengen in der Besenkammer eingeschlossen hatte. Im Schein einer Kerze hatten sie mit roten Wangen und unter verlegenem Gekicher ein dünnes Büchlein durchgeblättert, das Friederickes Onkel von seiner Griechenlandreise mitgebracht hatte. Ihre Freundin hatte es sich heimlich ausgeborgt. Athene, Artemis, Aphrodite, Hermes, Zeus, Ares, Herakles, Perseus und Achilles. Alle waren sie abgebildet. Alle vollkommen nackt! Damals hatte sie sich nicht vorstellen können, dass es tatsächlich Menschen geben sollte, die unter ihrer Kleidung so aussahen wie diese Götterstatuen. Aber als sie jetzt diesen jungen Mann vor sich sah, wusste sie, dass es doch so war. Er sah genauso aus wie die griechischen Götter in ihren Tempeln aus weißem Marmor. Nein, er war sogar noch tausendmal schöner! Denn er war lebendig. Lebendig und jung. Mit einem lauten Seufzer stützte sie ihre Ellenbogen auf die Reling und legte den Kopf in ihre Hände. „Richte dich auf Marie-Helene! Halte dich gerade! Was ist das für ein Benehmen? Willst du deinen Vater vor all diesen Wilden blamieren?“ Sie erschrak heftig, als sie die scharfe, schrille Stimme ihrer Mutter hörte. Die Röte schoss ihr in die Wangen und sofort stellte sie sich aufrecht hin. Hoffentlich hatte die Mutter nicht bemerkt, wohin sich die Augen der Tochter verirrt hatten. „Habe ich dir nicht immer und immer wieder gesagt, du sollst dich nicht ohne Schirm der Sonne aussetzen?“, setzte Madame de Slingenard ziemlich ungehalten ihre Strafpredigt fort. „Liebste Elisabeth! Es besteht kein Grund sich so zu echauffieren. Sie trägt doch den großen Strohhut. Er steht ihr übrigens ausgezeichnet. Hast du ihn ausgewählt, meine Liebe?“, kam Freiherr von Schlingenhard seiner Tochter zur Hilfe und tätschelte den Arm seiner Gemahlin, die sich sehr elegant bei ihrem Gatten eingehakt hatte. Die liebenswürdige und charmante Äußerung zeigte augenblicklich Wirkung. Der Blick der Freiin wurde milder. „Fürwahr! Unsere Tochter sieht liebreizend aus! Genau wie es sich für eine junge Baronesse geziemt.“ Huldvoll lächelnd schritt sie an der Seite ihres Mannes über das Deck. „Es war eine große Ehre für mich, Sie nach Samoa bringen zu dürfen, gnädige Frau Baronin“, sagte Kapitän Gustafsson, als Elisabeth von Schlingenhard sich von ihm verabschiedete. „Die ‚Kläre-Auguste‘ bleibt noch eine Woche hier, ehe wir wieder zurück nach Hamburg schippern. Sie können uns gerne ihre Post mitgeben.“ „Danke, Kapitän. Grüßen Sie mir die alte Heimat.“ „Herzlich gern, Madame“, antwortete er mit einer galanten Verbeugung. Freiherr von Schlingenhard blickte seine Frau aufmunternd an. „Nun, meine Liebe! Der Große Matai Malietoa Tanumafili hat mir die Ehre erwiesen, mich in seinem Boot herbringen zu lassen. Es wäre höchst unhöflich jetzt nicht mit ihm zurückzufahren. Und er erwartet sicherlich, dass du mich begleitest.“ Madame de Slingenard zog ihre rechte Augenbraue indigniert in die Höhe, hob die Lorgnette und musterte das Boot, auf das ihr Mann zeigte von vorne bis hinten. Ebenso die Insassen. Danach ließ sie die Lorgnette sinken und sah ihren Mann höchst missbilligend an. „Kapitän Gustafsson hat mir bereits zugesagt, dass wir von einem der Beiboote der ‚Kläre-Auguste‘ an Land gebracht werden.“ „Aber Liebes, so versteh doch. Es wird erwartet! Es könnte als Affront aufgefasst werden, wenn ich nur alleine bei ihm einsteige.“ „Friedrich August! Die Sonne muss dir die Sinne vernebelt haben. Du erwartest doch wohl nicht von mir, dass ich mich in diese winzige Nussschale zu diesen Kannibalen setze? Auf gar keinen Fall!“ Sie sah ihren Mann mit einem Blick an, der keinerlei Zweifel aufkommen ließ, dass dies ihre endgültige Entscheidung war, von der sie sich auf keinen Fall und unter gar keinen Umständen würde abbringen lassen. Marie-Helene sah den resignierten Blick ihres Vaters. Das war ihre Chance! „Papa! Ich könnte dich ja begleiten“, sagte sie höflich und ein kleines schüchternes Lächeln huschte über ihr Gesicht, weil sie ganz genau wusste, dass ihr Vater diesem Blick nicht widerstehen konnte. „Kommt nicht in Frage!“, fuhr ihre Mutter empört dazwischen. „Ein junges unschuldiges Mädchen zwischen lauter Wilden. Das ist einfach unerhört.“ Ihr Vater straffte die Schultern und Marie-Helene wusste, dass sie gewonnen hatte. „Bei aller Liebe. Aber was sollte daran unschicklich sein, wenn eine junge Dame ihren Vater bei einem politisch wichtigen öffentlichen Auftritt begleitet.“ Und an Marie-Helene gewandt fügte er hinzu: „Mein Fräulein, es wird mir eine Ehre sein, dich in deine neue Heimat begleiten zu dürfen.“ Madame de Slingenard gab sich geschlagen. Denn obwohl es nach außen hin oft nicht den Anschein hatte, waren auch im Hause Von-Schlingenhard die Rollen klar festgelegt und sie wusste genau wann es besser war nachzugeben. Marie-Helene verabschiedete sich von Kapitän Gustafsson. Er drückte lang und fest ihre Hand. Als er ihr leise zuflüsterte „Wird schon werden“ huschte ein verschwörerisches Grinsen über sein Gesicht. „Danke für Alles“, sagte sie herzlich und wandte sich zum Gehen. Da sah sie hinter einer hölzernen Kiste einen alten Bekannten hervorlugen. Sie ging in die Hocke und zog ihr seidenes Sonnenschirmchen hervor. Als sie ihren Vater umarmte, hatte sie das lästige Ding einfach fallen lassen. Der Wind musste es quer über das Deck bis zu der Kiste geweht haben. Sie klappte den Schirm zu. Einer plötzlichen Eingebung folgend ging sie zu Kapitän Gustafsson und gab ihm den Sonnenschirm. „Der ist für Sie. Ich brauche ihn nun nicht mehr“, sagte sie mit fester Stimme. Schmunzelnd sah ihr der Kapitän nach, wie sie aufrecht und mit erhobenem Haupt zu ihrem Vater ging, der an der Reling auf sie wartete. „Viel Glück!“, murmelte der Seemann und wandte sich wieder seinen Aufgaben zu. „Möchtest du nicht warten, bis der Transportsitz soweit ist?“, fragte ihr Vater. Auf gar keinen Fall wollte sie mit dieser albernen Schaukel zu dem Boot hinuntergelassen werden, das jetzt direkt neben dem Rumpf der ‚Kläre-August‘ im Wasser lag. „Aber Papa! Wie sähe denn das aus, wenn die Tochter des Leiters der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft wie ein Überseekoffer abgeseilt würde? Glaubst du vielleicht, ich hätte nicht genügend Schneid um an der Strickleiter nach unten zu klettern?“ Sie kannte die Schwächen ihres Vaters genau. ‚Ein aufrechter Preuße muss in jeder Lebenslage seinen Mann stehen und seinem Land Ehre machen‘ war einer seiner Lieblingssprüche. Und sie wollte ihm beweisen, dass er sich ihrer nicht zu schämen brauchte. „So ist’s recht meine Kleine“, sagte Friedrich August und der Stolz auf seine Tochter schwang deutlich in seiner Stimme mit. Er trat an die Reling. „Tafa’ifa Malietoa Tanumafili darf ich dir meine Tochter Marie-Helene vorstellen. Wenn du es erlaubst wird sie uns zum Ufer zurückbegleiten.“ Erwartungsvoll sah er zu dem würdevollen Mann im Boot hinunter. Ein kurzer musternder Blick streifte Marie-Helene. Der Mann nickte zustimmend und erstarrte dann wieder zur bewegungslosen Statue. Freiherr von Schlingenhard schwang sich über die Reling und kletterte an der Strickleiter zum Auslegerboot des Großen Matai hinunter. Marie-Helene atmete einmal tief durch und tat es ihrem Vater nach. Dabei achtete sie peinlich genau darauf, dass sie sich nicht in ihren langen Röcken verhedderte. Das war gar nicht so einfach, da ja die Männer im Boot unter ihr auf gar keinen Fall einen Blick auf ihre langen Unterhosen erhaschen sollten. Aber auch diese letzte Hürde auf dem Weg in eine neue, aufregende Zukunft meisterte sie sehr gekonnt. Hochaufgerichtet und mit geradem Rücken - ihre Mutter konnte wirklich stolz auf sie sein - ließ sich auf dem hölzernen Sitzbrett vor ihrem Vater nieder. Die Männer vor ihr tauchten die Paddel ins Wasser und manövrierten gekonnt das Auslegerkanu vom Rumpf der ‚Kläre Auguste‘ weg. Marie-Helene drehte sich noch ein letztes Mal zu dem Schiff um, das ihr in den vergangenen Wochen eine Heimat, aber auch gleichzeitig ein Gefängnis gewesen war. Kapitän Gustafsson stand an der Reling und salutierte. Sie hob zum Abschied grüßend die Hand. Dann wandte sie ihren Kopf nach vorn. Marie-Helene wollte ab sofort nicht mehr zurück schauen. Nur noch nach vorne sollte ihr Blick gehen. Die Paddel wurden mit kurzen kräftigen Bewegungen ins Wasser getaucht und das Boot flog richtiggehend über das Wasser. Ihrem neuen Zuhause entgegen! Ihr Herz schlug schneller. Die Wangen röteten sich im Fahrtwind. Sie schloss die Augen und fühlte die feinen Wassertröpfchen auf ihrem Gesicht, die sich bei jedem Auftauchen von den Paddeln lösten. Tief atmete sie die würzige, salzige Luft ein. Oh ja! Die Zukunft würde ein einziges großes Abenteuer sein. Sie öffnete wieder die Augen. Unmittelbar vor ihr saß der Junge, der sich von der Rah der ‚Kläre Auguste‘ ins Meer gestürzt hatte. Mit kräftigen und gleichzeitig unglaublich geschmeidigen Bewegungen tauchte er sein Paddel ins Wasser. Fasziniert beobachtete sie, wie sich das Wasser aus seinen nassen Haaren in dünnen Rinnsalen einen Weg über seinen nackten gebräunten Rücken suchte. Fast hätte sie dem spontanen Drang nachgegeben, ihre Hand auszustrecken und mit den Fingerspitzen vorsichtig das Wasser aufzutupfen. Aber sie beließ es dabei die winzigen Bäche mit den Augen zu verfolgen, bis sie im Bund seines farbenfrohen Hüfttuchs verschwanden. Plötzlich wurde sie sich der Unschicklichkeit ihres Tuns bewusst und sie richtete ihren Blick schnell wieder nach vorn. Die ohnehin schon lebhafte Farbe ihrer Wangen vertiefte sich merklich, als ihr klar wurde, dass sie den jungen Mann nun schon zum zweiten Mal so überaus ungebührlich betrachtet hatte. „Jetzt hast du gleich wieder festen Boden unter den Füßen“, sagte ihr Vater, als das Kanu mit der Spitze auf dem feinen Sand des Strandes zur Ruhe kam. Er stand hinter ihr im Boot und war ihr beim Aufstehen behilflich. Nur der vordere Teil des Bootes lag auf dem Trockenen und Marie-Helene überlegte, wie sie wohl trockenen Fußes an Land kommen sollte. Einer der Männer stand neben ihr im Wasser und streckte ihr die Arme entgegen. Fragend sah sie über die Schulter hinweg ihren Vater an. Dieser lächelte und nickte ihr aufmunternd zu. Auch der Mann im Wasser schien dies bemerkt zu haben. Ohne auch nur einen Augenblick zu zögern fasste er sie um die Taille, nahm sie auf die Arme und trug sie ans Ufer. Mit einem breiten Grinsen stellte er sie vorsichtig in den weichen weißen Sand. Marie-Helene wusste im ersten Augenblick gar nicht so recht, wie sie reagieren sollte. Sie nickte und murmelte verlegen „Danke!“ Das Grinsen des Mannes wurde noch breiter als er sich ebenfalls verbeugte. Zum Glück war ihr Vater jetzt auch aus dem Boot gestiegen. Gemeinsam mit dem würdevollen Mann kam er zu ihr. „Marie-Helene, ich möchte dir den Großen Matai Malietoa Tanumafili vorstellen. Er ist der tafa’ifa der Insel. Bei uns würde man sagen: Er ist der König von Samoa.“ Als wohlerzogene Baronesse wusste sie sehr wohl, wie sie sich bei einem so feierlichen Anlass zu verhalten hatte. „Es ist mir eine große Ehre Ihre Bekanntschaft machen zu dürfen“, sagte sie liebenswürdig. Sie trat einen Schritt zurück um der hochgestellten Persönlichkeit, wie es sich gehörte, mit einem tiefen Knicks die angemessene Referenz erweisen zu können. Dabei übersah sie jedoch, dass sie sich wochenlang auf einem schwankenden Schiff aufgehalten hatte. Darüber hinaus waren ihre Schnürstiefel mit den fünf Zentimeter hohen Absätzen auch nicht das geeignete Schuhwerk für den mehlfeinen Sand. Marie-Helene hatte plötzlich das Gefühl, der ganze Boden bewege sich wie wild unter ihren Füßen. Sie wankte hin und her und versuchte verzweifelt das Gleichgewicht wieder zu erlangen. Um ein Haar wäre sie der Länge nach in den Sand gefallen. Aber ein kräftiger Arm legte sich um ihre Taille, eine warme Hand ergriff die ihre und hinderte sie daran, ihren armen Vater aufs Äußerste zu blamieren. „Wenn man lange auf See war, ist es am Anfang schwierig, wieder auf festem Boden zu stehen.“ Die Stimme war weich und melodisch. Marie-Helene blickte zur Seite um zu sehen, wer ihr im wahrsten Sinne des Wortes so tatkräftig unter die Arme gegriffen hatte. Ihr Blick fiel auf zwei schwarze Augen, die sie neugierig und auch ein wenig belustigt anschauten. Es war der Junge aus dem Boot. Ihr Herz schlug so laut, dass sie glaubte alle am Strand müssten es hören. „Herzlichen Dank für Ihre Hilfe“, stammelte sie. „Ich hatte tatsächlich das Gefühl, als würde sich alles um mich herum bewegen. Aber ich glaube ich kann jetzt wieder alleine stehen“, fügte sie hinzu und löste sich aus dem Griff des jungen Mannes. Dann versuchte sie es noch einmal. Diesmal gelang Marie-Helene ein formvollendeter Knicks, der jeder preußischen Prinzessin zur Ehre gereicht hätte. Das weitere offizielle Begrüßungsprogramm verlief dann aber ohne peinliche Zwischenfälle. Ihr Vater reichte ihr seinen Arm und Marie-Helene hakte sich dankbar bei ihm unter. Alle wichtigen Leute der Insel waren an den Strand gekommen. Die deutschen Plantagenbesitzer, die Mitarbeiter der Plantagengesellschaft, ein Beamter der deutschen Überseeverwaltung und der Leiter der Missionsstation. Freiherr von Schlingenhard stellte sie der Reihe nach vor, aber Marie-Helene war so aufgeregt, dass sie sich keinen einzigen Namen merkte. Sie versicherte zwar jedesmal freundlich, wie erfreut sie wäre die Person kennen zu lernen, aber im Grunde waren ihr diese Leute vollkommen gleichgültig. Viel lieber hätte sie die am Strand versammelten Samoaner kennengelernt. Diese interessierten sie deutlich mehr, als irgendwelche langweiligen Überseehändler und Verwaltungsbeamte. Sie unterschieden sich kein bisschen von ihren Kollegen in Hamburg, die häufig im Hause Schlingenhard zu Gast gewesen waren und Marie-Helene bei unzähligen Mittagessen mit ihren immer wiederkehrenden Themen unsäglich gelangweilt hatten. Aber anscheinend waren die einheimischen Bewohner Samoas nicht offizieller Bestandteil des Begrüßungskomitees. Und so blieb der Große Matai vorläufig der einzige Samoaner, der ihr vorgestellt wurde. Sie bedauerte das sehr. Hätte sie doch nur zu gerne gewusst, wer der junge Mann war, der so spontan seinen Arm um sie gelegt hatte. Seinen Namen hätte sie bestimmt nicht wieder vergessen.