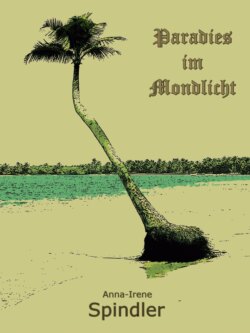Читать книгу Paradies im Mondlicht - Anna-Irene Spindler - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Ein Geheimnis
ОглавлениеMarie-Helene drehte sich auf den Rücken und verschränkte die Arme hinter dem Kopf. Normalerweise hatte sie überhaupt keine Probleme mit dem Einschlafen. Aber heute wollte sich die Müdigkeit nicht einstellen. Das was sie am Nachmittag gehört hatte, ging ihr einfach nicht aus dem Kopf. Der Verwalter der Klienzel'schen Plantage hatte ein unmoralisches Verhältnis mit einer Samoanerin. Sie fand das ungeheuer aufregend. Ihre Mutter wäre erschüttert gewesen, hätte sie gewusst, welche Gedanken ihre unschuldige Tochter am Schlafen hinderten. Niemals wäre Madame de Slingenard auf die Idee gekommen, dass Marie-Helene solche unkeuschen Ausdrücke wie ‚ein Verhältnis haben‘ überhaupt kannte, geschweige denn wusste, was sie bedeuteten. Gemeinsam mit ihrer treuen Freundin Friedericke hatte sich Marie-Helene in der alten Heimat ein halbwegs fundiertes Wissen über ‚intime Angelegenheiten‘ angeeignet. Hier ein unvorsichtig fallengelassenes Wort der Mutter, dort ein zufällig erhaschter Ausdruck des Vaters. Immer wieder gab es Gelegenheiten an einer Tür zu lauschen oder plötzlich und unerwartet in einen Raum zu treten. Fleißig wurden die aufgeschnappten Neuigkeiten mit der Freundin ausgetauscht und ausgiebig diskutiert. Beide hatten diesbezüglich nicht den Hauch eines schlechten Gewissens. Stellte es doch die einzige Möglichkeit dar, wie junge Mädchen an Informationen herankamen, die sonst nur geflüstert und hinter vorgehaltener Hand weitergegeben wurden. Zwei Monate war sie nun schon auf der Insel. Und nichts von dem, was sie sich auf dem Schiff vorgenommen hatte, hatte sie in die Tat umsetzen können. Ihren Vater, den sie um den Finger wickeln wollte um sich kleine Freiheiten zu erkämpfen, bekam sie kaum zu Gesicht. Und ihre Mutter drangsalierte sie schlimmer als jemals zuvor. In Hamburg hatte sie ihre erzieherischen Maßnahmen auf alle drei Kinder gleichmäßig verteilt. Aber hier entzogen sich die Jungs der Fuchtel ihrer Mutter mit wachsendem Erfolg. Meistens waren sie mit dem Vater unterwegs um ‚Männerangelegenheiten‘ zu erlernen. Kaum waren die Schulstunden bei Pastor Rieflein vorüber, verschwanden ihre Brüder für viele Stunden um erst am Abend mit ihrem Vater gutgelaunt, hungrig wie Wölfe und total verdreckt wieder nach Hause zu kommen. Bereits nach kurzer Zeit hatte Madame de Slingenard es aufgegeben mit ihrem Mann über das Verhalten ihrer Söhne zu streiten. Umso intensiver bemühte sie sich, ihre Tochter auf dem rechten Weg zu halten und allen Widrigkeiten zum Trotz zu einer anständigen, gesitteten, jungen Dame zu erziehen. Seufzend setzte sich Marie-Helene im Bett auf. Es war heiß und stickig in ihrem Zimmer. Ihre Mutter legte sehr großen Wert darauf, dass nachts die Tür, die auf den breiten Holzbalkon hinausführte, stets fest verschlossen war. Auch die Fenster durften nicht offen stehen. Die Angst ihrer Mutter vor Insekten und allen Arten von Kriechtieren war geradezu krankhaft. Obwohl es auf der Insel keinerlei gefährliche Tiere gab, sah sie ständig irgendwo giftige Spinnen, Schlangen und Skorpione. Entschlossen schlug Marie-Helene die Zudecke zurück, öffnete das Moskitonetz und stand auf. Vorsichtig um jedes Knarren zu vermeiden setzte sie ihre nackten Füße auf die hölzernen Dielen des Fußbodens. Leise öffnete sie die Balkontür. Alle Zikaden der Insel schienen sich vor ihrem Balkon verabredet zu haben und ihr lautes Zirpen übertönte selbst das gleichmäßige Schnarchen ihres Vaters. Tief sog Marie-Helene die würzige Luft in ihre Lungen. Die herrlichen Blumen der Insel, die am Tag an allen Büschen, Bäumen und Sträuchern in sämtlichen Farben des Regenbogens leuchteten, erfüllten die Nacht mit ihrem süßen Duft. Das Von-Schlingenhard'sche Haus lag gemeinsam mit allen anderen Villen der feinen Gesellschaft Apias auf der Anhöhe oberhalb des Hafens und hatte einen freien Ausblick auf das Meer. Ganz weit draußen konnte sie die Brandung, die gegen das Riff schäumte, mehr erahnen als sehen. Sehnsuchtsvoll sah sie zu der kleinen Bucht hinunter. Eine große, weit ins Meer hinausragende Felsformation trennte sie vom weiten Hafenbecken. Im bleichen Mondlicht wirkte der Sand noch viel weißer als im Sonnenschein. Seit dem Tag ihrer Ankunft in Samoa hatte man ihr nicht mehr erlaubt an den Strand zu gehen. Ihre Brüder tollten Tag ein Tag aus in den Wellen, wälzten sich im mehlfeinen Sand und schleppten ihn, sehr zum Leidwesen ihrer Mutter, zentnerweise in ihren Schuhen und Hosentaschen ins Haus. Das Einzige was sie durfte, war auf der Terrasse stehen und ihnen von Ferne zusehen. Marie-Helene hatte es so satt, immer nur als Zuschauerin am Rand zu stehen. Sie wollte auch an den Strand. Und sie würde an den Strand gehen. Noch heute Nacht! Das ganze Haus lag in tiefem Schlummer. Keiner würde etwas merken. Mit einer entschlossenen Bewegung riss sie sich die lästige Schlafhaube vom Kopf. Gemeinsam mit den Schleifen, die ihre obligatorischen Zöpfe zusammenhielten, warf sie sie zurück in ihr Schlafzimmer. Sie entflocht ihre glänzenden Haare. Wie ein seidiger brauner Schleier fielen sie über ihr weißes Nachthemd. Solange sie denken konnte, war sie noch niemals mit offenen Haaren herumgelaufen. Dann ging alles blitzschnell. Genauso wie sie es schon dutzende Male bei ihren Brüdern gesehen hatte, stieg sie auf das Geländer, kletterte von dort auf den Jacarandabaum, der gleich neben dem Haus stand, legte sich auf den dicken Ast, hielt sich mit den Armen fest und ließ sich schließlich vorsichtig zu Boden gleiten. Ein letzter prüfender Blick, ob im Haus alles still war und dann verschwand sie zwischen den Büschen des Gartens. Am Anfang war es ziemlich schwierig im Finstern den Weg zu finden. Immer wieder trat sie mit ihren empfindlichen Füßen, die so gar nicht an das Barfußlaufen gewöhnt waren, auf kleine spitze Steine. Sie musste sich ein paar Mal regelrecht auf die Zunge beißen um nicht laut zu schreien und sich zu verraten. Ihr langes Nachthemd verhedderte sich in den dornigen Zweigen eines Busches und wäre um ein Haar zerrissen. Aber schließlich hatte sie das Gebüsch hinter sich gelassen und folgte dem breiten Weg, der zum Hafen hinunterführte. Ihre Augen hatten sich inzwischen an die Dunkelheit gewöhnt. Im matten Mondlicht erkannte sie gerade noch rechtzeitig den schmalen Trampelpfad, der vom Hauptweg abzweigte und direkt zu der kleinen Bucht führte, in der ihre Brüder immer zu baden pflegten. Endlich hatte sie es geschafft. Beinahe andächtig setzte sie ihre nackten Füße in den weichen Sand. Genüßlich schloss sie die Augen. Auf diesen Augenblick hatte sie so lange gewartet! Es war ein unglaubliches Gefühl. Jeden einzelnen Schritt auskostend ging sie langsam weiter. Die Oberfläche des Sandes fühlte sich kühl an. Die Sonne hatte aber tagsüber den Sand so aufgeheizt, dass die Wärme immer noch spürbar war, sobald ihre Füße ein wenig einsanken. Schließlich erreichte sie das Meer. Als sie ihre nackten Zehen zum ersten Mal in das warme Wasser des Pazifiks tauchte, konnte sie ein leises Schluchzen nicht unterdrücken. Wie im Traum ging sie am Strand entlang, während das Wasser ihre Knöchel umspülte. Noch niemals in ihrem ganzen Leben hatte sie sich so frei und so glücklich gefühlt wie in diesem Moment. Kein Stehkragen, keine Schnürstiefel, kein Korsett engten sie ein. Keiner beobachtete sie. Keiner kontrollierte mit wachsamen Augen jede ihrer Bewegungen. Sie blieb abrupt stehen und sah sich kurz um. Sie war in der Tat mutterseelenallein. Keiner würde es sehen. Keiner konnte sie daran hindern. Hastig öffnete sie die Knöpfe. Sie schob gerade das Nachthemd über die Schulter, als ein lautes Plätschern die Stille durchbrach. Marie-Helene stand wie versteinert und starrte auf den schattenhaften Umriss eines Menschen, der direkt vor ihr aus dem Wasser auftauchte. Eigentlich hätte sie schreiend vor Angst die Flucht ergreifen müssen. Aber die Gestalt, die langsam auf sie zu watete, erschien ihr so unwirklich, dass sie erst daran dachte davon zu laufen, als es schon zu spät war. Er war nur noch einen Meter von ihr entfernt, als sie ihn erkannte. Es war der junge Mann, der sich von der Rah der ‚Kläre-Auguste‘ ins Meer gestürzt hatte. Seit ihrer Ankunft hatte sie ihn nicht mehr zu Gesicht bekommen. Aber es war seither kein Tag vergangen, an dem sie nicht mindestens einmal an ihn gedacht hatte. Und jetzt stand er direkt vor ihr. Die Wassertropfen auf seiner Haut glänzten silbern im Mondlicht und ein geheimnisvoller, beinahe mystischer Zauber umgab ihn. Die ganze Szenerie war von einer unwirklichen, märchenhaften Schönheit. Er kam ihr vor wie ein Geschöpf aus einer anderen Welt. Vielleicht war es ja tatsächlich nur ein Traum. Sie musste sich unbedingt vergewissern. Langsam, wie in Trance streckte sie ihre Hand aus und ihre Fingerspitzen berührten seine nackte Brust. „Hast du dich verlaufen?“ Er war einen Kopf größer als sie und sah jetzt leicht amüsiert auf sie herab. Als seine Stimme so unvermittelt die Stille durchbrach, schrak sie zusammen. Die ganze Ungeheuerlichkeit ihres Tuns kam ihr zum Bewusstsein und ihre Finger zuckten zurück, als hätte sie sich verbrannt. Entsetzt starrte sie ihn an. Was würde er jetzt bloß von ihr denken? „Es tut mir so leid. Ich wollte das nicht. Bitte entschuldigen Sie!“, stammelte Marie-Helene beschämt. Wie bei ihrer ersten Begegnung hatte er nur ein buntes Tuch um seine Hüften gewunden, das jetzt klatschnass an seinen Oberschenkeln klebte und die Einzelheiten seines Körpers verräterisch nachzeichnete. Nach den Moralvorstellungen, die ihr seit frühester Kindheit eingebläut worden waren, war er also quasi nackt. Flammende Röte überzog ihre Wangen und sie wusste vor Verlegenheit kaum wo sie hinschauen sollte.
Ein leises Lächeln huschte über sein Gesicht. Er hätte sie beinahe nicht wiedererkannt. Am Tag ihrer Ankunft hatte sie so steif gewirkt wie die Puppe aus geflochtenen Kokosfasern, mit der seine Schwester früher immer gespielt hatte. Jetzt mit ihren offenen Haaren und dem weißen Kleid, das ihr über die Schulter gerutscht war, sah sie viel natürlicher aus. Beinahe normal. Beinahe wie eine Samoanerin. „Hast du dich verlaufen?“, fragte er sie noch einmal. Als sie nicht antwortete und ihn nur mit weit aufgerissenen Augen anstarrte, wurde er unsicher. „Soll ich dich nach Hause bringen?“ „Nein! Ich will nicht heim!“ Er war überrascht. Hastig, fast ein wenig gehetzt hatte sie die wenigen Worte hervorgestoßen. Aber ihre Stimme klang trotzdem sehr bestimmt. Und sie schüttelte derart heftig den Kopf, dass ihre Haare flogen. Er fand das Ganze ziemlich merkwürdig. Von der fremden Macht, die im Augenblick in seiner Heimat das Sagen hatte, hielt er nicht allzu viel. Ihren Drang alles genau regeln zu müssen fand er geradezu abartig. Und ihre Pünktlichkeit hatte etwas wirklich Krankhaftes. Da sich die Kolonialherren üblicherweise nicht unter die Einheimischen mischten, hatte er bisher kaum Gelegenheit gehabt Deutsche näher kennenzulernen. Wenn er ehrlich war, hatte er aber auch überhaupt kein Interesse daran. Die Art und Weise, wie er und alle anderen Kinder und Jugendlichen in der deutschen Schule behandelt wurden, mochte er überhaupt nicht. Bei den wenigen offiziellen Anlässen, zu denen er seinen Großvater begleitete, hatte er auch den Vater des Mädchens kennengelernt. Baron von Schlingenhard war einer der netteren Leute. Er hatte halbwegs normale Ansichten und war nicht so schrecklich herablassend wie die meisten anderen Kolonialbeamten. Dass sich eine der Palagi-Frauen ohne Begleitung außerhalb ihres Hauses aufhielt und noch dazu nachts, hatte er noch nie erlebt. Er legte die hölzerne Harpune und den Korb aus geflochtenen Palmblättern, die er beim Tauchen immer dabei hatte, auf den Boden und ließ sich im weichen Sand nieder. „Wenn du noch hierbleiben möchtest, können wir uns ebenso gut hinsetzen.“ Marie-Helene war unschlüssig. Sie wusste, dass sie eigentlich unverzüglich nach Hause gehen sollte. Es war mehr als ungehörig mit einem jungen Mann allein zu sein. Noch dazu mitten in der Nacht. Aber andererseits wusste sie nicht, ob sie jemals in ihrem Leben wieder die Gelegenheit haben würde, mit einem Mann so ungestört reden zu können. Außerdem war sie unvorstellbar neugierig. Auch schien er ihr ungebührliches Betragen nicht weiter schlimm zu finden. Zumindest hatte er bisher kein Wort darüber verloren. Also setzte sie sich neben ihn. „Wie heißt du?“ „Marie-Helene. Und ...“ Sie stockte kurz. Ihn mit ‚Sie‘ anzusprechen kam ihr so albern vor. Also versuchte sie es nochmal. „Und wie heißt du?“ Das war zwar sehr ungewohnt für sie, fühlte sich aber deutlich besser an. „Die französischen Missionare auf Upolu gaben mir bei meiner Taufe den Namen Jean-Pierre. Mein richtiger Name ist aber Tulau`ena.“ Das klang aus seinem Mund so weich und melodisch, dass Marie-Helene meinte, noch nie einen schöneren Klang gehört zu haben. „Tulau`ena“, wiederholte sie leise. „Das ist wunderschön.“ Jetzt da ein Anfang gemacht war, gewann ihre Neugier die Oberhand. „Wie alt bist du?“, wollte sie wissen. „Sechzehn. Und du?“ „Ich bin fünfzehn.“ Sie überlegte kurz. „Wie kommt es, dass du so gut deutsch sprichst?“ „Seit die Deutschen die Missionsschule eröffnet haben, müssen wir alle dort hin gehen und eure Sprache lernen. Der erste Satz, den ich lernen musste, war ‚Hoch lebe Kaiser Wilhelm‘!“ „Möge Gott ihm ein langes Leben schenken!“, antwortete Marie-Helene automatisch. „Warum?“ Seine weißen Zähne blitzten in der Dunkelheit, als er sie mit einem spöttischen Grinsen ansah. Da konnte sie einfach nicht mehr anders und fing an zu kichern. „Ich weiß es nicht. Das sagt man bei uns einfach so. Sowie sein Name ausgesprochen wird. Mein ganzes Leben lang hat man mir beigebracht, dass unser Kaiser etwas Erhabenes und Großartiges ist, dem man stets mit der allergrößten Hochachtung begegnen muss. Eigentlich finde ich, er sieht mit seinem komischen Schnurrbart und seiner ewigen Pickelhaube einfach nur lächerlich aus. Als ich einmal gewagt habe zu fragen, warum er seinen Arm immer so merkwürdig hält, habe ich von meinem Vater eine fürchterliche Tracht Prügel bekommen. Drei Tage lang konnte ich nicht sitzen.“ Sie sah ihn von der Seite an. „Du bist der Erste mit dem ich darüber rede. Der Erste bei dem ich keine Angst habe, dass ich der Gotteslästerung bezichtigt werde, wenn ich unseren Kaiser komisch und albern finde.“ Wieder blitzten seine Zähne in der Dunkelheit. „Mein Lehrer Père Antoine pflegt ihn nur ‚mon petit chou‘ zu nennen. Dabei bläst er immer die Backen auf und marschiert im Stechschritt vor uns auf und ab.“ „Du warst auch in einer französischen Schule?“ Er nickte. „Mein Großvater wollte nicht, dass ich zu den englischen Missionaren gehe. Deshalb ist er mit mir regelmäßig nach Savai`i zu den französischen Maristen-Brüdern gefahren, damit ich dort unterrichtet werden konnte.“ „Ich war nie in einer richtigen Schule“, seufzte sie. „Ich wurde immer gemeinsam mit meinen Brüdern von Pastor Rieflein unterrichtet. In Hamburg und hier auch wieder.“ „Gibt es bei euch keine Schulen?“ „Doch natürlich. Aber es ist vornehmer einen eigenen Hauslehrer zu haben. Und meine Mutter legt sehr viel Wert auf Vornehmheit.“ Ein spitzbübisches Grinsen huschte über ihr Gesicht. „Wenn sie wüsste, dass ich hier bin, würde sie auf der Stelle in Ohnmacht sinken und drei Fläschchen Riechsalz und ein Dutzend Essigumschläge wären erforderlich um sie wieder auf die Beine zu bringen.“ „Warum bist du denn hier?“ Marie-Helene zögerte. Sie spürte seinen Blick und wurde unsicher. Es war so schwer zu erklären. „Ich weiß nicht genau. Vielleicht weil ich noch nie barfuß durch Sand gelaufen bin. Vielleicht weil ich noch nie meine Füße im Meer gebadet habe. Vielleicht weil ich wissen wollte, wie es sich anfühlt, wenn der Wind durch meine offenen Haare weht. Vielleicht weil ich es satt habe immer zuschauen zu müssen, wie meine Brüder am Strand herumtollen. Vielleicht aber einfach nur, weil sie es mir verboten haben.“ Er hatte sie nicht aus den Augen gelassen. So entging ihm auch nicht wie sich bei ihrer letzten Bemerkung ihre Schultern strafften und sie ihr Kinn trotzig nach vorn streckte. Tulau`ena runzelte die Stirn. Wieso sollte sie nicht an den Strand und ans Meer gehen dürfen? Samoa war eine Insel und rund herum von Wasser umgeben. Warum kamen denn die Deutschen überhaupt hierher, wenn sie kein Interesse am Meer und am Strand hatten? Da konnten sie doch ebensogut zu Hause bleiben. Offensichtlich war nicht nur der deutsche Kaiser komisch, sondern auch alle seine Untertanen. „Was tust du hier mitten in der Nacht?“, wollte Marie-Helene wissen. Er deutete auf die Harpune und den Korb neben sich. „In den letzten Nächten vor Vollmond komme ich immer hierher. Die Zackenbarsche verlassen nachts das Riff und schwimmen dicht unter der Wasseroberfläche. Sie sind dann leichter zu jagen.“ Er öffnete den Korb und zeigte ihr die Ausbeute seines nächtlichen Tauchgangs. Andächtig betrachtete Marie-Helene die vier dicken Fische mit den scharfen, spitzen Zähnen in den weit aufgerissenen Mäulern. „Soll das heißen, du schwimmst da draußen herum und spießt mit dem spitzen Stock die Fische im Wasser auf?“ In ihren Augen konnte er deutlich den Zweifel erkennen. „Du glaubst mir nicht?“ Sie schüttelte vehement den Kopf. Da griff er nach der hölzernen Harpune, sprang auf und rannte ohne sich noch einmal umzudrehen los. Mit einem eleganten Kopfsprung stürzte er sich ins Meer. Verblüfft stand Marie-Helene auf und rannte ebenfalls zum Wasser. Sie raffte ihr langes Nachthemd zusammen um es vor der sanften Dünung zu schützen. Vorsichtig ging sie ein paar Schritte ins Wasser hinein. In der kurzen Zeit war Tulau`ena schon so weit hinausgeschwommen, dass sie ihn in der Dunkelheit kaum noch erkennen konnte. Lediglich das unregelmäßige Glitzern der Wellen im Mondlicht und ein leises Plätschern verrieten die Position des nächtlichen Jägers. Aber auf einmal hörte auch das auf. Es war still, bis auf das eintönige Zirpen der Zikaden, das ganz leise, wie aus weiter Ferne an ihr Ohr drang. Marie-Helene stand einfach nur da und wartete. Beinahe eine halbe Ewigkeit. So kam es ihr zumindest vor. Es erschien ihr unvorstellbar, dass ein Mensch so lange unter Wasser bleiben konnte. Da tauchte er genauso unvermittelt vor ihr aus dem Meer auf, wie beim ersten Mal. Triumphierend streckte er seinen Arm in den nächtlichen Himmel. Am Ende der Harpune zappelte ein fetter Fisch. Er kam auf sie zu. Selbst in der Dunkelheit sah sie seine weißen Zähne blitzen, als er sie mit einem strahlenden Lachen anschaute. „Und? Bist du beeindruckt?“ Marie-Helene ließ ihr Nachthemd los, das sie bisher so sorgsam vor dem Wasser in Sicherheit gebracht hatte, und klatschte vor Begeisterung in die Hände. „Das ist einfach unglaublich! Wenn ich das meiner Freundin in Hamburg schreibe, glaubt sie mir kein Wort. Du bist großartig!“ Bewunderung klang aus ihren Worten. Und als Tulau`ena sie ansah, konnte er die Bewunderung auch in ihren Augen lesen. Er atmete tief ein und schüttelte seine nassen Haare. Es war ein tolles Gefühl, von einem Mädchen bewundert zu werden. Auch wenn es nur für etwas so Alltägliches war, wie das Fangen eines kleinen, langsamen Fisches. Vielleicht waren diese Deutschen ja doch nicht so übel. Vorsichtig löste der den Barsch von der Harpune und steckte ihn zu den anderen in den Korb. „Ach ich wünschte, ich könnte das auch“, seufzte Marie-Helene. Sehnsüchtig sah sie aufs Meer hinaus. „Aber ich kann ja noch nicht einmal schwimmen.“ „Was?“ Tulau`ena riss die Augen auf. „Du kannst nicht schwimmen? Das ist doch nicht dein Ernst?“ Sie schüttelte niedergeschlagen den Kopf. „In Hamburg gibt es nur eine einzige Badeanstalt für Frauen. Das Wasser ist immer schrecklich kalt. Selbst im Sommer. Ich bin dort ein paar Mal mit Mamas Zofe gewesen. Aber ich habe es einfach nicht geschafft mich über Wasser zu halten. Die Kleider haben sich mit Wasser vollgesaugt. Sie waren dann so furchtbar schwer, dass ich immer nur mit knapper Mühe und Not wieder an den Steg plantschen konnte.“ „Man geht doch nicht mit Kleidern ins Wasser.“ „Wir in Hamburg schon.“ Marie-Helenes Stimme klang mutlos und niedergeschlagen. „In voller Montur, wie meine Brüder zu sagen pflegen. In langer Badehose und einem Badekleid bis zu den Knien. In Strümpfen und Badeschuhen. Selbstverständlich dürfen Haube und Korsett auf keinen Fall fehlen.“ Zu spät fiel ihr ein, dass es höchst ungehörig war, mit einem Mann über Unterwäsche zu reden. Sie biss sich auf die Lippen und schaute verlegen zu Boden. „Dann wundert es mich nicht, dass du nicht schwimmen kannst. Es ist ja auch völliger Unsinn mit Kleidern ins Wasser zu gehen.“ Er überlegte kurz. „Deine Brüder haben aber nur kurze Hosen und ein dünnes Hemd an, wenn sie an den Strand kommen.“ „Na klar!“, rief Marie-Helene zornig. „Das sind ja auch Jungs. Die dürfen sowas. Mädchen nicht. Das wäre unschicklich.“ „Was ist das eigentlich: Unschicklich?“, fragte er neugierig. Er kannte den Ausdruck nur zu gut. Der deutsche Missionar in der Schule verwendete ihn in beinahe jedem Satz. „Unschicklich ist etwas, das man nicht tun darf. Etwas, das in der Gesellschaft verboten ist oder zumindest nicht gerne gesehen wird“, erklärte sie. Tulau’ena nickte zustimmend. „Das kenne ich. In unserer Sprache nennen wir es tabu.“ Er betrachtete das Mädchen neben sich nachdenklich. „Es ist unglaublich, dass du nicht schwimmen kannst. Bei uns kann das jeder. Meistens schon bevor wir laufen können.“ Er dachte kurz nach. „Ich kann es dir beibringen, wenn du möchtest.“ Marie-Helene starrte ihn an. „Das würdest du tun?“, stammelte sie ungläubig. Als er nickte, rief sie begeistert: „Das wäre wundervoll!“ Aber ihre Freude war nur von kurzer Dauer. Mutlos ließ sie den Kopf hängen. „Meine Mutter erlaubt das niemals.“ „Sie braucht es doch nicht zu wissen.“ Sie runzelte die Stirn und sah ihn fragend an. „Nachts schläft deine Mutter doch. Oder etwa nicht?“ Er grinste verschwörerisch. „Du meinst..?“ Marie-Helene war nicht sicher ob sie ihn richtig verstanden hatte. „Schleich dich einfach nachts aus dem Haus, so wie du es heute auch gemacht hast, und komm hierher an den Strand. Ich werde auf dich warten. Dann zeige ich dir wie man schwimmt und taucht. Du wirst sehen, es ist nicht schwer.“ Marie-Helene nickte überglücklich. „Ich glaube ich muss jetzt aber wirklich gehen. Sonst merkt vielleicht noch jemand, dass ich nicht da bin. Das wäre fürchterlich“, sagte sie bedauernd. „Du hast recht“, stimmte ihr Tulau`ena zu. „Ich bringe dich nach Hause.“ Er nahm sie bei der Hand und sie folgte ihm bereitwillig. Er fand sich ohne Probleme im Finstern zurecht. So standen sie kurze Zeit später unter dem großen Jacarandabaum vor der Von-Schlingenhard’schen Villa. Ein wenig hilflos sah Marie-Helene zu dem Ast hinauf, den sie erreichen musste um zurück auf den Balkon klettern zu können. „Ich helfe dir“, flüsterte ihr neuer Freund. Noch ehe sie etwas erwidern konnte, legte er seine Hände um ihre Taille und hob sie scheinbar mühelos hoch. Sie klammerte sich an den Ast über ihr und zog sich nach oben. Flink kletterte sie auf den Balkon. „Gute Nacht Tulau`ena“, flüsterte sie. „Manuia te po, Marie-Helene“, kam die Antwort aus der Dunkelheit. Sie hörte noch das Rascheln der Büsche, dann war sie wieder allein mit tausenden Zikaden. Auf Zehenspitzen schlich sie in ihr Zimmer. Bis auf das Schnarchen ihres Vaters war es still im Haus. Sie konnte sicher sein, dass niemand ihren nächtlichen Ausflug bemerkt hatte. Leise schloss sie die Balkontür. Sie zog das nasse Nachthemd aus und hängte es über die Stuhllehne. Es war so warm im Zimmer, dass es bis zum Morgen sicherlich trocknen würde. Die Haare waren schnell wieder zu ordentlichen Zöpfen geflochten und die unvermeidliche Schlafhaube aufgesetzt. Flink wusch sie sich noch die Füße in der Porzellanschüssel, damit es ja keine verräterischen Spuren ihres nächtlichen Abenteuers gab. Schließlich hatte sie es geschafft. Das neue Nachthemd war so steif gestärkt, dass es leise knisterte, als sie die Decke über sich zog. Ein glückliches Lächeln huschte über ihr Gesicht. Noch am Nachmittag war sie sich vorgekommen wie ein Kanarienvogel, eingesperrt in einem viel zu engen Käfig. Aber jetzt war plötzlich alles anders. Am Tag würde sie die ihr zugedachte Rolle spielen. Oh ja. Sie würde so fügsam, geduldig und lieb sein, wie es Pastor Rieflein, ihre Mutter und die alten Schnepfen vom Teekränzchen von ihr erwarteten. Niemand sollte je wieder einen Grund haben sich über sie zu beklagen. Aber die Nacht würde ihr gehören. Sie würde frei sein. Sie würde an den Strand gehen so oft sie wollte. Und dort würde er auf sie warten! Ihr neuer Freund! Ein Freund, bei dem sie sich nicht verstellen musste. Mit dem sie nicht geziert und vornehm reden musste. Ein Freund, der ihr das Schwimmen beibringen würde. Sie schloss die Augen. „Tulau`ena“, flüsterte sie leise, ehe sie einschlief.