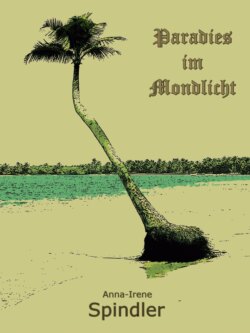Читать книгу Paradies im Mondlicht - Anna-Irene Spindler - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Nichts verraten!
ОглавлениеMarie-Helene schraubte ihren Füllfederhalter zu. Es waren wieder fünf Seiten geworden. Und sie hätte noch so viel mehr schreiben können. Es gab unglaublich Vieles zu berichten. Vieles, was sie nur Friedericke anvertrauen konnte. Die vertraulichen Gespräche mit ihrer besten Freundin fehlten ihr sehr. Sie waren aber auch wirklich das Einzige in der alten Heimat, dem sie nachtrauerte. Als die Tinte getrocknet war, nahm sie die Blätter wieder zur Hand und überflog ihren Brief. Immer wieder fing sie an zu kichern. Auf die detailgetreuen Schilderungen der Teekränzchen mit der ‚Fetten und der Dürren‘ war sie besonders stolz. Friedericke würde sich bestimmt königlich amüsieren, wenn sie die Zeilen las. Leider gab es auch weniger Erfreuliches zu berichten. Auf den letzten zwei Seiten hatte sie Friedericke ihr Herz ausgeschüttet.
„... Ich dachte wirklich, es wäre eine prima Idee, mich auf dem Fest mit dem Klienzel-Erben gut zu stellen. Aber der Schuss ging nach hinten los. Und zwar so richtig! Mama fühlt sich in ihren Plänen bestärkt, den Von-Schlingenhard‘schen Namen mit dem Klienzel‘schen Vermögen zu verbinden. Und die Dürre ist felsenfest davon überzeugt, ich wäre in ihren blöden Sohn verliebt! Kannst Du Dich noch an die schleimige Aalsuppe erinnern, die unsere Erna im Winter manchmal gekocht hat? Die mit den vielen Fettaugen drauf? Genauso musst Du Dir Franz-Ferdinand vorstellen: fett und schleimig! Und obwohl er zum Erbrechen langweilig und dumm ist, legt er eine Arroganz an den Tag, die ihresgleichen sucht. Ach Rieke, ich weiß nicht was ich tun soll! Beinahe täglich taucht er bei uns auf, bringt Mama Blumen mit und tut ihr schön. Dann lungert er bis zum Abend auf unserer Veranda herum und stopft sich mit Gebäck und Kuchen voll, bis seine Weste so stramm sitzt, dass die Knöpfe schier abspringen. Er hat nicht mehr Verstand als eine Ameise und redet nur Schwachsinn. Und trotzdem muss ich pflichtschuldig mit angehaltenem Atem seinen Worten lauschen und alles bis ins kleinste Detail mit regem Interesse aufsaugen. Er macht völlig blödsinnige Witze und lacht dann selber so schallend darüber, dass die Kuchenkrümel auf seinem prallen Wanst tanzen. Er hat eine feuchte Aussprache und riecht scheußlich aus dem Mund! FF - wie ich ihn insgeheim nenne - ist der abstoßendste Mensch, den ich kenne und ausgerechnet ihn hat Mama für mich ausgesucht! Gott sei Dank hat Papa keine allzu hohe Meinung von ihm. Stell Dir vor, gestern als FF wieder auf unserer Veranda saß und zwischen zwei Kuchenstücken mit seinem Reichtum prahlte – Zitat: ‚Ich kann mit Fug und Recht behaupten, die beste Partie in den ganzen Kolonien zu sein‘ – tauchte Papa plötzlich in der Terrassentür hinter ihm auf. Er schnitt schreckliche Grimassen und äffte FFs pompöse Gesten hinter seinem Rücken nach. Ich fing schallend zu lachen an. FF fragte mich indigniert, was denn so lächerlich wäre. Geistesgegenwärtig, wie ich nun mal bin, erwiderte ich – natürlich erst als ich mich halbwegs beruhigt hatte – dass ich nur an die ganzen aufgeblasenen Leutnants in der Heimat gedacht hätte, die von sich selbst so überzeugt wären und ihm trotzdem nicht das Wasser reichen könnten. FF glättete sein gesträubtes Gefieder, nickte ein paar Mal mit seinem dicken, roten Kopf und meinte selbstgefällig: ‚Wie wahr, wie wahr!‘ Du hättest Papa sehen sollen. Er hielt sich die Hand vor den Mund um nicht laut hinaus zu platzen, rollte mit den Augen und verschwand schleunigst in seinem Arbeitszimmer. Wenn es nach ihm ginge, könnte FF bleiben wo der Pfeffer wächst. Aber ich fürchte, wenn es hart auf hart kommt, wird er gegen die geballte Macht von Mama und der Dürren den Kürzeren ziehen. Auf jeden Fall muss ich mir schleunigst etwas einfallen lassen, wie ich ihn wieder los werde. Es ist aber auch zu blöd, dass es auf der ganzen Insel kein anderes Mädchen gibt, das der Dürren für ihren Filius gut genug wäre. Genau genommen gibt es aber auch keine Alternativen. Außer mir leben nur noch zwei deutsche Mädchen in unserem Alter auf der Insel. Wilhelmine und Amalia. Wilhelmine ist eigentlich ein ganz nettes Ding. Aber sie kommt als Heiratskandidatin nicht in Frage, weil ihr Vater ein armer Schlucker ist. Josef Weinländer ist ein Hilfsschreiber im Kontor der Plantagengesellschaft. Ihre Mutter ist auf der Überfahrt nach Samoa gestorben. Das war vor drei Jahren. Wilhelmine war zwölf Jahre alt. Denk nur: Jetzt muss sie ihrem Vater allein den Haushalt führen, weil sie sich kein Hausmädchen leisten können! Die Arme! Ich treffe sie manchmal bei Pastor Rieflein. Hinter der Kirche ist ein Gemüsegarten. Um den kümmert sie sich. Zum Dank darf sie immer ein bisschen Gemüse mitnehmen. Was mit Amalia Thennberg nicht stimmt, konnte ich noch nicht heraus bekommen. Sie scheint aber für die dürre Klienzel noch inakzeptabler zu sein als Wilhelmine, obwohl den Thennbergs eine große Tabakplantage gehört. Sehr seltsam, das Ganze! Ich muss bei den nächsten Teekränzchen unbedingt Augen und Ohren aufhalten. Es wäre doch gelacht, wenn ich nicht dahinter käme, was mit der Familie nicht stimmt. Sobald ich mehr weiß, bist Du, liebste Rieke natürlich die Erste, die es erfährt! Lass Dich aus der Ferne küssen und umarmen!! Deine Dich sehr vermissende Nene!
Sorgsam faltete Marie-Helene die eng beschriebenen Briefbögen und steckte sie in den Umschlag aus festem Büttenpapier. Das Kuvert war auf der Innenseite gewachst, damit die innenliegenden Blätter gegen Feuchtigkeit geschützt waren und so die lange Seereise gut überstanden. Die Briefumschläge waren ein Geschenk ihres Vaters. ‚Damit deine Briefe auf dem Weg in die Heimat nicht durchweichen. Und...‘ Er hatte eine kurze Pause gemacht und ihr dann noch ein nagelneues Siegel und den dazugehörigen Lack in die Hand gedrückt ‚...damit deine Geheimnisse sicher bewahrt werden.‘ Marie-Helene hielt die Siegellackstange über die Kerze. Sie streifte einen großen roten Klecks auf die Rückseite des Kuverts und drückte ihr Siegel hinein. Die verschlungenen Anfangsbuchstaben ihres Namens - MHS - unter einer gebogenen Kokospalme waren nun unauslöschlich in den roten Lack eingegraben. Das Motiv hatte sich ihr Vater selbst ausgedacht und Marie-Helene war ihm unendlich dankbar für dieses Geschenk. War es doch der Beweis, dass sie in den Augen ihres Vaters kein kleines Mädchen mehr war. Denn nur Erwachsene hatten ihr eigenes, persönliches Siegel. Trotzdem gelang es ihr immer noch nicht, einen Brief zu schreiben ohne sich die Finger mit Tinte zu beschmieren. Im Lavoir aus geblümtem Porzellan auf ihrer Kommode schrubbte sie sich die Hände. Dann setzte sie ihren Strohhut auf und steckte den Brief in ihr Réticule. Sie wollte den Brief gleich zum Kontor der Plantagengesellschaft bringen. Morgen sollte wieder ein Schiff nach Hamburg ablegen, das auch die gesamte Post der Insel in die Heimat befördern würde. Natürlich hätte sie auch dem Hausmädchen läuten und ihr den Brief übergeben können. Aber sie wollte lieber auf Nummer sicher gehen. Wenn der Brief nicht rechtzeitig im Kontor war, würde er erst mit dem nächsten Schiff in vier Wochen nach Hamburg befördert. Außerdem war der Besuch am Arbeitsplatz ihres Vaters der einzige Ausflug, den sie unternehmen konnte, ohne vorher ihre Mutter um Erlaubnis zu fragen. Und, was für Marie-Helene noch viel wichtiger war, sie durfte ohne Begleitung zum Kontor gehen! Es war ein langer, zäher Kampf gewesen, ehe ihre Mutter damit einverstanden war. Als Zugeständnis hatte Marie-Helene versprochen, das Haus niemals ohne den verhassten Sonnenschirm – ihre Mutter hatte ihr umgehend einen Ersatz besorgt - zu verlassen. Solange sie vom Haus aus gesehen werden konnte, schritt sie sittsam, das Sonnenschirmchen elegant in der behandschuhten Rechten, die Fahrstraße zum Hafen hinunter. Sobald sie sich vor etwaigen neugierigen Blicken aus der heimischen Villa sicher wusste, klappte sie den Schirm zusammen. Die Spitzenhandschuhe wurden in den Stoffbeutel gestopft, der an ihrem Handgelenk baumelte. Aus den gemessenen Schritten einer vornehmen Dame wurde allmählich das befreite Hüpfen eines jungen Mädchens. Das geschlossene Schirmchen drehte sie mit den Fingern der rechten Hand lässig im Kreis herum, wie es die jungen Männer in Hamburg mit ihren Gehstöcken zu tun pflegten. So strebte sie fröhlich vor sich hin summend dem Gebäude der Handels- und Plantagengesellschaft entgegen. Im Vorzimmer ihres Vaters, in dem sonst drei Kontoristen arbeiteten, stand heute nur Josef Weinländer an seinem Schreibpult. Da er in der Rangordnung der Schreiber an letzter Stelle stand, hatte er keinen Anspruch auf einen Platz an einem der zwei riesigen Schreibtische. Seine beiden Kollegen saßen auf hölzernen Bürostühlen, während er seine Arbeit stets im Stehen verrichten musste. Und das bis zu zehn Stunden am Tag. Obwohl er allein im Büro war, wagte er es nicht sich auf einen der freien Stühle zu setzen. Als Marie-Helene die Türe öffnete, drehte er sich um. „Guten Tag Herr Weinländer. Wie geht es ihnen?“, rief sie fröhlich. „Guten Tag gnädiges Fräulein. Mir geht es gut! Danke der Nachfrage!“ Josef Weinländer konnte die hübsche Baronesse gut leiden. Sie war stets freundlich zu ihm und grüßte ihn genauso höflich wie seine Kollegen. Niemals ließ sie ihn spüren, dass er nur ein Hilfsschreiber war und gesellschaftlich weit unter ihr stand. „Ich dachte mir schon, dass Sie heute kommen. Wo doch das Schiff morgen ablegt!“ Marie-Helene lachte. Sie zog den Brief aus ihrem Beutel. „Fünf Seiten sind es diesmal wieder geworden“, verkündete sie stolz und streckte dem Schreiber den dicken Umschlag entgegen. „Wäre es dem gnädigen Fräulein möglich, den Brief selbst in den Postsack zu stecken? Ich habe Angst, den Brief schmutzig zu machen“, sagte Josef Weinländer und streckte ihr verlegen seine Hände entgegen. Mit Genugtuung nahm sie zur Kenntnis, dass alle zehn Finger über und über mit Tinte beschmiert waren. Wenn die Finger eines berufsmäßigen Schreibers so aussahen, durfte sie als Gelegenheitsliteratin auch ein bisschen klecksen. Der prall gefüllte Postsack lehnte in der Ecke. Marie-Helene steckte den Brief an der Seite möglichst weit hinunter, damit er ja nicht aus Versehen noch herausfiel. Dann trat sie neben den Schreiber, der sich wieder seinem Pult zugewendet hatte und stellte sich auf die Zehenspitzen. „Was machen Sie da?“ Neugierig sah sie ihm über die Schulter. In seiner gestochen scharfen Handschrift trug er lange Zahlenkolonnen in ein dickes Kassenbuch ein. „Die ‚Prinzessin Viktoria‘ legt doch morgen ab. Ich übertrage die Ladungslisten, die vom Frachtmeister des Schiffs erstellt wurden, in unsere Kassenbücher. Werden die Waren in Hamburg verkauft, wird der Erlös vermerkt. Mit dem nächsten Schiff, kommen die Verkaufslisten zurück. Dann wird hier im Buch hinter jedem einzelnen Posten dieser Erlös eingetragen. So kann man genau zuordnen, wieviel für welches Produkt erzielt wurde und den Plantagenbesitzern ihren Gewinn ausbezahlen.“ Marie-Helene war beeindruckt. „Ich stelle mir das furchtbar anstrengend vor. Da muss man ziemlich genau arbeiten. Sobald nur der kleinste Fehler passiert, glauben die Plantagenbesitzer doch die Gesellschaft wolle sie übers Ohr hauen.“ Erschrocken hielt sie sich die Hand vor den Mund. Die Röte schoss ihr ins Gesicht. „Das gnädige Fräulein wollte sicher zum Ausdruck bringen, dass die Plantagengesellschaft für ihre gewissenhafte Arbeit bekannt ist und deshalb das vollste Vertrauen ihrer Handelspartner genießt“, sagte Josef Weinländer und zwinkerte ihr fröhlich zu. „Selbstverständlich! Genau das wollte ich sagen.“ Marie-Helene war erleichtert, dass ihre höchst undamenhafte Bemerkung auf so viel Verständnis gestoßen war. „Wenn mich das gnädige Fräulein jetzt entschuldigen würde. Ich habe heute noch viel zu tun. Falls Sie den gnädigen Herrn Baron suchen? Er ist im Lagerhaus.“ „Es tut mir leid, wenn ich Sie aufgehalten habe. Herzlichen Dank für die freundliche Erklärung. Es war sehr aufschlussreich und interessant. Auf Wiedersehen und grüßen Sie Wilhelmine recht herzlich von mir.“ „Das habe ich sehr gern getan. Wenn Sie wollen, können Sie die Grüße selbst bestellen. Wilhelmine ist ebenfalls im Lagerhaus und macht sich dort nützlich. Auf Wiedersehen, Baronesse. Bis zum nächsten Mal.“ Der Schreiber wandte sich wieder seinem Kassenbuch zu und Marie-Helene verließ das Büro um ihren Vater zu suchen. Freiherr von Schlingenhard überwachte das Verladen der kostenbaren Fracht auf die ‚Prinzessin Viktoria‘. Diesmal bestand die Ladung hauptsächlich aus Tabak und Kokosöl. Noch wurde das frische Kokosnussfleisch direkt vor Ort zu Öl gepresst und in Fässern nach Deutschland transportiert. Aber nicht mehr lange. Gemeinsam mit Heinrich Klienzel, Leopold von Schwenger und Hubertus Thennberg plante der Baron den Bau einer eigenen Kopramanufaktur. Wenn das Kokosnussfleisch in Samoa getrocknet und anschließend gepresst wurde, bestand nicht mehr die Gefahr, dass während der langen Überfahrt nach Hamburg Verluste durch Leckage oder Ranzigwerden des Öls entstanden. Außerdem war Kopra sehr viel lagerungsfähiger als Kokosöl. So konnte man auf Preisschwankungen leichter reagieren. Der Rohstoff konnte zur Not ein paar Monate länger eingelagert werden, bis die Preise wieder anstiegen. Der Betrieb einer Kopramanufaktur auf Samoa war verhältnismäßig kostengünstig und der Gewinn für die Plantagengesellschaft um ein Zigfaches höher als beim Verkauf des Kokosöls. Es fehlte nur noch die Zustimmung aus Hamburg. Wenn diese, wie von der Hauptverwaltung versprochen, mit dem nächsten Schiff eintraf, konnte es endlich losgehen. Lief alles wie geplant, war dies die letzte Ladung Kokosöl, deren Verschiffung Baron von Schlingenhard beaufsichtigen musste. Marie-Helene schmunzelte, als sie ihren Vater endlich fand. Er hatte eine ganz eigene Vorstellung davon Arbeiten zu beaufsichtigen. Stehkragen, Schlips, Weste und Jackett hatte er wahrscheinlich gleich in seinem Büro gelassen. Sein ehemals blütenweißes Hemd war bis zum Gürtel aufgeknöpft und die Ärmel über die Ellbogen hochgekrempelt. Die großen Schweißflecken am Rücken und unter den Armen und die dreckverschmierte Hose legten Zeugnis davon ab, dass der Baron keine Scheu davor hatte, selbst mit anzupacken. Gut, dass seine Frau in so nicht sehen konnte! Immer und immer wieder hielt sie ihm vor, dass er sich als Autoritätsperson nicht auf die gleiche Stufe stellen dürfe mit einfachen Arbeitern. ‚Deine Mutter – Gott hab‘ sie selig! – würde sich im Grab umdrehen, wenn sie dich so sehen könnte‘, pflegte sie händeringend und augenrollend zu klagen, wenn ihr Mann wieder einmal verschwitzt und dreckig nach Hause kam. ‚Und mein Vater würde mir stolz auf die Schulter klopfen und sagen: Bravo, mein Junge!‘, antwortete ihr Gatte mit schöner Regelmäßigkeit. Er wusste, dass er mit dem Hinweis auf seinen Vater seiner Gattin den Wind aus den Segeln nahm. Sie hatte für ihren Schwiegervater nicht allzu viel übrig gehabt. Der joviale Freiherr pflegte seine Pferde selbst zu beschlagen und jeden seiner Knechte und Pächter unter den Tisch zu trinken. Sehr zur Erleichterung der Baronin hatte er schon zwei Jahre nach ihrer Eheschließung den Anstand besessen ‚in Frieden heimzugehen‘, wie sie es mit gebührend andächtiger Miene und gesenktem Haupt nannte. Dass er an den Folgen einer wilden Wirtshausschlägerei gestorben war, die er in volltrunkenem Zustand angezettelt hatte, verschwieg sie wohlweislich. Die bloße Erwähnung dieses lauten und ungehobelten Menschen, verursachte ihr sichtliches Unbehagen, so dass sie die Erwiderung ihres Mannes immer nur mit stummer Leidensmiene zur Kenntnis nahm. Sie wäre jedoch nicht Elisabeth Augustine Wilhelmine Freiherrin von Schlingenhard gewesen, wenn sie nicht weiterhin versuchen würde, ihren Mann von der Notwendigkeit eines distinguierten Verhaltens zu überzeugen. „Hallo Papa“, begrüßte Marie-Helene ihren Vater. „Hallo Kleines“, rief der Baron und drückte seiner Tochter einen Kuss auf die Nase. Er hatte gerade beim Stapeln der Tabakballen geholfen und Marie-Helene sog tief atmend den Duft ein, den ihr Vater aus den Tiefen des Lagerhauses mitbrachte. Sie liebte den Geruch der fermentierten Tabakblätter. „Du hattest bestimmt wieder einen Brief für den Postsack. An Friedericke. Stimmt’s? Lass mich raten. Drei Seiten?“ Lachend schüttelte Marie-Helene den Kopf. „Falsch! Fünf Seiten!“ „Oh je! Da wird die ‚Prinzessin Viktoria‘ wieder schwer Schlagseite bekommen, bei so viel Zusatzfracht“, zog der Baron seine Tochter auf. „Ich kann gar nicht verstehen, wie man so viel schreiben kann.“ „Du brauchst ja auch keine Briefe an deine Freunde zu schreiben. Ihr trefft euch doch jeden Monat beim Herrenabend. Da könnt ihr euch alles Wichtige erzählen. Die Einzigen, mit denen ich hier Neuigkeiten austauschen kann sind die Matronen – äh ich meine natürlich die Damen vom Teekränzchen.“ Sie stockte kurz und fuhr dann schelmisch grinsend fort: „Beinahe hätte ich es vergessen. Da gibt es ja doch jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Mein hochgeschätzter Verehrer Franz-Ferdinand ist ein ausgezeichneter Zuhörer! Er ist sehr dankbar, wenn ich rede. Dann muss er nichts sagen und hat Zeit sich den Wanst vollzustopfen.“ „Gott sei Dank isst er so viel! Dann hat er nicht so viel Gelegenheit mit seinem Reichtum zu prahlen“, erwiderte der Baron lachend. Marie-Helene genoss diese Gespräche mit ihrem Vater. Gerne wäre sie noch länger im Lagerhaus geblieben, aber der Lademeister der ‚Prinzessin Viktoria‘ wartete schon und klopfte ungeduldig mit seinem Bleistift gegen das hölzerne Klemmbrett in seiner Hand. „Ich muss jetzt wieder. Leider. Aber vielleicht magst du dich ja ein bisschen mit Wilhelmine Weinländer unterhalten. Sie muss hier irgendwo sein. Ich glaube, sie ist in deinem Alter. Das wäre doch eine bessere Gesprächspartnerin als die dürre Klienzel und ihr dicker Sohn, meinst du nicht auch.“ Der Baron zwinkerte seiner Tochter fröhlich zu, tätschelte ihr liebevoll die Wange und wandte sich dann wieder seiner Arbeit zu. Marie-Helene wollte sich gerade auf die Suche nach Wilhelmine machen, als ihr das Mädchen mit einem großen Henkelkorb über dem Arm entgegen kam. „Hallo Wilhelmine. Ich war auf der Suche nach dir. Dein Vater hat mir gesagt, dass du hier bist. Ich war bei ihm im Kontor. Morgen legt doch das Schiff ab und ich wollte meinen Brief lieber selbst in den Postsack stecken.“ Die Worte sprudelten Marie-Helene nur so aus dem Mund. Mit ihrer munteren Plauderei wollte sie Wilhelmine die schüchterne Zurückhaltung nehmen, die das Mädchen üblicherweise an den Tag legte. Es war aber auch kein Wunder. Ließ man sie doch tagtäglich spüren, dass in der Hautevolee von Samoa kein Platz war für armselige Hungerleider wie die Weinländers. Selbst die Von-Schlingenhard’schen Dienstboten sprachen respektlos von dem Hilfsschreiber und seiner mageren Göre. Sie bewohnten drei winzige Zimmer über einem der Lagerhäuser am Hafen. Wilhelmine war für das Sauberhalten der kleinen Wohnung verantwortlich. Sie wusch und flickte ihre eigenen Kleider und die ihres Vaters. Das Kochen und der Abwasch gehörten selbstverständlich auch zu ihren Aufgaben, da ihr Vater morgens um sechs Uhr seinen Dienst im Kontor antrat. Nach der Arbeit für die Plantagengesellschaft, machte er sich noch auf den Weg zu verschiedenen Pflanzern um für sie kleinere Schreibarbeiten zu erledigen. Auf diese Weise konnte er sich noch die eine oder andere Mark dazu verdienen. Wilhelmine ihrerseits machte Botengänge, jätete Unkraut in Gemüsegärten oder half, so wie heute, im Lagerhaus mit. Dafür wurde sie in der Regel mit Lebensmitteln bezahlt, die eine willkommene Ergänzung ihres sonst so kargen Speisezettels bedeuteten. „Gnädiges Fräulein“, flüsterte sie verschämt. Durch den schweren Henkelkorb behindert verunglückte der Knicks, den sie der Baronesse pflichtschuldig als Reverenz erweisen wollte. Marie-Helene griff nach ihrem Arm und zog sie hoch. „Lass doch den Unsinn. Ich bin so alt wie du und keine alte Matrone.“ Sie fasste an den Henkel des Korbes. „Und jetzt lass dir helfen. Das ist viel zu schwer für dich allein.“ Wilhelmine wusste gar nicht, wie ihr geschah. „Das ist sehr freundlich von Ihnen gnäd...“ „Ich heiße Marie-Helene, aber du kannst Nene zu mir sagen. Und...“, sie machte eine kurze Pause um ihren weiteren Worten das nötige Gewicht zu verleihen „...ich bin kein gnädiges Fräulein!“ Ein scheues Lächeln huschte über Wilhelmines Gesicht. „Und mich nennen alle nur Mina.“ Die Baronesse meinte es offensichtlich ehrlich. Keinerlei Blasiertheit schwang in ihren Worten mit. Sie war einfach nur freundlich. Also trugen sie gemeinsam den Korb mit den überreifen Bananen, die man Wilhelmine für ihre Hilfe im Lagerhaus geschenkt hatte. Auf der Rückseite des großen Gebäudes führte eine steile Holztreppe zur Wohnung der Weinländers hinauf. „Ich habe gestern Bananenbrot gebacken. Möchtest du ein Stück probieren?“ Wilhelmine rechnete mit einem ‚Nein-danke-ich-habe-keinen-Hunger‘ und war ziemlich verblüfft, als Marie-Helene höchst erfreut antwortete: „Gerne. Bei uns gab es heute noch nicht viel zu essen. Meine Mutter hat Migräne. Das bedeutet, es wird nicht gekocht, weil jedes Geräusch im Haus vermieden werden muss und selbst das Klappern von Besteck und Geschirr viel zu laut ist.“ „Ich komme gleich wieder“, rief Wilhelme und verschwand mit dem Korb hinter der Holztür, die sie sogleich hinter sich zu zog. Offensichtlich wollte sie nicht, dass jemand die Wohnung betrat. Marie-Helene respektierte diesen Wunsch. Sie setzte sich auf die oberste Stufe, nahm ihren Strohhut ab und legte ihn zusammen mit dem Sonnenschirm neben ihre Füße. Einen herrlichen Blick hatte man von hier oben. Die ‚Prinzessin Viktoria‘ lag in der Bucht vor Anker und schaukelte sacht in der leichten Dünung des Pazifiks. Auf dem Wasser herrschte geschäftiges Treiben. Immer drei Boote waren mit Tauen verbunden. Im ersten saßen vier Männer, ruderten und schleppten die beiden anderen Boote hinterher. Sie transportierten die Ladung vom Pier zum Schiff. Durch das Gewicht der Waren, lagen die Boote so tief im Wasser, dass das Dollbord kaum eine Handbreit über der Wasserlinie lag. Von den Booten, die schon längsseits der ‚Prinzessin Viktoria‘ lagen, wurden mit Hilfe großer Netze und des Ladebaums die Warenballen an Bord gebracht und unter Deck verstaut. „Ich sitze auch immer gerne hier und schaue den Männern beim Beladen der Schiffe zu.“ Wilhelmine war aus der Tür getreten und hatte sich ebenfalls auf der obersten Stufe niedergelassen. Sie hielt Marie-Helene einen alten Porzellanteller hin, dessen Rosenmuster durch langen Gebrauch schon fast bis zur Unkenntlichkeit verblasst war. Marie-Helene nahm eine Scheibe Bananenbrot und biss herzhaft hinein. „Mmmmh. Dassch schmeckt ja kösschtlisch.“ Dabei fielen ein paar Brösel aus ihrem vollen Mund. Ungeniert schleckte sie den Zeigefinger ab, tupfte mit dem nassen Finger die Brösel auf und schob dann den Finger in den Mund. Wilhelmine störte das nicht. Auch sie schob sich die heruntergefallenen Stückchen in den Mund und schleckte dabei die Finger ab. „Du hast es gut“, seufzte Marie-Helene, als sie den letzten Bissen hintergeschluckt hatte. „Niemand macht dir Vorhaltungen, wenn du deine Finger abschleckst. Mama bekäme auf der Stelle eine Nervenkrise, wenn sie mich dabei erwischen würde.“ „Es interessiert keinen, wie ich esse“, erwiderte Wilhelmine. „Aber dafür gibt es bei uns genügend Tage, an denen kann ich meine Finger nicht abschlecken, weil wir nichts zu essen haben. Das liegt aber nicht daran, dass ich beim Kochen keinen Krach machen darf. Es ist dann halt nichts da, was ich kochen könnte. Und meine Mutter sieht mich ja nicht mehr.“ Sie sagte das ohne jede Bitterkeit. Es klang lediglich wie eine einfache Feststellung. „Das muss schrecklich für dich gewesen sein, als deine Mutter starb.“ Der bloße Gedanke, dass ihre Eltern plötzlich nicht mehr da wären, erfüllte Marie-Helene mit Schrecken. Wilhelmine runzelte die Stirn, als würde sie angestrengt nachdenken und starrte auf die blaue Wasserfläche des Pazifiks. Dann, nach einer langen Pause, kam die Antwort: „Nein, war es nicht. Ich war froh, dass sie tot war.“ Marie-Helene war entsetzt. Mit weit aufgerissenen Augen starrte sie das Mädchen an ihrer Seite an. Wilhelmines Stimme war kalt und tonlos als sie zu erzählen begann: „Meine Mutter war maßlos enttäuscht als ich zur Welt kam. ‚Warum bist du bloß kein Junge geworden?‘ fragte sie mich jeden Tag mindestens einmal. Als ob es meine Schuld gewesen wäre, dass ich ein Mädchen bin. Ich war vier Jahre alt, da wurde mein kleiner Bruder Karl geboren. Von diesem Tag an war ich für meine Mutter Luft. Ich glaube, manchmal erinnerte sie sich nicht einmal mehr an meinen Namen. ‚Nichtsnutziges Gör‘ war die einzige Anrede, die ich von ihr zu hören bekam. Mein Bruder war ein gutes Jahr alt, als ich mich bei der Tochter unserer Nachbarin mit Masern ansteckte. Zwei Tage später wurde auch Karl krank und nach zwei Wochen ist er gestorben. Für meine Mutter brach eine Welt zusammen. ‚Mein Engel, mein Sonnenschein musste sterben und das Teufelsbalg, das in getötet hat, lebt immer noch‘ war von nun an ihr tägliches Lamento. Es dauerte nicht lange, da war ich selbst davon überzeugt, schuld am Tod meines kleinen Bruders gewesen zu sein. Dann fingen die Prügel an. Tag aus, Tag ein. Sie fand immer einen Grund. Und wenn es nur eine Haarsträhne war, die sich aus meinen Zöpfen gelöst hatte. Jeden Schlag begleitete sie mit dem Ruf ‚Du hast ihn getötet‘. Das ist nun schon so lange her, aber die Narben auf meinem Rücken kann man immer noch erkennen. Ich war schon neun Jahre alt, als endlich mein Vater dahinter kam, was sie mir täglich antat, während er beim Arbeiten war. Er stellte sie zur Rede und drohte ihr an sie aus dem Haus zu jagen, wenn sie mich noch einmal anrühren sollte. Die Prügel hörten zwar auf, aber sie dachte sich jeden Tag neue Grausamkeiten aus, mit denen sie mich quälen konnte. Auf Holzscheiten knien, mit bloßen Händen Brennnessel sammeln, mit nackten Füßen in der heißen Lauge die Wäsche stampfen. Kurz vor meinem zwölften Geburtstag kam Vater mit der Nachricht nach Hause, dass die Plantagengesellschaft einen Hilfsschreiber suchte und er sich beworben hatte. Meine Mutter wollte nicht nach Samoa. Ihr kleiner Engel müsste dann ja ganz allein auf dem Friedhof in Hamburg zurückbleiben. Aber Vater blieb hart. Er würde auf jeden Fall gehen und mich mitnehmen. Wenn sie keine Lust hätte, könnte sie ja die Scheidung einreichen und in Hamburg bleiben. Da blieb ihr nichts anderes übrig, als mitzukommen. Unterwegs wurde sie krank. Lungenentzündung. Ich saß an ihrer Koje als sie starb. Ihre letzten Worte waren ‚Du hast ihn getötet‘. Sie bekam ein Seemannsbegräbnis. Als ich zusah, wie das Segeltuchbündel mit ihrem steifen, kalten Körper im Wasser des Ozeans versank, herrschte nur ein Gedanke in meinem Kopf: Gott sei Dank ist sie endlich tot!“ Fassungslos hatte Marie-Helene zugehört. Wilhelmine war fünfzehn. Genauso alt wie sie selbst. Aber was für unfassbares Leid hatte sie in diesen fünfzehn Jahren erfahren müssen! Beschämt dachte sie an ihre eigenen kleinen Problemchen. Oh Gott! Wie nichtig und lächerlich wirkten sie im Vergleich zu dem Schmerz, den man diesem Mädchen neben ihr jahrelang zugefügt hatte. Spontan legte sie ihren Arm um Wilhelmines Schultern und drückte sie wortlos an sich. So saßen sie lange Zeit stumm nebeneinander. Endlich löste sich Wilhelmine mit einem Seufzer aus Marie-Helenes Umarmung. „Danke fürs Zuhören. Es hat so gut getan, jemandem davon erzählen zu können. Ich hatte gleich das Gefühl, ich kann ehrlich zu dir sein und muss dir nichts vormachen. Dass du jemand bist, dem ich keine falsche Trauer vorzuheucheln brauche. Aber bitte! Nichts verraten! Ich möchte nicht, dass jemand davon erfährt.“ „Ich muss mich bedanken. Dafür, dass du dich mir anvertraut hast, obwohl wir uns doch erst heute richtig kennengelernt haben. Und auf mich kannst du dich verlassen. Ich werde zu Niemandem ein Sterbenswörtchen sagen.“ Marie-Helene stand auf, setzte ihren Strohhut wieder auf und nahm ihr Sonnenschirmchen. „Auf Wiedersehen Mina. Ich hoffe wir sehen uns bald wieder.“ „Auf Wiedersehen Nene. Ja, das hoffe ich auch.“ Am Fuß der Treppe drehte sich Marie-Helene noch einmal um und winkte ihrer neuen Freundin zu. Langsam ging sie am Lagerhaus vorbei. Obwohl man sie von der heimischen Villa aus noch lange nicht sehen konnte blieb sie stehen, holte die Handschuhe aus ihrem Réticule, streifte sie über ihre Finger und spannte den Schirm auf. Ihre Abneigung gegen diese vermeintlichen Zwänge, die man ihr auferlegte, kam ihr plötzlich unglaublich albern vor. Was war das Tragen eines Korsetts, eines Sonnenschirms, eines hochgeschlossenen Kleides im Vergleich zu den grausamen Dingen, die man Wilhelmine zugefügt hatte? Sie beklagte sich über die Teekränzchen mit den Matronen. Wilhelmine war jahrelang täglich von ihrer Mutter blutig geprügelt worden. Wie kindisch sie doch im Grunde genommen immer noch war! Sie hatte noch eine Menge zu lernen. Tief in Gedanken versunken ging sie nach Hause.