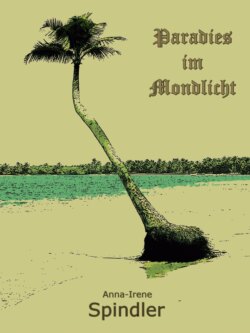Читать книгу Paradies im Mondlicht - Anna-Irene Spindler - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Barbaren und Menschenfresser
Оглавление„Es ist unsere Aufgabe, ja sogar unsere heilige Pflicht, sie unter unsere Fittiche zu nehmen und aus den dunklen Tiefen ihres Aberglaubens heraus ins Licht zu führen.“ Ein salbungsvolles Lächeln umspielte seine Lippen, als Pastor Rieflein die Worte durch bedächtiges Kopfnicken bekräftigte. „Hört, hört!“, kommentierte Marianne von Schwenger die geistigen Ergüsse des Gastes, der sich an diesem Dienstag ihrem Teekränzchen zugesellt hatte. Der Pastor hatte wirklich sehr eindrucksvoll die Notwendigkeit erläutert, die Samoaner von ihren verwerflichen, heidnisch angehauchten Bräuchen abzubringen und zu einer gesitteten, moralisch einwandfreien, arbeitssamen Lebensweise zu bekehren. Marie-Helene hatte das Gefühl, versehentlich in einen Sonntagsgottesdienst geraten zu sein und einer seiner langatmigen Predigten zuhören zu müssen. So interessant und abwechslungsreich Pastor Rieflein im Unterricht zu erzählen verstand, so einschläfernd und langweilig trug er seine Gedanken in den Gottesdiensten vor. Er kam vom Hundertsten ins Tausendste und drehte sich doch immer nur im Kreis. Es gelang ihm regelmäßig über eine Sache, die man ganz einfach in zwei Sätzen abhandeln konnte, geschlagene dreißig Minuten zu salbadern, ohne auch nur eine einzige winzige neue Erkenntnis hinzuzufügen. In genau dieser Manier hatte er die Damen in der vergangenen halben Stunde beglückt. „Noch ein wenig Tee?“ Elisabeth von Schlingenhard sah ihren Gast fragend an. Sie bereute es zutiefst, die Ungeschicklichkeit besessen zu haben, den Pastor am vergangen Sonntag nach dem Gottesdienst zu bitten, gelegentlich in der Von-Schlingenhard’schen Villa vorbei zu schauen. Kaum hatte sie sich heute mit ihren beiden Freundinnen und ihrer Tochter auf der Veranda niedergelassen, als das Hausmädchen den Besuch des frommen Kirchenmannes meldete. Sie konnte ja schlecht sagen, sie hätte keine Zeit, wenn sie sich auf der Veranda dem schnöden Nichtstun hingab. Notgedrungen musste sie den Pastor bitten sich zu ihnen zu setzen und ihnen Gesellschaft zu leisten. Der Austausch der neuesten Klatschgeschichten musste dann eben bis zum nächsten Teekränzchen warten. „Ma chère. Bist du wohl so gut und schenkst unserem geschätzten Herrn Pastor Tee ein.“ Auffordernd sah ihre Mutter sie an. Marie-Helene hob die Kanne, um nachzuschenken. Dabei schoss ihr der Gedanke durch den Kopf, den Tee einfach über des Pastors Hose zu kippen. Aber augenblicklich verwarf sie diese frevelhafte Idee wieder. Die Vorhaltungen ihrer Mutter wären weitaus unangenehmer, als das langweilige Geschwätz des ungebetenen Gastes. Es war aber auch zu dumm, dass er ausgerechnet heute auftauchen musste. Das Teekränzchen hatte eigentlich sehr vielversprechend begonnen. Die Dicke hatte gerade angefangen über die Thennbergs zu erzählen. Und Marie-Helene hatte schon die Ohren gespitzt, in der Hoffnung ein paar interessante Neuigkeiten über Amalia zu erfahren. Dann war Hinnerk Rieflein auf der Bildfläche erschienen und das oberflächliche seichte Geplapper musste den ernsthaften und erbaulichen Ausführungen des Geistlichen weichen. „...ihre Taten so dunkel sind wie ihre Hautfarbe!“ Marie-Helene runzelte die Stirn. In ihre eigenen Gedanken versunken, hatte sie den Anfang des Satzes nicht mitbekommen. Anscheinend ließ sich der Pastor immer noch über die besserungswürdigen Charaktereigenschaften der Samoaner aus. „Ihre barbarischen um nicht zu sagen teuflischen Sitten müssen ein für alle Mal ausgemerzt werden. Es ist noch keine zwanzig Jahre her, da waren sie allesamt Kannibalen“, ereiferte sich der Pastor weiter. „Zum Glück hat die Londoner Missionsgesellschaft so eine gute Vorarbeit geleistet. Sie haben - Gott sei gelobt! - den abscheulichen Brauch des Tätowierens verboten, diese schändlichste aller Signaturen des Heidentums. Unsere Kolonialverwaltung hat gut daran getan, dieses Verbot zu übernehmen und diesen widerlichen Körperkult unter Strafe zu stellen.“ Marie-Helene war entsetzt. Wie konnte der Pastor nur so etwas sagen! Tulau`ena war weder barbarisch, noch teuflisch. Er war freundlich und klug, einfühlsam und hilfsbereit. Und sein Großvater, der Große Matai, war doch mit Sicherheit kein Menschenfresser. Sie rutschte auf ihrem Stuhl nach vorn. „Herr Pastor. Darf ich Sie etwas fragen?“, machte sie sich bemerkbar. „Aber selbstverständlich mein Kind. Frage nur so viel du willst. Es ist eine meiner hehrsten Pflichten Unwissende zu belehren.“ „In der Bibel steht, Gott habe die Menschen nach seinem Bild geschaffen.“ „Richtig mein Kind. Wie ich sehe, hast du deinen Katechismus gut gelernt. Nur immer weiter so!“ „Aber dann sind doch auch die schwarzen, die roten, die gelben und die braunen Menschen Abbilder Gottes. Nicht wahr?“ Die Teetasse klirrte, als sie der Pastor ziemlich abrupt auf die Untertasse setzte. Irritiert sah er Marie-Helene an. „Nun ja. Im Prinzip schon. Aber...“ Marie-Helene ließ ihn nicht ausreden, sondern fuhr eifrig fort: „Dann sind wir in Gottes Augen doch alle gleich und die Weißen haben keinerlei Recht, über andere Völker zu urteilen. Vielleicht sind die Bräuche der Samoaner gar nicht teuflisch, sondern einfach nur anders.“ „Also wirklich!“, empörte sich Roswitha Klienzel. „Unerhört!“, pflichtete Marianne von Schwenger ihr bei. Wie konnte es diese vorlaute Göre nur wagen einem Geistlichen zu widersprechen und eine solche Ungeheuerlichkeit zu äußern? Das Gesicht des Pastors nahm die Farbe einer reifen Tomate an. Er holte tief Luft und öffnete den Mund, um dieses irregeleitete Menschenkind mit einer angemessenen Strafpredigt wieder auf den rechten Weg zu führen. Aber die Baronin kam ihm zuvor. Mit ruhiger Stimme, der man die innere Erregung nicht anmerkte, sagte sie zu ihrer Tochter: „Man hat dir nicht beigebracht, Erwachsenen ins Wort zu fallen. Das ist mehr als nur unhöflich. Es zeugt von äußerster Respektlosigkeit. Ich möchte, dass du dich auf der Stelle bei unserem geschätzten Herrn Pastor entschuldigst. Und was deine unbedachte und dumme Äußerung betrifft: Ich werde sie aus meinem Gedächtnis streichen und gehe davon aus, dass ich nie wieder - hörst du mich? - niemals wieder etwas Ähnliches von dir zu hören bekomme. Hast du mich verstanden?“ Durch ihre Lorgnette hindurch sah sie ihre Tochter mit einem so eisigen Blick an, dass Marie-Helene die Kälte bis ins innerste Mark spürte. Den Tränen nahe stand sie auf, trat vor den Pastor hin, machte einen tiefen Knicks und sagte: „Ich bedauere mein ungehöriges Verhalten zutiefst. Meine unüberlegte Plapperei tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Bitte verzeihen Sie mir meine Respektlosigkeit! Ich verspreche Ihnen, mich zu bessern und zukünftig vorher sehr genau nachzudenken, ehe ich etwas sage.“ Während der Zurechtweisung des Mädchens durch die Mutter, hatte sich der Pastor beruhigt. Im Grunde seines Herzens war er froh, dass ihm Baronin von Schlingenhard zuvor gekommen war. So war er nicht gezwungen gewesen, auf die wirren Gedankengänge einer dummen Fünfzehnjährigen zu antworten. Sanft legte er dem reumütigen Mädchen, das jetzt vor ihm kniete, die rechte Hand auf das gebeugte Haupt. „Du bist ein dummes unwissendes Kind, das nicht weiß, was es tut. Deshalb werde ich dir die Vergebung nicht verwehren, auch wenn du dich einer großen Ungehörigkeit schuldig gemacht hast. Da du dich reuig zeigst, trage ich dir dein Fehlverhalten nicht nach. Um deinen Vorsatz zu unterstützen, deine Rede zukünftig gedankenvoller zu gestalten, will ich dir eine kleine Hilfe zuteil werden lassen. Ich möchte, dass du bis zu unserer nächsten Unterrichtsstunde Martin Luthers Katechismuslied über die zehn Gebote ins Lateinische übersetzt. Natürlich unter Beibehaltung des Reimschemas und der Melodieführung. Diese Übung wird dir helfen, deine Gedanken wieder in die rechten Bahnen zu lenken.“ Marie-Helene schluckte. Sie kannte die zehn Strophen des Liedes auswendig. Für die Übersetzung würde sie einen ganzen Tag brauchen. Noch dazu, wenn sich die lateinischen Wörter reimen sollten und auch zur Melodie passen mussten. „Danke Herr Pastor für ihre großmütige Freundlichkeit.“ Sie stand auf und wollte sich wieder auf ihren Stuhl setzen. „Du wirst auf der Stelle in dein Zimmer gehen. In einer Stunde beginnen deine leçons française. Bereite dich sorgfältig darauf vor.“ Die Stimme ihrer Mutter hatte einen harten, metallischen Klang. „Wie Ihr wünscht, Maman.“ Anmutig knicksend verabschiedete sich von den beiden Damen und dem Pastor. Dann drehte sie sich um und unter Aufbietung aller Kräfte gelang es ihr gemessenen Schrittes über die Terrasse ins Haus zu gehen. Kaum war sie außer Sichtweite der Teegesellschaft, raffte sie ihre Röcke zusammen und rannte die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Tränen liefen über ihre Wangen. Was war da gerade passiert? Sie verstand es nicht. Wofür hatte man sie bestraft? Sie hatte doch nichts Falsches getan. Na gut! Sie war dem Pastor ins Wort gefallen. Dafür hatte sie vermutlich einen Rüffel verdient. Aber was sie gesagt hatte, war doch keine Ungeheuerlichkeit. Der Pastor hatte sie zuerst sogar noch gelobt. Was sie danach geäußert hatte, war doch nur die logische Schlussfolgerung aus dem, was im Katechismus stand. Sie holte ein Taschentuch aus ihrem Nachtkästchen, tupfte die Tränen ab und schneuzte sich lautstark. Dann wusch sie sich in der Schüssel auf ihrer Kommode das Gesicht. Als sie das Gesicht abgetrocknet hatte, musterte sie sich im Spiegel. Energisch hob sie das Kinn. „Nein“, sagte sie laut zu ihrem Spiegelbild, „Tulau`ena ist kein teuflischer Wilder.“ Sie war felsenfest überzeugt davon, dass sie im Recht war und der Pastor im Unrecht. „Jean-Pierre ist doch kein Wilder“, stieß sie leidenschaftlich hervor. Eine Viertelstunde zuvor hatte sie das Klassenzimmer der Missionsschule betreten, in dem sie sich seit der Dorfversammlung einmal in der Woche zum Französischunterricht bei Père Antoine einfand. Dem Maristenpater war sofort aufgefallen, dass etwas nicht stimmte. Kaum hatte er gefragt, was sie bedrückte, war es auch schon aus ihr herausgesprudelt. In allen Einzelheiten erzählte sie ihm ihr bitteres Erlebnis beim Teekränzchen. „Wie kann Pastor Rieflein nur so etwas sagen?“ Ihre ganze Empörung schwang in dieser Frage mit. Père Antoine hatte ihr schweigend zugehört. Marie-Helene saß in einer der Schulbänke in der ersten Reihe und sah ihn mit großen fragenden Augen erwartungsvoll an. Offensichtlich war dieser letzte Satz nicht nur rhetorisch gemeint. Er ließ sich Zeit. Eine Antwort auf diese Frage musste wohl überlegt sein. Schon während der allerersten Unterrichtsstunde hatte er erkannt, dass er es mit einem aufgeweckten intelligenten Mädchen zu tun hatte. Marie-Helene besaß einen scharfen analytischen Verstand und machte sich klar und wohlüberlegt über alles ihre eigenen Gedanken. Man konnte sie nicht mit oberflächlichen Plattitüden abspeisen. Sie verdiente es, ernst genommen zu werden. Er stand auf, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und ging ein paar Mal vor der großen schwarzen Schiefertafel auf und ab. Schließlich blieb er vor ihr stehen. „Ich kenne Pastor Rieflein kaum und kann deshalb nur mutmaßen, was ihn zu so einer Aussage bewogen hat. Wer weiß? Möglicherweise hat er in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit Menschen aus anderen Ländern gemacht. Vielleicht hat er aber auch einfach nur ohne nachzudenken die Vorurteile übernommen, die so viele Weiße gegenüber den Bewohnern ihrer Kolonien haben. Es ist leider eine weit verbreitete Angewohnheit der Menschen, Neuem und fremdartig Anmutendem ablehnend gegenüber zu stehen. Die Kirche macht da - Gott sei’s geklagt! - keine Ausnahme. Der Großteil der christlichen Missionare interessiert sich nicht für die überlieferten Bräuche, für die Kultur, für die Sagen und Legenden der Eingeborenen. Dabei wäre das so wichtig. Nur wenn man die Sitten der Menschen versteht, findet man einen Zugang zu ihrem Denken und zu ihrem Herzen. Und nur in den Herzen der Menschen kann man die frohmachende Botschaft unseres Heilands dauerhaft verankern.“ Père Antoine machte eine kurze Pause. Er streichelte Marie-Helene liebevoll übers Haar. „Obwohl du erst seit ein paar Monaten hier bist, hast du erkannt, worauf es ankommt, wenn man fremde Länder bereist: ‚Ihre Bräuche sind nicht teuflisch, nur anders‘. Du kannst sehr stolz auf dich sein. In deinen jungen Jahren hast du mehr Weitblick bewiesen, als der sittenstrenge Kirchenmann.“ Ein strahlendes Lächeln erhellte Marie-Helenes Gesicht. „Ich wusste doch, dass Jean-Pierre kein Wilder ist.“ „Nein“, lachte Père Antoine und schüttelte den Kopf. „Er ist kein Wilder und sein Großvater ist auch kein Menschenfresser.“ „Obwohl er überall tätowiert ist“, sagte Marie-Helene und kicherte. Der Maristenpater schmunzelte. „Das ist eigentlich ziemlich unfair von ihm. Findest du nicht auch? Von jemandem, der seinen Körper mit schwarzer Farbe verunstaltet, sollte man erwarten, dass er ein ganz und gar böser Mensch, mit einer rabenschwarzen Seele ist. In Wirklichkeit ist der Große Matai der ehrenwerteste Mann, den ich auf meinen Reisen getroffen habe. Und ich bin weit herumgekommen in der Welt.“ Marie-Helene liebte die Gespräche mit dem französischen Pater. Er behandelte sie nie wie ein kleines Kind. Stets hatte sie das Gefühl von ihm ernst genommen zu werden. Einerlei welche Fragen sie ihm stellte. Immer war er bemüht ihr ehrlich zu antworten. „Père Antoine. Was hat es mit diesem Brauch des Tätowierens auf sich? Warum tun die Samoaner das?“ „Sie haben mythologische Überlieferungen, die besagen, dass ihnen die Götter die Kunst des Tatauierens geschenkt haben. Die Muster sollen den Körper schützen. Eine Mischung aus Ruß, Kokosnussöl und Wasser wird mit besonderen Werkzeugen aus Knochen unter die Haut geklopft. Das Geräusch, das dabei zu hören ist, klingt ein bisschen wie ta-ta-ta. Daher kommt auch der Name Tatauierung. Die Prozedur dauert viele Wochen und ist sehr, sehr schmerzhaft. Für junge Männer ist es eine Art Mutprobe und bedeutet gleichzeitig den Eintritt in die Welt der Erwachsenen. Nach der Überlieferung der Samoaner ist nur ein tatauierter Mann ein fertiger Mann, der die Verpflichtungen gegenüber seiner Familie und der Gesellschaft erfüllen kann.“ „Aber dann ist das doch gar nichts Schlechtes“, sagte Marie-Helene. „Nein, natürlich nicht. In Europa tragen junge Männer auch Narben davon, wenn sie die Aufnahmerituale in Studentenverbindungen über sich ergehen lassen. Oder sie müssen ihren Mut beweisen indem sie eimerweise Bier in sich hineinschütten. Die Frauen wiederum färben sich die Haare, pudern sich die Gesichter weiß, kleben Schönheitspflästerchen auf und malen sich mit Rouge die Wangen an. Das ist auch eine unnatürliche Verunstaltung der Haut. Und doch kommt keiner auf die Idee es als heidnisch, barbarisch oder gar teuflisch anzuprangern.“ Marie-Helene fing an zu lachen. „Ich glaube, wenn ich das beim nächsten Teekränzchen zum Besten gebe, werde ich für den Rest meines Lebens Traktate von Martin Luther übersetzen müssen.“ „Da magst du wohl recht haben. Ich fürchte, ich stehe mit meinen Ansichten ziemlich allein da. Es wird das Beste sein, wenn diese Unterhaltung unter uns bleibt. Wenn du mich nicht verpetzt, helfe ich dir auch bei deiner Strafarbeit.“ „Ich denke es ist ziemlich gut geworden. Das vergesse ich Ihnen nie!“, rief Marie-Helene erleichtert und legte die drei fein säuberlich beschriebenen Seiten aufeinander. Unter Zuhilfenahme des flüssigen Kirchenlateins des katholischen Paters war es gar nicht so schwierig gewesen, die zehn Liedstrophen zu übersetzen. Im Klassenzimmer stand ein altes Harmonium. Auf ihm hatte Marie-Helene immer wieder überprüft, ob die lateinischen Worte auch wirklich zur Melodie passten. „Du darfst Pastor Rieflein natürlich nicht verraten, dass dir ein französischer Papist bei der Übersetzung geholfen hat. Er käme sonst auf die Idee die inneren Werte, die Luther vermitteln wollte, könnten durch das katholisch angehauchte Latein verloren gehen.“ Ein schelmisches Grinsen erhellte das faltige Gesicht des Missionars. Er beobachtete das Mädchen, wie es seine Sachen langsam und übertrieben sorgfältig zusammen packte. Irgendetwas hatte es noch auf dem Herzen, das spürte er. „Bedrückt dich noch etwas?“ Verlegen spielte Marie-Helene mit dem Verschluss ihrer ledernen Mappe. „Ich würde Sie gerne noch etwas fragen“, antwortete sie zögernd. „Nur zu. Immer heraus damit“, ermunterte sie Père Antoine. „Es ist wegen Jean-Pierre. Was meinen Sie? Wird er sich auch tatauieren lassen?“ Ein unsicherer, ängstlicher Unterton schwang in ihrer Stimme mit, den der Maristenpater sehr wohl bemerkte. „Vermutlich ja. Sollte er tatsächlich zögern, was ich mir kaum vorstellen kann, wird ihn sein Großvater schon zu überzeugen wissen. Wenn Jean-Pierre die Nachfolge seines Großvaters als Großer Matai antreten möchte, hat er keine andere Wahl. Nur tatauierte Männer können gewählt werden. Malietoa Tanumafili würde es sicher gerne sehen, wenn dieses wichtige und ehrenvolle Amt in der Familie bliebe. Du musst wissen, Jean-Pierres Eltern, sein großer Bruder und seine zwei jüngeren Schwestern sind bei einem tropischen Wirbelsturm ums Leben gekommen. Der Sturm wütete eine ganze Woche und verwüstete alles. Über einhundert Menschen sind damals auf den Inseln gestorben. Jean-Pierre war erst acht Jahre alt. Sein Großvater hat sich seitdem um ihn und seine ältere Schwester gekümmert. Jetzt ist er sechzehn und die gesamte Bürde, der Familie Ehre zu machen, lastet auf ihm. Es wird nicht mehr lange dauern, bis er sich in die Obhut des Tufuga ta tatau, des Tatauiermeisters begeben wird.“ „Wird man ihn nicht dafür bestrafen? Es ist den Samoanern doch verboten worden, sich zu tätowieren. Zuerst von der Londoner Missionsgesellschaft und jetzt auch von unserer Kolonialverwaltung.“ „Die Verbote der protestantischen Missionare haben Jean-Pierres Familie noch nie interessiert. Sein Urgroßvater wurde von den ersten Missionaren meines Ordens, die nach Polynesien kamen, getauft. Seither gehören alle Mitglieder der Familie der römisch-katholischen Kirche an. Außerdem ist der Große Matai ein überaus wichtiger Partner der Verwaltung und der Plantagengesellschaft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn vor den Kopf stoßen wird, indem man seinen Enkel bestraft, weil der sich tatauieren lässt.“ Nun war Marie-Helene zufrieden. Sie hatte wieder viel Neues und Interessantes erfahren. Der so übel begonnene Nachmittag hatte also doch ein versöhnliches Ende gefunden. Sie bedankte sich noch einmal überschwänglich für die Hilfe und machte sich dann auf den Nachhauseweg. Père Antoine stand unter der Tür der Missionsschule und sah ihr nach. Er hatte das Mädchen tief ins Herz geschlossen. Es war so ein liebes, nettes Ding. Darüber hinaus war es immens klug und sein Französisch war wirklich hervorragend. Er zog seine alte verbeulte Taschenuhr heraus. Stirnrunzelnd stellte er fest, dass es schon wieder ziemlich spät geworden war. Nun musste er sich aber gehörig sputen, wenn er die Missionsstation auf der Nachbarinsel Savai’i noch bei Tageslicht erreichen wollte. Er schloss die Tür ab und eilte, leise die Marseillaise vor sich hin summend, zum Hafen.