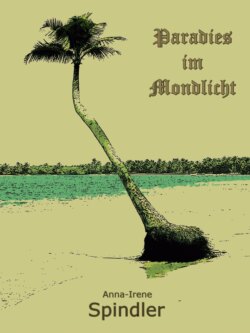Читать книгу Paradies im Mondlicht - Anna-Irene Spindler - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Fest
ОглавлениеNervös wanderte Marie-Helene auf der Terrasse hin und her. Wie konnte man nur so unendlich lange zum Anziehen brauchen? Ihre Mutter wurde und wurde einfach nicht fertig. Baron von Schlingenhard saß in seinem angestammten Korbsessel. Nachdem seine Frau auf die wiederholte Nachfrage, wann sie denn gedenke fertig zu werden, mit einem lauten und sehr nachdrücklichen „Lass mich in Ruhe!“ geantwortet hatte, hatte er sich mit einem ergebenen Seufzer eine dicke Zigarre angezündet. „Können wir nicht schon vorgehen, Papa?“ Marie-Helene ging neben ihrem Vater in die Hocke und sah ihn mit einem bettelnden Dackelblick an. „Glaubst du nicht, dass uns deine Mutter das übel nehmen würde?“ Er hatte die Zigarre aus dem Mund genommen und blickte sie von der Seite an. „Sehr übel sogar“, fügte er mit herabgezogenen Mundwinkeln und einem leichten Nicken hinzu. „Aber wir kommen doch zu spät“, versuchte es Marie-Helene noch einmal. „Glaube mir mein Schatz, du wirst dich noch früh genug langweilen. Diese Feste dauern immer ewig.“ Marie-Helene war ziemlich sicher, dass keine noch so lange Dorfversammlung langweiliger und öder sein konnte, als die wöchentlichen Teekränzchen ihrer Mutter. Aber das sagte sie natürlich nicht laut. Wobei ihr Vater ihr sicherlich beigepflichtet hätte, wenn er jemals gezwungen worden wäre mit den zwei alten Matronen Tee zu trinken. Bei seinen eigenen monatlichen Treffen mit den Plantagenbesitzern ging es bestimmt weitaus lustiger zu. Zumindest kam ihr Vater immer sehr fröhlich von diesen Besprechungen nach Hause. Johann, der Kammerdiener ihres Vaters, hatte jedesmal gewaltige Mühe, den sehr laut und sehr falsch singenden Baron die Treppen hinauf bis zu seinem Zimmer zu schaffen. Am nächsten Morgen saß der sonst immer so korrekte preußische Kolonialbeamte wie ein Häufchen Elend am Frühstückstisch, hielt sich den schmerzenden Kopf und gelobte seiner säuerlich dreinblickenden Gattin reumütig Besserung. Dieser hehre Vorsatz geriet aber spätestens am nächsten Herrenabend vollständig in Vergessenheit. Nein! Marie-Helene würde sich heute Abend nicht langweilen. Wie auch? Tulau`ena würde ja da sein. Drei Wochen waren seit jener denkwürdigen Nacht am Strand vergangen. In der ersten Woche war sie drei Nächte hintereinander in die Bucht geschlichen. Ihr neuer Freund hatte immer schon auf sie gewartet. Er hatte ihr ein ärmelloses, knielanges Kleid seiner Schwester mitgebracht. Hinter einer Palme, die von den Ranken einer Passionsblume völlig überwuchert war, war sie aus ihrem Nachthemd geschlüpft und hatte das einfache weiße Kleidchen angezogen. Ein wenig geniert hatte sie sich schon. Als sie sich das erste Mal so vor ihm sehen ließ, war sie sehr froh, dass es dunkel war und er die brennende Röte auf ihrem Gesicht nicht sehen konnte. Da er aber keinerlei Reaktion zeigte, überwand sie ihre Scheu sehr schnell und freute sich bald an der ungewohnten Bewegungsfreiheit, die ihr das leichte Kleidchen ermöglichte. Ihre Haare hatte sie zu zwei festen Zöpfen geflochten, dicke Schnecken daraus gedreht und diese links und rechts über den Ohren mit vielen Haarnadeln festgesteckt. Sie konnte nicht riskieren, dass das Hausmädchen am Morgen ein feuchtes Kopfkissen entdeckte und neugierige Fragen stellte. Als sie zum ersten Mal bis zum Hals in das salzige Wasser des Ozeans eintauchte, liefen ihr Tränen der Freude über die Wangen. Zu ihrer eigenen Überraschung fiel es ihr recht leicht die Bewegungen nachzuahmen, die Tulau`ena ihr zeigte. Und bereits in der dritten Nacht gelang es ihr, sich ohne seine Unterstützung über Wasser zu halten. Inzwischen war sie schon eine recht passable Schwimmerin geworden. Vor zwei Nächten war sie mit ihrem Freund sogar bis hinaus zum Ende des Felsens geschwommen, der die Bucht vom Hafen trennte. Sie hatten sich zum Ausruhen auf die warmen Steine gesetzt. Das Besondere an Tulau`ena war, dass man mit ihm nicht immer reden musste. Sie konnten einfach nur stumm nebeneinander sitzen und die herrliche Tropennacht genießen, dem leisen Rauschen des Meeres und dem unvermeidlichen Gezirpe der Zikaden lauschen. Sie verstanden sich ganz ohne Worte. Zu Beginn ihrer nächtlichen Exkursionen war sie verständlicherweise sehr ängstlich gewesen. Hatten doch die Mutter und die Kinderfrau Marie-Helene tagtäglich eingebleut, dass man allem, was Hosen anhatte, nur mit äußerstem Misstrauen begegnen durfte. Männer, ganz egal wie alt sie waren, wollten immer nur das Eine! Was genau dieses ‚Eine‘ war, wurde selbstverständlich nie erwähnt. Aber durch intensives Lauschen an diversen geschlossenen Türen hatte Marie-Helene herausgefunden, dass Männer offensichtlich, sobald sie mit einem Mädchen alleine gelassen wurden, dazu neigten sich ‚Freiheiten‘ herauszunehmen. Sie würden umgehend versuchen das betreffende Mädchen höchst unziemlich zu umarmen, es fest an sich zu pressen und ihr wenn möglich einen Kuss zu rauben. Der Ruf eines Mädchens, dem Derartiges widerfuhr, konnte leicht ein für alle mal ruiniert sein und vermutlich würde nie ein halbwegs ehrbarer Mann auf die Idee kommen, einem so leichtfertigen Geschöpf einen Antrag zu machen. Tulau`ena war ohne Zweifel ein Mann. Sie hatte ihn zwar noch nie in Hosen gesehen, dennoch wirkte er soviel männlicher als die jungen Männer, die in Hamburg in ihren Uniformen umher stolzierten wie aufgeplusterte Gockel auf dem Misthaufen. Und sie war nun schon so viele Stunden mit ihm allein gewesen. Noch dazu nachts. Trotzdem hatte er niemals versucht, sich ihr in unschicklicher Weise zu nähern. Selbst als er zu Beginn ihrer Schwimmstunden mit beiden Händen ihre Taille umfasst hielt, um sie am Untergehen zu hindern, war ihr diese Berührung nie aufdringlich oder gar ungehörig vorgekommen. Im Gegenteil. In seiner Gegenwart fühlte sie sich sicher und geborgen. Er war ihr ganz persönlicher, eigener griechischer Gott. Genauso wunderschön und heldenhaft. Lebendig geworden, einzig um ihr, Marie-Helene - einer Jungfrau in Nöten - zur Seite zu stehen und sie vor allen Gefahren zu beschützen! Auch tagsüber begleitete Tulau`ena sie beinahe auf Schritt und Tritt. Zumindest in ihrer Fantasie. Saß sie auf der Veranda zwischen den Teestunden-Matronen und langweilte sich beinahe zu Tode, schloss sie kurz die Augen und beschwor sein Bild herauf. Sie stellte sich vor, wie er über Frau von Schwengers fette Schulter spähte und grausige Grimassen schnitt oder hinter der dürren Klienzel, seine Harpune schwingend, wilde Tänze aufführte. Und schon verloren die öden Nachmittage ihren Schrecken. Auch das stundenlange Üben auf dem Klavier des Pastors war auf diese Weise zu ertragen. Sie widmete die endlosen Etüden, Sonaten und Kantaten ihrem neuen Freund. Pastor Rieflein, der Taktstock schwingend am Klavier lehnte, verschwamm vor ihren Augen und an seine Stelle trat Tulau`ena und hörte ihr mit einem leichten Lächeln in seinem Gesicht zu. „Können wir?“ Die Stimme ihrer Mutter riss Marie-Helene aus ihren Träumen. Madame de Slingenard stand in der Terrassentür. Sie sah hinreißend aus! Das Oberteil des hellblauen Brokatkleids war mit dunklen Ranken bestickt, die sich fast wie Schlangen um ihre schlanke Taille wanden. Für die Frisur hatte ihre Zofe über eine Stunde gebraucht. Perlenverzierte Kämme hielten die kompliziert gewundenen Strähnen an ihrem Platz. Die herrliche, vierreihige Perlenkette, die sie von ihrem Mann bei ihrer Ankunft in Samoa als Willkommensgeschenk erhalten hatte, lenkte den Blick auf das makellose Dekolleté der Baronin. Offizielle Anlässe waren ihre Welt! Hier war Freiin Elisabeth von Schlingenhard in ihrem Element! Selbst beim letzten Hamburgbesuch des Kaisers – Möge Gott ihm ein langes Leben schenken! – brauchte sie sich unter all den preußischen Prinzessinnen und Hoheiten seines Gefolges nicht zu verstecken. Hier auf der Insel war sie der leuchtende Stern, der Alle überstrahlte. Keine der anderen Kolonialfrauen konnte ihr das Wasser reichen! Marie-Helenes Vater pfiff anerkennend. „Du siehst zum Anbeißen aus!“ Er legte seine Arme um ihre Taille, zog sie an sich und küsste sie. Eine leichte Röte ließ ihre Wangen noch lieblicher erscheinen. „Aber Friedrich-August! Doch nicht vor dem Kind“, mahnte sie ihren Gatten und gab ihm einen leichten Klaps mit ihrem Spitzenfächer. Aber am Leuchten ihrer Augen war gut zu erkennen, wie sehr sie sich über das Kompliment ihres Mannes freute. „Heute Abend werden mich alle Männer beneiden, wenn ich mit zwei so bezaubernden Frauen auftauche! Darf ich bitten, meine Damen!“ Seine Gattin am linken und seine Tochter am rechten Arm untergehakt, machte sich der Direktor der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft auf den Weg zum großen Versammlungshaus von Apia. Trotz der langwierigen Verschönerungsarbeiten der Baronin kamen sie nicht zu spät, sondern trafen gleichzeitig mit den meisten anderen Gästen ein. Alles was Rang und Namen hatte war der Einladung des Großen Matai Malietoa Tanumafili gefolgt: Plantagenbesitzer und Kolonialbeamte, Missionare und Pastoren, Polizisten und Marinesoldaten. Die meisten hatten, wie Freiherr von Schlingenhard, ihre Ehefrauen mitgebracht. Marie-Helenes älterer Bruder Wilhelm hatte sich mit der fadenscheinigen Ausrede, er müsse noch ganz dringend griechische Vokabeln repetieren, einen freien Abend verschafft. Die jüngere Kolonialherrengeneration wurde also lediglich durch Marie-Helene und Franz-Ferdinand, den Sprössling der Klienzels, repräsentiert. Als sie den Thronerben des Klienzel’schen Plantagenimperiums hinter seinen Eltern her trotten sah, bereute sie zutiefst mitgekommen zu sein. Hätte sie gewusst, dass der aufgeblasene, dümmliche Alleinerbe des Klienzelvermögens auch kommen würde, wäre sie ihrem Vater nicht so in den Ohren gelegen sie mitzunehmen. „So ein Mist!“, murmelte sie leise vor sich hin. Sicherlich würde sie jetzt neben dem kurzatmigen Dickwanst sitzen müssen. Ihre Mutter war geradezu versessen darauf die ‚beiden Kinder‘ zusammenzubringen. Der schon fast unverschämte Reichtum der Klienzels übte eine ungeheure Anziehungskraft auf Madame de Slingenard aus. Im Gegenzug fand die dürre Klienzel den Adelstitel der Von-Schlingenhards ziemlich erstrebenswert. Die besten Voraussetzungen also um die beiden Familien ‚durch Amors zarte Bande‘ zu vereinen, wie es Marie-Helenes Mutter so blumig auszudrücken pflegte. Aber das Schicksal in Form von samoanischen Sitten und Gebräuchen meinte es gut mit Marie-Helene. Männer und Frauen pflegten im Versammlungshaus getrennt zu sitzen, zumindest während des offiziellen Teils des Abends. Und so wurde Marie-Helene ein Platz zwischen ihrer Mutter und Frau von Schwenger zugewiesen. Während die Samoaner auf Matten auf dem Boden hockten, hatte man für die Gäste aus Europa als Zugeständnis niedrige hölzerne Schemel zum Sitzen bereit gestellt. Nach und nach füllte sich das Haus. Nur die bedeutendsten samoanischen Männer durften innen Platz nehmen. Die nachgeordneten stellten sich gemeinsam mit Frauen im Freien rund um das Gebäude auf. Da dieses keine Wände hatte, bekamen auch sie mit, was im Haus geschah. An den das Dach tragenden Säulen wurden Fackeln entzündet. Sie tauchten die Anwesenden in ein warmes Licht. Geheimnisvolle Schatten tanzten über den Köpfen der Anwesenden an der hohen Decke aus Palmwedeln. Als sich der Große Matai erhob verstummte das Gemurmel der Gäste. Trotz seines Alters klang seine Stimme klar und fest. Langsam und gemessen, aber ohne jedes Zögern und Stocken reihte er die vokalreichen melodischen Wörter der samoanischen Sprache aneinander. Marie-Helene dachte an die Rede von Kaiser Wilhelm - Möge Gott ihm ein langes Leben schenken! -, die dieser anlässlich seines letzten Hamburgbesuch gehalten hatte. Mit lauter, polternder Stimme, unendlich vielen ‚Ääähs‘ und ‚Ähems‘ hatte er, wild mit seinem gesunden Arm gestikulierend, ein paar pompöse Phrasen aneinander gereiht. Wahrscheinlich hatten die Zuhörer nur deshalb so laut gejubelt und langanhaltenden Beifall gespendet, weil sie Angst hatten, er könnte wieder anfangen. Tulau`enas Großvater brauchte keine lauten Worte und großartige Gesten. In seinem einfachen, bunten lavalava, wie das Hüfttuch der Einheimischen genannt wurde, wirkte er tausendmal majestätischer als der Kaiser - Möge Gott ihm ein langes Leben schenken! - in seinen Orden behangenen Uniformen. Als der Große Matai seine Begrüßung der Samoaner beendet hatte, setzte er sich wieder auf seinen Platz vor dem Mittelpfosten der rechten Schmalseite des Versammlungshauses. Nun erhob sich Tulau`ena, trat ein paar Schritte nach vorn. Marie-Helene hatte ihn in der dunklen Ecke gar nicht bemerkt. Als sie ihn jetzt im Licht der Fackeln stehen sah, wurde ihr wieder bewusst, wie sehr er sich doch von allen anderen Leuten ihrer Bekanntschaft unterschied. Er war nur ein Jahr älter als sie selbst. Und doch wirkte er unglaublich erwachsen und selbstbewusst, als er jetzt die Gäste in akzentfreiem Deutsch begrüßte. Peinlich genau beachtete er den Rang und erwähnte die wichtigsten Personen selbstverständlich zuerst. Madame de Slingenard nahm mit einem huldvollen Kopfnicken zur Kenntnis, dass ihr Mann und sie den Reigen der begrüßten Gäste eröffneten. Vor den Von-Schwengers und den Klienzels! Da er aber seine Worte außergewöhnlich geschickt wählte, fühlte sich keiner der Angesprochenen zurückgesetzt. Die Begrüßung von Roswitha Klienzel begleitete er mit einer leichten Verbeugung und Marianne von Schwenger wurde mit einem charmanten Lächeln willkommen geheißen. ‚Der geborene Diplomat‘, schoss es Marie-Helene durch den Kopf. Sie ließ Tulau`ena keine Sekunde aus den Augen. Keines seiner Worte entging ihr. Dabei interessierte es sie überhaupt nicht was er sagte. Er hätte auch völliges Kauderwelsch sprechen können. Nein! Sie lauschte einfach nur unheimlich gern seiner Stimme. Selbst die harten deutschen Namen klangen aus seinem Mund weich und melodisch. Nach der Begrüßung wechselte Tulau`ena ins Samoanische und sprach ein paar kurze Sätze. Er klatschte in die Hände. Daraufhin trat eine junge Frau mit einer riesigen hölzernen Schale von außen in das Versammlungshaus. Nun begannen auch alle anderen Samoaner in die Hände zu klatschen. Es war ein mitreißender Rhythmus. Marie-Helene juckte es in den Fingern und sie hob die Hände um mitzumachen. Ein schmerzhafter Stoß traf ihre Rippen. Ihre Mutter hatte sich zu dieser unfeinen Methode hinreißen lassen, um ihre Tochter an einem derartig ungebührlichen Verhalten zu hindern. Marie-Helene legte ihre Hände wieder in den Schoß und sah ihre Mutter unschuldig an. Madame de Slingenards Lippen waren zu einem schmalen Strich zusammen gepresst. Zwischen den Augenbrauen standen zwei scharfe Falten. ‚Untersteh dich!‘, lautete die stumme Botschaft des strafenden Blicks, den sie ihrer ungehorsamen Tochter zuwarf. Inzwischen hatte die junge Frau die Schale zum Großen Matai gebracht. „Manuia - Prosit!“, rief er laut, setzte die Schale an die Lippen und nahm einen großen Schluck. Als nächstes war Baron von Schlingenhard an der Reihe. „Manuia“, sagte auch er und trank mit einer Selbstverständlichkeit aus der Schale, als hätte er sein Leben lang nichts anderes getan. Oh, nein! Jetzt würde es sicher an ihrer Mutter sein, aus der Schale zu trinken. Marie-Helene wurde es heiß und kalt bei dem Gedanken. Niemals, das wusste sie, könnte irgendwer oder irgendetwas ihre Mutter dazu bewegen, aus einem Gefäß zu trinken, das eine andere Person schon an den Lippen gehabt hatte. Elisabeth von Schlingenhard würde sich strikt weigern, die Gastgeber tödlich beleidigen und damit ihren Mann bis auf die Knochen blamieren. Aber das Schicksal meinte es gut mit der Baronin. Die Schale wurde nur den männlichen Teilnehmern der Versammlung gereicht. Der Kelch ging im wahrsten Sinne des Wortes an Madame de Slingenard vorüber. Nachdem alle Männer aus der Schale getrunken hatten, wurde sie neben Tulau`enas Großvater auf den Boden gestellt. Damit war der offizielle Teil der Versammlung beendet und das eigentliche Fest konnte beginnen. Die samoanischen Frauen schwärmten von allen Seiten in das Versammlungshaus und servierten das Essen. Sehr zum Entsetzen der Baronin gab es weder Geschirr noch Besteck. Die Gerichte wurden auf zurecht geschnitten Bananenblättern gereicht. Gegessen wurde mit den Händen. „Die erwarten doch wohl nicht im Ernst von mir, dass ich diesen unappetitlichen Fraß zu mir nehme?“, flüsterte die Baronin entsetzt Marianne von Schwenger ins Ohr. „Aber natürlich meine Liebe. Wir alle mussten das lernen. Zugegeben, es sieht ziemlich eklig aus, aber es schmeckt gar nicht so übel“, antwortete die Angesprochene und schob sich ein großes Stück Schweinefleisch in den Mund, wobei das Fett zwischen ihren dicken Fingern herunter tropfte. „Stell dich nur nicht so an, verehrte Elisabeth“, meldete sich nun auch Roswitha Klienzel zu Wort. „Du musst ja nicht viel essen. Nur probieren. Oder willst du deinen Mann vor allen Leuten unmöglich machen? Mein Heinrich sagt immer, man muss den Eingeborenen in Kleinigkeiten entgegenkommen, dann lassen sie sich in großen Dingen leichter lenken.“ Mit diesen Worten angelte sie sich ein winzig kleines Stückchen gebratene Banane von ihrem Bananenblatt herunter. Sie hielt es wie ein lästiges Insekt zwischen ihren dürren Fingern und inspizierte es ganz genau, ehe sie es mit einem entsagungsvollen Blick in den Mund schob. Nun konnte Elisabeth von Schlingenhard natürlich nicht länger hinter ihren Freundinnen zurück stehen. Vorsichtshalber ließ sie sich jedoch nur gebratenes Gemüse und Bananen reichen. Marie-Helene stand neben ihrem Vater und schob sich mit großer Begeisterung Fleischstückchen und alle Arten exotisches Gemüse in den Mund. Es schmeckte herrlich. Und das Essen mit den Fingern machte ihr unendlich viel Spaß. „Schau mal, Kleines! Deine Mutter!“ Friedrich von Schlingenhard stupste seine Tochter mit dem Ellenbogen an und deutete mit dem Kopf in Richtung seiner Frau. Dabei grinste er über beide Wangen. Marie-Helene sah zu ihrer Mutter hinüber, die gerade mit der gequälten Miene einer frühchristlichen Märtyrerin etwas in den Mund schob, und konnte sich das Lachen nicht verkneifen. „Arme Maman! In was ist sie da bloß hinein geraten! Ich fürchte, es wird morgen beim Frühstück wieder sehr ungemütlich werden.“ „Da muss ich mich wohl heute Nacht besonders anstrengen, um ihre Laune wieder zu verbessern“, flüsterte ihr Vater und zwinkerte ihr verschwörerisch zu. Marie-Helene kicherte. In Hamburg wäre es ihm nicht im Traum eingefallen, sich in Gegenwart seiner Tochter so anstößig zu äußern. Sie hatte sich schon immer gut mit ihm verstanden. Aber seit sie hier in Samoa waren, herrschte eine Vertrautheit zwischen ihnen, die es vorher so nicht gegeben hatte. „Friedrich! Hast du einen Augenblick Zeit? Wir müssen dringend reden.“ Heinrich Klienzels Stimme klang eindringlich und sehr ernst. Und mit einem entschuldigenden Seitenblick auf Marie-Helene fügte er hinzu: „Es tut mir leid, kleines Fräulein, aber ich muss deinen Vater für einen Augenblick entführen.“ „Aber natürlich Herr Klienzel. Dafür habe ich vollstes Verständnis“, antwortete Marie-Helene wohlerzogen und knickste höflich. „Um was geht es denn?“ Neugierig sah Friedrich von Schlingenhard den Plantagenbesitzer an. Herr Klienzel legte seinen Arm um die Schultern des Barons und zog ihn beiseite. „Es ist wegen Flügler. Meinem Verwalter. Roswitha macht mir die Hölle heiß.“ Mehr konnte Marie-Helene nicht verstehen. Das Stimmengewirr um sie herum, war einfach zu laut. Mist! Einmal wenn es interessant wurde. Unschlüssig stand sie da und überlegte. Vielleicht konnte sie sich ja unauffällig ein wenig in der Nähe ihres Vaters herumdrücken und ein paar interessante Neuigkeiten aufschnappen. „Möchtest du etwas trinken?“ Auch ohne sich umzudrehen wusste Marie-Helene, wer sie so unvermittelt angesprochen hatte. Tulau`ena trat neben sie und bot ihr eine Kokosnuss an. „Fa`afetai“, bedankte sich Marie-Helene. Sie war sehr stolz auf die paar Brocken Samoanisch, die sie von ihm in den vergangenen Wochen gelernt hatte. Neugierig lugte sie in die Nussschale. „Was ist das?“ „Kokoswasser. Es ist schön frisch.“ Marie-Helene setzte die Kokosnuss an den Mund. „Mmh, das ist gut.“ Genüsslich leckte sie sich die Lippen. „Genauso gut wie das Essen. Das Fleisch ist so herrlich zart und hat einen ganz eigenen feinen Geschmack.“ Tulau`ena lächelte. So gut wie nie ließen sich die Kolonialherren und ihre Damen herab, die samoanische Küche zu loben. Sie schlugen sich zwar bei jedem Fest die Bäuche voll und tranken literweise den vergorenen Palmwein, übertrafen sich aber dennoch gegenseitig mit abfälligen Bemerkungen über ihre Gastgeber. Umso mehr freute er sich über Marie-Helenes Lob. „Wir haben seit gestern Abend gearbeitet. Für so viele Gäste mussten wir einen sehr großen umo bauen.“ „Was ist ein umo?“ „Ein Erdofen.“ Er überlegte kurz und fuhr dann fort: „Möchtest du ihn sehen?“ Marie-Helene sah sich um. Ihr Vater war mit Heinrich Klienzel verschwunden. Madame de Slingenard und ihre Busenfreundinnen waren nicht zu sehen. Keiner der Anwesenden schenkte ihr Beachtung. Sie nickte. Tulau`ena nahm ihr die Kokosnuss und das leere Bananenblatt aus der Hand und gab es einer der Frauen, die für die Bewirtung zuständig waren. Dann ergriff er unauffällig ihre Hand und Marie-Helene folgte ihm durch das Gedränge. Dem Großen Matai entging es nicht, dass die Beiden das Versammlungshaus verließen. Er saß noch immer auf seinem Platz vor dem Mittelpfosten und verfolgte mit versteinertem Gesicht wie sein Enkel, das Papalagi-Mädchen im Schlepptau, nach draußen ging. Das war nicht gut! Das war überhaupt nicht gut! Was dachte sich der Junge nur dabei? Solange das Fest dauerte, hatte er selbst den Vorsitz inne und durfte das Versammlungshaus nicht verlassen. Sein Blick wanderte über die Anwesenden. Plötzlich hellte sich seine Miene auf. Er hob die Hand und winkte seinem Freund. Père Antoine verabschiedete sich erleichtert von Pastor Rieflein. Das Gespräch über die ‚höchst unchristlichen Bräuche der Eingeborenen‘, wie es der strenge, lutherische Geistliche bezeichnete, hatte ihn sehr amüsiert. Aber jetzt war er doch froh, den puritanischen Ergüssen des ernsten Kirchenmannes zu entrinnen. Malietoa Tanumafili flüsterte dem schmächtigen Maristenpater ein paar Sätze ins Ohr. Père Antoine nickte. „Ich pass auf, dass er keine Dummheiten macht.“ Mit dieser ermutigenden Zusicherung verschwand er zwischen den Gästen. Vor dem Versammlungshaus musste er nicht lange suchen. Die Beiden standen am Rand des Vorplatzes neben dem Erdofen. Père Antoine lächelte still vor sich hin, während er zu ihnen hinüber ging. Da hatte sich der Großvater wohl unnötige Sorgen gemacht. Es hätte ihn aber auch sehr gewundert, wenn sein Schützling ‚Dummheiten‘ gemacht hätte. Jean-Pierre, wie er ihn nannte, war ein durch und durch verantwortungsbewusster junger Mann, auf den man sich verlassen konnte. „Guten Abend Jean-Pierre. Möchtest du mir deine hübsche Begleiterin nicht vorstellen?“, fragte er freundlich, als er sich zu den beiden jungen Leuten gesellte. „Guten Abend Père Antoine. Aber gerne.“ Das klang weder unsicher und ertappt noch ärgerlich, sondern einfach nur erfreut. Père Antoine gratuliert sich im Stillen zu seiner Menschenkenntnis. „Baronesse von Schlingenhard. Père Antoine, mein Lehrer“, machte Tulau`ena die Beiden bekannt. Père Antoine schüttelte der jungen Dame die Hand und Marie-Helene machte einen artigen Knicks, wie es sich für eine wohlerzogene Hamburger Adelige gehörte. „Haben euch die tiefsinnigen Gespräche im Versammlungshaus nach draußen getrieben?“, fragte der Pater mit einem schelmischen Augenzwinkern. „Das gnädige Fräulein äußerte sich sehr anerkennend über unser Essen. Da wollte ich ihr den Erdofen zeigen.“ „Ich habe so etwas noch nie gesehen. Es ist wahnsinnig interessant. Ich hätte nie gedacht, dass man auf diese Art kochen kann. Und noch dazu so lecker“, sprudelte es über Marie-Helenes Lippen. Père Antoine schmunzelte, als er ihre Begeisterung sah. „Da kann ich Ihnen nur recht geben, Baronesse.“ „Bitte nennen Sie mich Marie-Helene. Es ist mir peinlich, wenn alte Leute mich Baronesse nennen.“ „Alte Leute?“, lachte Père Antoine und drohte ihr mit dem Zeigefinger. Marie-Helene schoss die Röte ins Gesicht. „Oh bitte entschuldigen Sie. Ich wollte nicht ungezogen sein. So war das nicht gemeint. Dass Sie alt sind. Sie sind gar nicht alt. Sie sind nur, naja, älter als ich. Das wollte ich sagen.“ Es war ihr sehr unangenehm, sich so daneben benommen zu haben. Gott sei Dank hatte ihre Mutter das nicht mitbekommen. Es hätte wieder eine üble Standpauke zur Folge gehabt. „Ich weiß doch, wie du es gemeint hast“, beruhigte sie der Pater. Er mochte das Mädchen auf Anhieb. „Und ich nenne dich gerne Marie-Helene. Das ist ein sehr schöner Name. Du kannst sehr stolz darauf sein. Die Gottesmutter und die heilige Helena sind wahrhaftig zwei wunderbare Namenspatroninnen.“ Marie-Helene war erleichtert. Der kleine Missionar, der kaum so groß war wie sie selbst, war ihr auf der Stelle sympathisch. Er wirkte lieb und freundlich. Kein bisschen wie ein strenger geistlicher Herr. Sie konnte verstehen, dass Tulau’ena gerne zu ihm in die Schule gegangen war. „Ich denke wir sollten jetzt wieder hinein gehen. Vermutlich wirst du schon vermisst.“ Père Antoine wies mit einer auffordernden Geste in Richtung Versammlungshaus. Marie-Helene nickte und ging voraus. „Und was dich betrifft, Jean-Pierre, dein Großvater möchte dich sicher bei den Gesprächen mit seinen Gästen dabei haben“, sagte der Pater zu seinem Schützling, während sie langsam zurück gingen. Die Unterhaltung war selbstverständlich auf Französisch geführt worden und Marie-Helene war sehr stolz darauf, dass ihr bei der Wortwahl und im Satzbau keine groben Fehler unterlaufen waren. Gleichzeitig war ihre Bewunderung für Tulau`ena wieder ein Stück gewachsen. Sein Französisch war noch eine Spur fließender und geläufiger als ihr eigenes. Und er wechselte mit einer Gewandtheit zwischen seiner Muttersprache, Deutsch und Französisch hin und her, dass es eine wahre Freude war. Père Antoine hatte richtig vermutet. Man hatte Marie-Helene in der Tat bereits vermisst! Madame de Slingenard, Marianne von Schwenger, Roswitha Klienzel und ihr dicker Sprössling Franz-Ferdinand hatten sich zwischen den mächtigen Holzpfosten des Eingangs aufgebaut. „Wo bist du gewesen?“ Die Stimme der Freiin klang schrill. Sie hatte die Lorgnette gehoben und betrachtete ihre Tochter wie ein lästiges Insekt. Marie-Helene wurde es abwechselnd heiß und kalt. Sie wusste nicht was sie sagen sollte. Wenn ihre Mutter diesen Ton anschlug, war nicht mit ihr zu spaßen. Das würde ganz übel enden! „Sie war mit dem Wilden unterwegs. Ganz allein! Ich habe genau gesehen, dass sie mit ihm hinausgegangen ist.“ Franz-Ferdinands Stimme klang triumphierend. Er deutete mit seinem dicken Zeigefinger anklagend auf Tulau`ena, der schräg hinter Marie-Helene stand. Nun würde das hochnäsige Fräulein Baronesse ihre Strafe bekommen. Das hatte sie nun davon! Auf dringenden Wunsch seiner Mutter hatte Franz-Ferdinand in den vergangenen Wochen schon ein paarmal versucht mit ihr ins Gespräch zu kommen. Und jedesmal hatte sie ihn abblitzen lassen. Auch heute abend! War stattdessen mit diesem arroganten Schönling losgezogen. Ihm konnte man nichts vormachen. Enkel des Großen Matai! Lächerlich! Auch wenn dieser Kerl heute ein Hemd und eine Hose anhatte, so war er doch nichts anderes als ein frisch vom Baum gestiegener Affe. „Stimmt das?“ Das Entsetzen ob der Ungeheuerlichkeit dieser Tat schwang deutlich in der Frage der Baronin mit. „Aber ja. Jean-Pierre war so freundlich die Baronesse zu mir zu bringen. Ich wollte sie unbedingt kennenlernen. Auf der Insel ist die Tochter des Direktors der Deutschen Handels- und Plantagengesellschaft in aller Munde.“ Père Antoine, der bisher hinter Marie-Helene gestanden hatte, trat nun nach vorn und stellte sich zwischen sie und die erboste Baronin. Madame de Slingenard ließ die Lorgnette sinken und starrte den Maristenpater entgeistert an. Er war so klein und schmächtig, dass sie ihn hinter ihrer Tochter überhaupt nicht gesehen hatte. „Kennen wir uns?“, fragte die Baronin. „Leider hatte ich noch nicht das Vergnügen. Erlauben Sie mir, mich vorzustellen. Ich bin Père Antoine, Leiter der katholischen Missionsstation auf Savai`i. Und Sie, gnädige Frau, sind wie ich vermute Madame de Slingenard, die bezaubernde Gattin unseres allseits wertgeschätzten Barons.“ Mit einer Eleganz, die man dem kleinen Pater in seiner viel zu weiten Kutte gar nicht zugetraut hätte, ergriff er die Hand der Baronin und hauchte mit einem „Enchanté, Madame“ einen vollendeten Handkuss darauf. Die französische Anrede, in Verbindung mit dem Kompliment, zeigten augenblicklich Wirkung. „Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite“, meinte Baronin Elisabeth huldvoll. Und mit einem bösen Seitenblick auf den Klienzel'schen Abkömmling fügte sie hinzu: „Ganz offensichtlich war der junge Mann hier etwas übereifrig bei seinen Beobachtungen.“ Mit Genugtuung registrierte die Baronin den zusammengekniffenen Mund von Roswitha Klienzel. Es schadete der reichen Plantagenbesitzerin gar nichts, wenn sie einen kleinen Dämpfer bekam. Sie bildete sich sowieso viel zu viel auf ihren dicken, verwöhnten Sprössling ein. „Liebe Baronin, darf ich Ihnen übrigens zu Ihrer reizenden Tochter herzlich gratulieren. Das Französisch der jungen Dame ist ganz exquisit.“ Damit hatte Père Antoine endgültig gewonnen. Das Donnerwetter, das sich über Marie-Helenes Haupt zusammengebraut hatte, war abgewendet. Madame de Slingenard schenkte ihrer Tochter ein anerkennendes Lächeln und meinte: „In der Tat. Sie verbessert sich täglich. Ohne prahlen zu wollen, kann ich mit Fug und Recht behaupten, es gibt in ganz Hamburg zwei allerhöchstens drei junge Damen, die Marie-Helene im Französischen das Wasser reichen können.“ „Madame, darf ich Sie um die Gunst bitten, mich zu Ihrem Gatten zu begleiten. Ich hatte heute Abend noch keine Gelegenheit, den verehrten Herrn Direktor zu begrüßen. Möchte ich es doch nicht versäumen, ihm meine Hochachtung für seine charmante Ehefrau und sein reizendes Töchterlein auszusprechen.“ Père Antoine verneigte sich leicht und reichte ihr seinen Arm. Ohne sich weiter um ihre beiden Freundinnen, ihre Tochter und den Klienzel-Erben zu kümmern, verschwand Baronin Elisabeth im Innern des Versammlungshauses. Marie-Helene hatte während der gesamten Unterhaltung keinen Ton hervorgebracht. Ihre Verblüffung darüber, wie ungeniert der französische Pater ihre Mutter angeschwindelt hatte, war einfach zu groß. Dass er sie damit aus einer ziemlich üblen Klemme befreit hatte, war ihr durchaus bewusst. „Baronesse, darf ich mich von Ihnen verabschieden? Die Pflicht ruft. Mein Großvater hat nach mir geschickt.“ Tulau`ena legte seine rechte Hand auf die Brust und verbeugte sich vor ihr. Marie-Helene runzelte über diese Förmlichkeit irritiert die Stirn, ehe sie sich daran erinnerte, dass sie noch immer genauestens beobachtet wurden. Unter den strengen Blicken der beiden Matronen deutete sie formvollendet einen kleinen Knicks an. Nicht zu tief, um ihm ihren höheren Stand spüren zu lassen. Und nicht zu wenig, um der grundlegenden Höflichkeit Genüge zu tun. „Es war sehr freundlich von Ihnen, mich Ihrem Lehrer vorzustellen“, sagte Marie-Helene mit einem kleinen Lächeln. Tulau`ena ging ins Versammlungshaus hinein. Natürlich nicht ohne sich vorher mit einem höflichen „Meine Damen“ von Roswitha Klienzel und Marianne von Schwenger zu verabschieden. Dass er Franz-Ferdinand dabei geflissentlich ignorierte, brachte ihm einen bösen Blick des jungen Plantagenerben ein. „Komm, Roswitha, nach soviel französisch-schmalziger Schmeichelei brauche ich dringend etwas bodenständig Deutsches. Suchen wir unsere Männer und tun unser Bestes, um sie vom übermäßigen Trinken abzuhalten.“ Marianne von Schwenger hakte sich bei ihrer Freundin ein und zog sie mit in das Innere des Versammlungshauses. Franz-Ferdinand stand unschlüssig herum und ließ den Kopf hängen. Er fühlte sich nicht sehr wohl in seiner Haut. Dabei war er so sicher gewesen, einen Treffer zu landen, als er seiner Mutter von Marie-Helenes Verschwinden mit dem hochnäsigen Enkel des Großen Matai erzählt hatte. Und dann war er so richtig ins Fettnäpfchen getreten. Was musste sich auch dieser komische linksrheinische Katholiken-Missionar einmischen? ‚Wie ein vergessener Nüsse-und-Apfelsack am Nikolaustag‘, ging es Marie-Helene durch den Kopf, als sie den niedergeschlagenen Erben betrachtete, der wie ein Häuflein Elend vor dem Versammlungshaus stand. Obwohl sie ihn nicht ausstehen konnte, tat er ihr leid. Einer plötzlichen Eingebung folgend trat sie neben ihn. „Lass uns hinein gehen und noch etwas trinken. Ich habe furchtbaren Durst.“ Sie lächelte ihn aufmunternd an. Ein Strahlen erhellte seine trübselige Miene. Galant reichte er ihr seinen Arm. Marie-Helene hängte sich bei ihm ein und betrat an seiner Seite wieder das Versammlungshaus. So schlug sie wenigstens zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie konnte ihrer Mutter und der dürren Klienzel eine Freude machen. Und an Franz-Ferdinands Seite konnte sie ganz unauffällig zwischen den Herren stehen und deren Gespräche belauschen. Vielleicht gab es ja das eine oder andere Interessante aufzuschnappen. „Hast du gesehen, wie gut sich unsere Marie-Helene mit dem jungen Klienzel unterhalten hat?“ Elisabeth von Schlingenhard saß an ihrem Toilettentischchen, kämmte sich die Haare und beobachtete ihren Mann im Spiegel. Der Baron knöpfte gerade sein Hemd auf. „Ich finde sie passen hervorragend zusammen. Du nicht auch?“, fuhr sie fort und drehte sich dabei zu ihrem Gatten um. „Ich bin nicht sicher, was ich von ihm halten soll. Er kommt mir ein bisschen minderbemittelt vor.“ Als er ihren irritierten Blick sah, fügte er schnell hinzu: „Geistig meine ich, natürlich. Unsere Tochter ist ihm doch meilenweit überlegen.“ „Papperlapapp! Er ist eine hervorragende Partie. Keine Geschwister und Erbe eines beinahe schon unanständigen Vermögens. Da ist es doch einerlei, wenn er ein bisschen dümmlich ist. Außerdem schadet es nichts, dass Marie-Helene ihm überlegen ist. Dann kann sie ihn leichter lenken.“ „Wenn du meinst“, brummte der Baron. Er war teuflisch müde und freute sich auf sein Bett. Über die Heiratspläne seiner Frau konnte er auch morgen noch nachdenken.