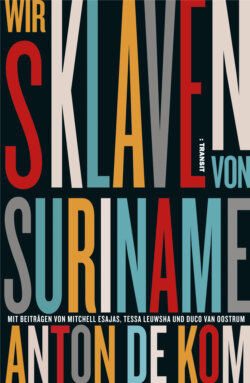Читать книгу Wir Sklaven von Suriname - Anton de Kom - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DIE HERREN
Оглавление»… dass es eine Sklavenklasse geben muss, die an die schwerste und mörderischste Arbeit gebunden ist und nur eine animalische Natur besitzt, und auf der anderen Seite eine höhere kultivierte Klasse, die somit über Mittel und Zeit verfügt, um den Verstand zu entwickeln und ihre Talente zu vervollkommnen, mit denen sie zugleich die Sklaven beherrscht.«24
Das jedenfalls war die Theorie, von der ein höherer Fiskalbeamter seiner Familie in Holland berichtete, und wer könnte dies besser beurteilen als ein Diener der Kolonialjustiz! Erhärten wir diese Theorie also wieder mit Fakten. Beginnen wir mit einer Schilderung des Lebens der weißen Herren auf ihren Plantagen.
Der Herr stand morgens zeitig auf, begab sich zu dem Platz vor dem Haus oder in den Lustgarten, zündete sich eine echte holländische Pfeife mit würzigem Varinas an und ließ sich danach von einer seiner Sklavinnen ehrerbietig eine köstliche Tasse Kaffee kredenzen.
Während dieser durch und durch vornehme weiße Herr dann in aller Ruhe die kühle und erfrischende Morgenluft genoss, erschien der weiße Aufseher, um nach den gebotenen Verbeugungen und Höflichkeiten (ein bedeutsamer Teil seiner Tätigkeit) Bericht über den vergangenen Tag zu erstatten und Anweisungen für den neuen Arbeitstag entgegenzunehmen. Ausführlich teilte er mit, welche Arbeiten von den Sklaven und Sklavinnen verrichtet wurden, ob Neger die Plantage verlassen haben, wer krank oder gestorben ist, oder ob sich Geburten unter dem Sklavenvolk ereignet haben (eine willkommene Vermehrung des Viehbestands).
Danach erhielt der Morgen ein strengeres Antlitz, und es folgte eine Aufzählung der Sklaven und Sklavinnen, die nach Ansicht des Aufsehers am vergangenen Tag ihre Aufgaben nicht gebührend erfüllt, sondern sich eine kleine Pause gegönnt oder auf andere Weise gesündigt hatten.
Der Aufseher trat als Ankläger auf, der Herr als Richter, und ein Sklave, der eigens hierfür ausgebildet wurde, sorgte für die unverzügliche Vollstreckung.25 Fielen die Schläge aus Versehen allzu hart aus, so dass der Arbeitswert des Sklaven für den Tag gefährdet sein könnte, war glücklicherweise auch der Drisieman zugegen, ebenfalls ein Sklave, der, natürlich ohne jegliche Vorbildung, für das Wohl der Sklaven zu sorgen hatte.
Auch der Drisieman erstattete Bericht und durfte zufrieden sein, wenn er mit einer groben holländischen Verwünschung davonkam, sollte der Zustand nur halbwegs ungünstig erscheinen. Häufig erwartete aber auch ihn die Peitsche, wenn nach Ansicht des Herrn zu viele Sklaven Krankheiten vorschützten, um sich vor der Arbeit zu drücken. Denn nicht zur Heilung war der Drisieman angestellt, sondern um zu entscheiden, wer ohne Lebensgefahr (denn das würde Einbuße bedeuten) vom Krankenlager aufgescheucht werden und sich an die Arbeit machen konnte.
Schließlich erschien »die Mama«, eine alte Sklavin, die die Negerkinder auf der Plantage beaufsichtigte, denn die Holländer waren äußerst modern und setzten schon in jenen Tagen auf Kinderkrippen, damit die Mütter in Ruhe arbeiten konnten. So gesehen könnte man behaupten, dass die Sklaverei eine Wegbereiterin für die Emanzipation der Negerfrauen war!
Bitterer Spott beiseite. Die Mama erschien und mit ihr die gesamte Herde Negerkinder (denn in den Augen des Herrn waren sie nichts weiter als eine Herde Zuchtvieh, die später von ihm als Sklaven eingesetzt werden würden). Die Kinder wurden alle zuvor gebadet und genossen das Privileg, im Beisein ihres Förderers mit etwas Reis und Bananen gefüttert zu werden. Nach den unerlässlichen gestenreichen Dankesbekundungen durften sie sich entfernen, allein die Mama blieb zurück. Und wehe ihr, sie meldete dem Herrn den Tod eines Sklavenkinds. In den meisten Fällen musste sie dann Abschied von der Welt nehmen, denn fürchterlich war die Wut des Herrn, falls er durch den Tod eines jungen Sklaven Verlust an Besitz erleiden musste.
Wenn nun diese beschwerlichen Pflichten hinter ihm lagen, unternahm der Herr seinen Morgenspaziergang oder lieber noch, denn die Tropensonne brannte bereits stark, bestieg er sein Pferd.
Bekleidet war er mit einer feinen Leinenhose, Seidenstrümpfen, roten oder gelben Schuhen, Seidenhemd und einem breitkrempigen Kastorhut. Ein Sklave begleitete ihn mit einem großen Sonnenschirm, um ihn gegen die gleißende Sonne zu schützen.
So durchquerte er ruhigen Schrittes die üppigen Felder, auf denen die Pflanzen scheinbar umso besser gediehen, je mehr sie mit Negerblut gedüngt wurden, und währenddessen spähte er um sich, dass ja kein unvorsichtiger Sklave sich einen Augenblick von der Arbeit ausruhte oder es wagte, den Blick vom Boden zu nehmen.
Nach diesem morgendlichen Sport frühstückte der Gentleman und kleidete sich, wie es sich damals geziemte, um. Dieses Mal putzte er sich als Salonlöwe oder Lackaffe heraus.
Wollte der Plantagenbesitzer seine Freunde oder Nachbarn besuchen, begab er sich zu seinem mit vergoldeten Ornamenten verzierten Ruderboot, das reichlich mit Obst, Wein, Jenever und Tabak bestückt war, und ließ sich, bequem zurückgelehnt, von einigen strammen Sklaven zu seinem Bestimmungsort rudern. Hatte der Meister keine Lust auszugehen, frühstückte er etwas später und verwendete darauf auch mehr Zeit. Sein Frühstück bestand nicht wie bei den Negerkindern aus Reis und Bananen, nein, feinster Schinken, Pökelfleisch, gebratene Hühner oder Tauben, Bananen, Honigmelone, Brot, Sahne, Butter und Käse kamen auf den Tisch, dazu wurde Starkbier oder französischer Wein ausgeschenkt.
Anschließend machte der Plantagenbesitzer einen Mittagsschlaf, um sich nach dieser Ruhepause wieder an den Tisch zu setzen, der bereits mit den besten Gerichten eingedeckt war, die damals zu bekommen waren.
Am Abend wurde Rum und Punsch getrunken, Varinastabak geraucht und Glücksspiele veranstaltet. Diese geistige Schwerstarbeit wurde oft bis tief in die Nacht fortgesetzt.
In Europa lernt man auf den höheren Schulen, dass die Tempel in Griechenland von Sklaven erbaut wurden, dass diese erstaunliche Kultur mit ihren erhabenen Schöpfungen der Philosophie und Dichtkunst, mit ihren herrlichen Malereien und Skulpturen und ihren Spielen, Musik und Tanz nur deswegen bestehen konnte, weil ein Heer von Sklaven den Herrschern die Gelegenheit gab, sich in Freiheit zu kultivieren.
Wir überlassen es den Gelehrten zu entscheiden, inwieweit dies stimmt und ob es nicht vielmehr der Import der ersten Sklaven nach Griechenland (was doch schon eine gewisse Macht und Wohlstand vermuten lässt) gewesen ist, der den Anfang des Untergangs einer Kultur einleitete, deren hohe Prinzipien sich nicht mit dem Unrecht der Sklaverei vereinbaren ließen.
Wir wollen auch nicht die Frage aufwerfen, ob diese Haussklaverei in größerem Maße mit den Prinzipien der Menschlichkeit einhergegangen ist als die surinamische Sklaverei – ähnlich der Behandlung, die ein geliebtes Pferd von seinem Gebieter erfährt im Vergleich zu der eines Droschkenpferdes in einem Fuhrbetrieb.
Aber wir haben sehr wohl das Recht, euch Holländer zu fragen, dass, wenn die Sklaverei das Fundament einer Kultur ist, welche Tempel ihr in Suriname errichtet, welche Gedichte ihr geschrieben und welch erhabene Gedanken ihr der Nachwelt hinterlassen habt? Ist es nicht so, dass ihr betreten dastehen würdet, wenn ihr auch nur ein Denkmal für einen Holländer in Suriname errichten solltet, der durch seine Geistestaten gerühmt werden könnte?
Ihr könnt nur das Bildnis einiger Kriegsherren in Bronze gießen, die mit ihren modernen Waffen die Dörfer der Marrons (der Aufständischen) vernichtet haben – einen Vaillant, einen Mayland, Creutz und Nepveu. Doch selbst dann müsst ihr bekennen, dass eure fähigsten Gouverneure und die Krieger, die euch verteidigt haben, jedes Mal aufs Neue aus Europa importiert werden mussten, weil die besitzende Klasse in Suriname durch Pomp und Völlerei zu schnell degeneriert ist, um selbst fähige Kräfte hervorzubringen. Nein, wenn ihr in Suriname ein Denkmal errichten möchtet, dann für die Köche, die unter Gouverneur de Spörche oder unter Crommelin die köstlichsten Speisen bereitet haben, für die diese Epoche berühmt ist, oder für die Stellmacher, die die prächtigen Kutschen bauten, in denen die europäischen Damen durch die Straßen Paramaribos fuhren.
Und dennoch, wenn irgendwo das ökonomische Fundament zum Aufbau einer Kultur vorhanden gewesen ist, dann war es in Suriname.
Es kam nicht selten vor, dass im Palast eines Herrn dreißig bis fünfzig Sklaven als seine persönlichen Bediensteten gearbeitet haben.
Ende des 18. Jahrhunderts wurde es in zunehmendem Maße üblich, dass die Plantagenbesitzer die Verwaltung ihrer sogenannten »Effekte« weißen Verwaltern überließen, die dafür ein Jahreseinkommen von 70 000 bis 80 000 Gulden bezogen. In manchen Fällen kamen noch 40 000 bis 50 000 Gulden für die Wahrnehmung der Kontakte mit den Behörden hinzu.
Suriname erwirtschaftete damals in nur wenigen Jahren 300 Millionen Gulden allein mit Zucker, Kaffee und Baumwolle. Die Frachtkosten auf holländischen Schiffen, die in Suriname immer stattliche Ladungen vorfanden, betrugen ungefähr eine Million Gulden. Allein 1787 wurden in Suriname 25 000 Tonnen Zucker, 15 Millionen Pfund Kaffee, drei Millionen Pfund Baumwolle, eine Million Pfund Kakao, 250 000 Kilo Tabak und so weiter produziert.26
Sklaven wurden in jenen Tagen unter der Hand verkauft und bis zum Äußersten geschunden. Selten aber sah man einmal ein Buch in der Hand eines Weißen. Die Gründung eines Schauspielhauses im Jahr 1775 (das sich übrigens nicht lange hielt) wurde als ein Akt von höchster Kultiviertheit angesehen. Und ein holländischer Schriftsteller, kein Geringerer als Gouverneur Mauricius, bescheinigte seinen Landsleuten schmeichelnd, »dass grobe Schweinereien unter den Europäern nicht zu leugnen waren« und dass viele weiße Einwohner »keine andere Beschäftigung hatten als schlafen, saufen, spielen und Böses tun«.27
Der Brite J.G. Stedman, der einige Jahre in Suriname verbracht hat, schrieb sogar: »Zerstreuungen und Zügellosigkeit scheinen den weißen Einwohnern dieses Landes so eigen, dass jährlich eine große Anzahl als Schlachtopfer ihres selbstzerstörerischen Lebenswandels fallen. An Männern, die sich ganz der Unmäßigkeit und den Verlockungen der Sinnlichkeit überlassen, sind deren verderbliche Folgen nur allzu sichtbar: im größten Maße entkräftet und wie ausgetrocknet schleichen sie einher.«28
Bezeichnend ist, was Wolbers in seiner Geschiedenis van Suriname schreibt: »Der Leser verzeihe uns, von den Einzelheiten der ›Abgründe des Schmutzes‹, wie Mauricius schreibt, zu berichten. Für den Chronisten ist es eine traurige Angelegenheit, andauernd von den Sünden und Mängeln des Volks zu berichten, dessen Geschichte er skizzieren möchte, doch er darf sich davon nicht abhalten lassen, wahrheitsgetreu zu sein, wie sehnlich er auch wünscht, dass es ihm vergönnt wäre, von größeren und edleren Taten zu berichten.«29
Den Höhepunkt ihrer Kultiviertheit erreichte die weiße Bevölkerung bei ihren Festen.
Die Genrebilder von Frans Hals dokumentieren auch heute noch die ausgelassenen Ausschweifungen dieser fast zur Kunst erhobenen Gelage.
Nur in einer Hinsicht konnten sich die Festbankette, die im Gouvernementspalast von Paramaribo gegeben wurden, mit ihren vaterländischen Vorbildern nicht messen: Den aschfahlen Gesichtern der surinamischen Sklavenhalter fehlte die wohlgenährte Röte der holländischen Regenten.
Überfluss und Luxus waren übrigens um so viel provokanter und größer, wie Suriname größer ist als Holland.
Eine Reihe von Sklaven als Diener,
goldenes Geschirr,
funkelnde Juwelen,
seidene Gewänder.
Als versuche man, die Furcht vor den Unterdrückten, die im Herzen aller lebte, in einem Taumel aus Sinnesfreuden zu vergessen, als hoffte man, den Sklaven im Speisesaal und der schweigenden schwarzen Masse hinter den Fenstern mit diesem Schauspiel der Verschwendung und Unbeschwertheit zu imponieren.
Und, spät in der Tropennacht, steigen zischend Feuerpfeile empor, als wollte man den restlichen Überfluss und Luxus, den man hier auf Erden nicht schnell genug verprassen konnte, in die Höhe jagen, zu den Sternen.