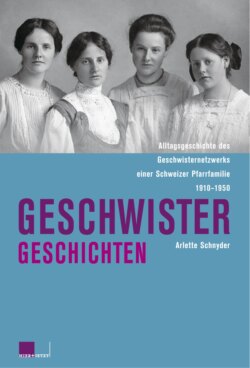Читать книгу Geschwistergeschichten - Arlette Schnyder - Страница 13
TABELLARISCHE DARSTELLUNG DER WOHNORTE UND LEBENSDATEN DER GESCHWISTER SCHNYDER
ОглавлениеAlle Wege führen über Zofingen und Bischofszell, dichtere Vernetzungen finden sich auch in Basel, Bern und Zürich. In allen Lebensläufen taucht ein Aufenthalt in der französischen Schweiz auf, bei einigen gibt es auch Auslandaufenthalte. Während einige Biografien fast parallele Lebenswege aufzeigen (Martha und Rosa sowie erste Stationen im Leben von Karl und Walter), finden sich vor allem in den Lebenswegen von Hedwig, Sophie und Karl Stationen, die sich mit keinem der Geschwister kreuzen.
Die oben stehende Karte visualisiert Knotenpunkte und wichtige Verbindungsstrecken und kennzeichnet die Orte, die abgelegen von den familiären «Ballungszentren» liegen.
Die Hauptverbindungen zwischen den Geschwistern entsprechen den Hauptlinien des schweizerischen Eisenbahnnetzes. Bern, Basel, Zürich und Zofingen liegen dabei im Zentrum. Die Städte des Mittellandes wiesen eine hohe Erreichbarkeit aus, umliegende Gemeinden wie Horgen waren, gerade im Raum Zürich, komfortabel erschlossen.34 Auch Bischofszell war durchaus erreichbar, wurde doch die Lokalbahn Sulgen–Bischofszell–Gossau bereits 1876 eröffnet. Allerdings wurden erst 1910 bessere Anschlüsse an grössere Streckennetze durch den Bau der Bodensee-Toggenburg-Bahn (BTB) von Romanshorn über St. Gallen nach Wattwil und die Mittelthurgau-Bahn (MTB, 1910) von Wil über Weinfelden nach Konstanz eröffnet.35 Nebenlinien wie die Toggenburg-Bahn büssten neben den hoch frequentierten Hauptlinien an Bedeutung ein.
Abgelegen für die Geschwister war der im Graubünden liegende Ort Küblis, an welchem ausser Karl keines je wohnte. Trotz dem stark ausgebauten Eisenbahnnetz kann noch 1880 keineswegs von einer Massenmobilität gesprochen werden. Man zählte in diesem Jahr gerade mal 25 Millionen Bahnfahrgäste, das entsprach neun Fahrten pro Einwohner.36 «Bis 1910 schnellte die Zahl der Reisenden auf 240 Millionen oder 65 Fahrten pro Kopf hoch.»37
Interessant ist, dass mit der verstärkten Mobilität auch der schriftliche Informationsaustausch dichter wurde. So beförderte die Schweizer Post 1850 noch 16 Millionen Briefe oder im Mittel sieben Schreiben pro Einwohner, während es 1910 schon 290 Millionen Sendungen waren oder 78 Briefe pro Kopf.38 Der Brief wurde zu einem Kommunikationsmittel, das dank Taxverbilligungen und pünktlichen Versandzeiten dem Mitteilungsbedürfnis einer grösseren Bevölkerungsschicht entgegenkam.39 Allerdings beschränkte sich dieses Kommunikationsbedürfnis vor allem auf den urbanen Raum. «Allein in der Stadt Zürich gingen 1910 mit über 52 Millionen Briefen mehr Sendungen ab als in den Kantonen St. Gallen, Thurgau und Schaffhausen zusammen. Nach wie vor war der Brief ein vorab urbanes Massenkommunikationsmittel, das in den breiten und insbesondere ländlichen Bevölkerungsschichten selten Verwendung fand.»40 Sowohl die bessere Erreichbarkeit durch ein dichtes Eisenbahnnetz als auch das starke Wachstum des Briefverkehrs sind Voraussetzungen für das Funktionieren des Geschwisternetzwerks. Moderne Transportmittel beeinflussten die Beziehungen der Geschwister nachhaltig. Abgelegene Orte konnten mit Briefen erreicht werden, wodurch sich die Distanz verringerte.