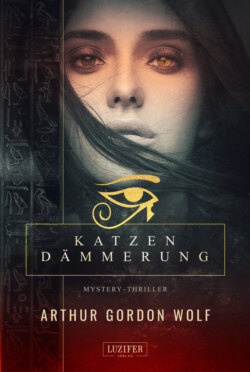Читать книгу KATZENDÄMMERUNG - Arthur Gordon Wolf - Страница 22
1. Kapitel »Tascha«
Yucca Springs, 1990
ОглавлениеWieder sitze ich hier über meinen Schreibtisch gebeugt, mitten in der Nacht, mit brennenden Augen und doch wach und schreibe. Wie lange ist es wohl her, als ich zum letzten Mal dieser Beschäftigung nachging? Tage? Wochen? Monate? – Jahre? Es wird wohl letzteres sein – mir verschwimmen teilweise die zeitlichen Dimensionen – aber dennoch sehe ich die zurückliegenden Geschehnisse klar und deutlich vor mir, so, als habe sich alles erst gestern ereignet.
Mein Gedächtnis hat so präzise wie eine Kamera gearbeitet, jede Stunde, jede Minute scheint farbgetreu und gestochen scharf aufgenommen und gespeichert worden zu sein, wie ein Dokumentarfilm in Realzeit. Und doch reicht es nicht aus. Das Wissen, welches sich in mir angesammelt hat, droht meine Gehirnwindungen zu sprengen. Es ist zu viel für einen einzigen Menschen. Wenn ich dem ungehörigen Druck nicht nachgebe, werde ich zerplatzen wie eine überreife Melone. Ich werde verrückt werden oder ganz einfach nur sterben. Vielleicht ist es bereits schon zu spät; vielleicht habe ich schon zu lange gewartet. Kann es sein, dass mich der Wahnsinn bereits in seinen Fängen hält? Aber natürlich doch; der wirklich existierende Wahnsinn zeichnet sich schließlich dadurch aus, dass man ihn nicht bemerkt.
Wie dem auch sei. Ob ich nun verrückt oder nur sehr verwirrt bin, ich werde versuchen, die Dinge so wiederzugeben, wie sie mein inneres Auge fotografiert hat. Was immer geschehen wird, es kann nur positiv für mein Seelenheil sein. Vielleicht ist das Schreiben dabei mehr, als eine bloße Therapie; vielleicht gelingt es mir, indem ich die unfassbaren Erlebnisse ordne und in Worte kleide, so etwas wie einen Sinn, eine innere Logik, daraus zu filtern. Ein optimistisches Ziel. Noch bevor ich überhaupt damit beginne, befallen mich bereits ernste Zweifel. Einen Sinn, eine Logik? Ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen. Wie sollte das, was ich erlebt habe, mit Begriffen wie ›Sinn‹ und ›Logik‹ in Einklang gebracht werden können? Es sind irdische, menschliche Kategorien, was auch sonst. Das, was ich erlebt habe (oder glaube, erlebt zu haben) – nein!!! – was ich tatsächlich erlebt habe, hat aber nur einen sehr schwachen Bezug zu derartigen Philosophien oder wissenschaftlichen Modellen. Es entzieht sich allen geltenden Gesetzen und Regeln.
Es ist eine andere, nicht menschliche Wirklichkeit. Eine eigene Welt, die über allen Dingen existiert. Oder treffender formuliert: Eine düstere Welt, die sich bis in die tiefsten Abgründe der Hölle erstreckt.
Welche Ironie, aber ich schreibe in das gleiche Notizbuch, in welchem sich schon meine liebestrunkenen Gedanken über meine erste Zeit mit Natascha befinden. Welcher Kontrast zwischen dem ›Damals‹ und dem ›Heute‹. Eigentlich hätte ich ein neues Buch nehmen müssen, denn dies hier ist eine völlig andere Geschichte. Aber vielleicht auch wieder nicht; vielleicht ist das, was sich nach jenen glücklichen Monaten ereignete, nur eine logische (nein, ich muss mich daran gewöhnen, andere Begrifflichkeiten zu suchen) – nur eine unausweichliche, schicksalhafte Entwicklung, eine Verkettung. Das eine kann ohne das andere nicht existieren. Ja, wenn es so etwas wie ein unentrinnbares, vorgezeichnetes Schicksal gibt, eine Art Karma, dann bestehen zwischen dem ›Damals‹ und dem ›Heute‹ deutlich erkennbare Verbindungspunkte.
Ich habe gerade – nicht ohne Schmerz und Wehmut – nochmals meine alten Aufzeichnungen gelesen. Wer war nur jener Mann, der diese Zeilen niedergeschrieben hat? Es fällt mir schwer, mich selbst in diesen Worten wiederzuerkennen. Manche Gefühle sind mir heute so fremd, so unverständlich. Und doch; irgendwo schimmert in mir die Erkenntnis, dass tatsächlich ich es war, der so empfunden hat.
Besonders eine Passage rief verdrängte Erinnerungen in mir wach. Über einer eng beschriebenen Seite fand ich ein Gedicht von François Villon:
Tod, deine Strenge will mir ans Herz:
Meine Geliebte, sie lebte noch eben,
Doch du willst dir nicht Ruhe geben,
Gierst auch nach mir in meinem Schmerz.
Treffender ließ sich meine damalige Gemütsverfassung wohl nicht beschreiben. Ich muss mich wieder an die Tiefe meiner Liebe Natascha gegenüber besinnen – gerade während meiner nun geplanten Fortsetzung der Geschichte. Ich darf es nie vergessen. Nur so erblicke ich einen roten Faden. Nur so begreife ich vielleicht, wie und warum ich derart gehandelt habe. Warum ich einfach so handeln musste.
Trotz aller zeitlichen Bezüge habe ich zwischen der alten Geschichte und diesem neuen Ansatz vier Seiten leer gelassen. Ich konnte einfach nicht direkt dort wieder ansetzen, wo ich einst für immer (wie ich glaubte) einen Endpunkt gesetzt hatte. Die Zeit ist weitergeschritten. Die Geschichte ist eine andere. Ich bin ein anderer.
Wo soll ich nur beginnen? Ich suche einen genauen Zeitpunkt, doch gibt es ihn überhaupt? Das Problem besteht darin, dass sich sehr selten etwas von heute auf morgen verändert. Natürlich gibt es Ausnahmen – in Verbindung mit Natascha und mir sogar recht viele, gute wie schlechte, aber für gewöhnlich geschehen Veränderungen nicht einfach, sie schleichen sich an. Ausdauernd und geduldig warten sie auf ihre große Stunde, wie gierige Geier über einem zum Tode verurteilten Tier. Selbstverständlich gibt es gewisse Anzeichen, jedes Erdbeben kündigt sich durch kleinere Vorbeben an, aber in jenen Tagen war ich sicherlich nicht in der Verfassung, diese Fingerzeige des Schicksals richtig zu deuten. Es vergingen fast sechs Monate, bis ich schließlich mit einem Vorfall konfrontiert wurde, der die bis dahin bestehende Idylle als Trugbild entlarvte. Ich glaube, der letztendliche Auslöser für meine Tat, war dieser verdammte Wind.
Gegen Mitte August litt die ganze Stadt unter einer erbarmungslosen trockenen Hitze. Eigentlich hatte man sich in Yucca Springs an das Wüstenklima gewöhnt – wer genug Geld hatte, sah zu, dass er während des Sommers nach Norden an die Küste zog – und doch schien dieses Jahr heißer als all die Jahre zuvor zu sein. »Wieder einer von diesen Höllensommern«, sagten die Einheimischen. Alle hundert Jahre oder so, schien der Teufel seine ›Heizung‹ auf Hochtouren laufen zu lassen, und diesmal sah es so aus, als habe der Gehörnte gleich hundert neue Brenner unter der Stadt montiert. Täglich las man von Menschen, die an einem Hitzschlag gestorben waren. Der Bedarf nach Erfrischung war so groß, dass die Besitzer von Swimmingpools Nachtwachen einlegen mussten, um unliebsamen Besuch zu vertreiben. Ich lebte in einem wahren Brutkessel.
Was diesen Sommer aber wirklich zur Qual werden ließ, war der ständig wehende Wind. Dieser unaufhörliche Luftstrom, der wie ein unsichtbares Feuer in jede Behausung drang, machte die Menschen matt und lethargisch. Sie stumpften ab; Kopfschmerz marterte sie, manche Leute schrien andere plötzlich ohne Grund an oder wurden gar handgreiflich. Die Zahl der Verkehrsunfälle stieg in der zweiten Hälfte des Monats um satte 80 % an. Die Rate der Einbrüche und Diebstähle mit Körperverletzung kletterte sogar um 130 %. Die Stadt war nahe daran, einem Kollaps zu erliegen.
Ich erwähne diese Tatsachen nicht zu meiner Rechtfertigung, nicht ausschließlich jedenfalls, ich will damit nur andeuten, wie gespannt die allgemeine Lage war. Niemand reagierte mehr beherrscht.
Ich saß an diesem Tag – wie jetzt – grübelnd an meinem Schreibtisch und starrte auf die gegenüberliegende Straßenseite. Das Fenster war leicht geöffnet, beißendes Feuer zerrte an meinen schweißverklebten Haaren.
Die Luft machte das Denken beinahe unmöglich. Hielt man das Fenster geöffnet, wurde man wie in einem Heißluftgrill gebacken (30 Minuten bei 220°C auf der mittleren Schiene), schloss man es, so glaubte man, nach fünf Minuten ersticken zu müssen. Die altersschwache Klimaanlage, die Natascha von ihrem Vormieter übernommen hatte, verbreitete weitaus mehr Lärm als kühlende Erfrischung.
Anfangs hatten die hohen Räume der Hitze noch widerstanden, doch jetzt boten sie nur noch wenig Linderung. Innerlich verfluchte ich den Wind. Der heiße Santa-Ana, der sich wie Lava über die San Bernadino-, San Gabriel- und San Jacinto-Berge in die Täler ergoss, hatte auf seinem langen Weg zur Stadt keine Gewässer überquert, kein Meer, keine Seen, nicht einmal größere Flüsse. Im Nordwesten, dem Ort seiner Herkunft, gab es nur kahle Steppen und Wüste. Die einzigen Dinge, an denen er sich auf seiner Reise entlang der Westseite der Sierra Nevada hatte reiben können, waren Felsen, Geröll, staubiges Büffelgras und Kakteen gewesen – und natürlich Sand. Düster sah ich zu, wie sich die Scheiben der Autos langsam mit seinem feinen, schmirgelndem Atem überzogen.
Meine Augen verloren sich in trostlosem Graubraun. Die ganze Stadt schien von einem übereifrigen aber farbenblinden Anstreicher in ein gleichmäßiges Schlammbad getaucht worden zu sein. Nichts war ihm entgangen, selbst die weitgefächerten Blätter der Palmen am unteren Ende der Straße wirkten seltsam matt und anämisch. Die zehrende Hitze hatte sie in traurige, kraftlose Staubwedel verwandelt.
Ich fragte mich, ob es wirklich nur dieser verdammte ›Teufelswind‹ war, der mich bedrückte. Oder gab es da etwas anderes? Etwas tatsächlich Beunruhigendes? Mein Blick wanderte über das Vordach die Straßenzeile entlang. Die Luft zitterte über dem Asphalt wie wässriges Gelee. Keine Menschenseele war zu entdecken. Selbst die stets herumschwärmenden Mücken hatten es vorgezogen, ihre ausgelassenen Tänze in die kühleren Abendstunden zu verlegen. Nicht zum ersten Mal drängte sich mir der Eindruck auf, ich befände mich in einer verlassenen Geisterstadt.
Taschas Wohnsitz lag ohnehin nicht in einer ›Upper-Class-Gegend‹ – ganz im Gegenteil; während der letzten Monate hatte sich das Viertel mehr und mehr in ein abbruchreifes Ghetto verwandelt. Auf der gegenüberliegenden Häuserfront gab es jeden Tag mehr Fenster, die mit dicken Brettern vernagelt wurden. Das Gold – oder was immer die früheren Bewohner hierhin gelockt hatte – war offenbar verschwunden. Also verschwanden auch die Menschen. Weiter oben, nahe der Kreuzung View Drive /Thessalia Street hatten die emsigen Abbruchfirmen bereits zwei dunkle Löcher in die Häuserreihe gerissen. Das Viertel grinste mich seitdem mit einem hämischen, kariösen Gebiss an. Es hatte ganz den Anschein, als eroberte die Wüste das mühsam von ihr errungene Gebiet nach und nach wieder zurück. An den Rändern der weitläufigen Stadt vollzog sich dieser Kampf dagegen eher schleichend; niemand machte sich hier die Mühe, ein Gebäude abzureißen. In dünner besiedelten Gebieten wie etwa im Norden nahe des Zoos wuchs die Zahl der ›toten Häuser‹ (so nannten sie die Einheimischen) stetig an. Für mich war es eher ein dünner Ring aus Geisterhäusern, der die Stadt immer fester umschloss.
Meine zunehmend düstere Stimmung wurde zu einem Spiegelbild meiner Umgebung. Oder war es umgekehrt?
Trotz allem war ich nie auf den Gedanken gekommen, die Wohnung aufzugeben. Die Miete war trotz der riesigen Fläche recht erschwinglich, und wo sonst hätte ich die vielen Skulpturen, Reliefs und Papyrus-Schriften Nataschas lagern sollen? In den drei Zimmern meines alten Appartements wäre gerade Platz für einen winzigen Bruchteil der Sammlung gewesen. Ein Auszug wäre mir zudem wie ein Verrat erschienen; schließlich hatte ich in diesen Wänden die glücklichsten Stunden meines Lebens verbracht.
Und warum überhaupt fliehen? Vor wem? Vor was? Ich lebte hier schließlich nicht wie ein zurückgezogener Eremit, wie viele meiner Freunde und Berufskollegen glaubten. Oh, nein. Ich war nicht allein. Meine Geliebte hatte ihr Wort gehalten und war zu mir zurückgekehrt; wenn auch in einem anderen Körper. Niemand würde dieses Wunder begreifen können, und so hatte ich auch wohlweislich jeden Versuch einer Erklärung unterlassen. Sollten die Leute doch über mich denken, was sie wollten, mir war es einerlei. Ich war glücklich, denn es gab jemanden, der mich stets sehnsuchtsvoll zu Hause erwartete: Tascha.
So war es jedenfalls die erste Zeit über gewesen, die ersten Wochen, die ersten Monate. Wie verrückt hatte ich meiner wundervollen Tascha den kleinsten Wunsch von ihren Lippen – nein, eher von ihrer zarten Schnauze – abgelesen. Die feinsten Leckereien hatte ich der Katze zubereitet, sie gestreichelt und liebkost. Wenn Taschas rosa Zunge dann zärtlich über mein Gesicht fuhr, war dies Belohnung genug für mich.
Ihre äußere Hülle mochte noch so verschieden, so anders sein, Tascha war immer noch meine hingebungsvolle, wilde, hemmungslose Geliebte. Ich fühlte mich anfangs nie abnorm oder pervers, weil ich nackt mit einer Katze im Bett lag. Ich wusste halt, dass dieses dunkle, seidige Fell eine menschliche, wenn nicht gar göttliche Seele beherbergte. Bei jedem Blick in die Augen des Tieres überrollte mich der Geist Nataschas wie eine elektrisierende Woge.
»Ja, ich bin es«, schien sie zu sagen. »Die Tatzen des Ligers haben meine Haut zerfetzt, mein Blut vergossen, aber sie konnten mich nicht töten. Ich lebe weiter. Nur für dich. Für unsere Liebe.« Nicht selten vernahm ich dabei Nataschas leises Lachen in meinem Rücken. Überallhin schien es mich zu begleiten. Ich hörte es auch dann, wenn ich für einige Tage bei Kunden an der Ostküste weilte und ich die Katze, nein Tascha, gut versorgt, aber sich selbst überlassen, viele tausend Meilen entfernt wusste; allein inmitten uralter, aus Lehm gebrannter oder auf Papyrus verewigter Erinnerungen.
Sie fühlte sich wohl, wenn sie unbehelligt durch die Korridore und Zimmer streifen konnte, stets die eindrucksvollen Relikte ihrer Urahnen vor Augen. Mit einem kehligen Miauen, fast einem lustvollen Jauchzen, sprang Tascha dann von Regal zu Regal, lief Zickzack um steinerne Ebenbilder ihrer selbst und thronte anschließend erschöpft, aber immer noch würdevoll auf einem der am Boden aufgeschichteten Türme dicker Folianten. Trotz ihrer ungestümen Toberei gelang es ihr auf eine beinahe schon wundersame Weise, nie auch nur eine der Skulpturen, Reliefs oder Bücher zu beschädigen. Es war, als besäße sie die Fähigkeit, ihr Gewicht in nichts aufzulösen. Bereits wenige Zentimeter Freiraum genügten ihr als Lande- oder Absprungstelle. Zwar gerieten zuweilen einige der Gegenstände ins Schwanken, aber nie verloren sie ihr Gleichgewicht. Es hatte auf mich oft den Eindruck, als ahnten die stummen Katzen, dass ihr kurzes, von Tascha eingehauchtes Leben, auf dem harten Boden unter ihnen zu Ende sein würde, und während sie die sanften Schwingungen auskosteten, bemühten sie sich mit aller Kraft, ihren angestammten Platz nicht zu verlassen.
Tascha zeigte sich nie ungehalten darüber, wenn ich gelegentlich über das Wochenende oder auch länger für eine meiner Foto-Sessions wegblieb; schließlich hatte ich das schon immer getan. Und auch jetzt legte sie keinen gesteigerten Wert darauf, mich auf meinen Reisen zu begleiten. Nichts – fast nichts – hatte sich verändert. Tascha war immer noch ein selbständiges, eigenwilliges und freiheitsliebendes Wesen; in ihrem neuen Körper mehr denn je.
Ich lernte schnell, ihre Gebärden zu verstehen, dabei half mir auch das leise Lachen in meinem Kopf, welches sich – je nach Situation – in ein belehrendes, resignierendes oder warnendes Stöhnen oder Knurren verwandeln konnte. Nachdem ich einige Male erfolglos, das Stöhnen in meinem Kopf missachtend, versucht hatte, Tascha auf einen Geschäftstrip mitzunehmen und dabei recht schmerzhafte Krallenspuren davongetragen hatte, wurde ich feinfühliger und vorsichtiger. Schließlich erfüllte es mich mit einer warmen Freude, wenn ich sah, wie unverändert wild und feurig meine Geliebte war.
Gelegentliche Trennungen erfrischen eine Beziehung, heißt es, machen wieder neugierig aufeinander, beleben die Partner mit neuer Lust. Dies war bei Tascha und mir nicht anders, und doch … etwas war anders als zuvor. Ich schob Gedanken dieser Art Wochen, ja Monate vor mir her. Ich umhüllte mich mit jener neuen, magischen Atmosphäre wie mit einem dichten, undurchdringlichen Mantel und gab einfach vor, nicht mehr an ›die Zeit davor‹ zu denken. Vor allem Vergleiche mit dem ›davor‹ und ›danach‹ wies ich weit von mir. Die Zeit als solche war einfach nicht mehr existent. Was hatte Zeit auch schon für eine Bedeutung, wenn es so etwas wie den Tod nicht mehr gab? Manchmal, vor allem zu Anfang, ging meine Taktik auf. Ich stellte mir dann lediglich vor, schon immer so gelebt zu haben, umgeben von Kameras, Positivabzügen, Terrakotta-Katzen … und Tascha.
Doch die Zeit war mein Feind; ausdauernd, zäh und unnachgiebig höhlte sie mein mühsam errichtetes Wunschbild von Tascha und mir aus, ließ es mehr und mehr verblassen, bis es schließlich wie ein von Kinderhand errichtetes Kartenhaus zusammenbrach.
Natürlich wehrte ich mich gegen derartige Momente der Schwäche; ertappte ich mich bei einem dieser plötzlich aufflackernden, dunklen Gedanken, so tat ich alles, um meine Geliebte noch zuvorkommender, noch zärtlicher zu verwöhnen. Ich schalt mich einen Narren oder auch einen Verräter, aber gleichzeitig war mir mit bestürzender Klarheit gewiss, wie nahe der Zeitpunkt lag, an dem mir eine Abkehr von Tascha kein schlechtes Gewissen mehr bereiten würde.
Es lag halt daran, dass ich ein Mann war … und Tascha eben keine Frau, eher nur ein weibliches Wesen. Wenn ich an unsere gemeinsam verbrachten Nächte oder auch Tage zurückdachte – und diesmal konnte und wollte ich die Erinnerungen nicht verdrängen – , so war es eben zu einem großen Teil Taschas animalische Körperlichkeit gewesen, die mich gefesselt hatte, ihre ungezügelte, tabulose Lust, die mich in einen ekstatischen Rausch versetzt hatte. Ein Rausch, aus dem ich nie hatte erwachen wollen – und der so grausam geendet hatte.
Manchmal brach ich meine Überlegungen an diesem Punkt abrupt ab und versuchte mich – mehr oder weniger erfolgreich – mit meiner Arbeit abzulenken. An anderen Tagen trieb ich meine Selbstgeißelung allerdings weiter; dann war es mir, als könne ich ihre vor Erregung schweißfeuchte, warme, seidene Haut direkt auf meiner eigenen spüren. Den Druck ihrer schweren, festen Brüste, das Kitzeln ihrer tiefschwarzen Haare, den Geschmack ihrer Lippen und das feurigheiße ›Streicheln‹ ihrer Krallen auf meinem Rücken. So sehr ich es auch verneinen mochte, genau das war es, was mir seit Taschas ›Verwandlung‹ vor allem fehlte.
Ich war nie ein ›Kostverächter‹ gewesen (auch wenn die Zahl meiner Verflossenen nicht annähernd halb so groß war, wie es mir meine Freunde oft andichteten), gelegentlich war es mit einem meiner Modelle zu einer kurzen, heftigen Beziehung gekommen; ein Spaß auf Gegenseitigkeit ohne jede Verpflichtung, nicht mehr, nicht weniger.
Erst Tascha hatte in mir eine Begierde geweckt, deren Ausmaß jedes normale menschliche Empfinden zu sprengen schien. Ich war abhängig geworden von ihr, süchtig nach ihrer Berührung, schlimmer als jeder willenlose Junkie auf ›H-Trip‹.
Und so war es nur natürlich, dass mich ihr Sex-Entzug körperlich und seelisch bis aufs Äußerste marterte. Was sollte ich auch tun? Für das, was mir fehlte, gab es keine Ersatzdroge, kein Metadon, für mich hieß die einzige Lösung: Ich brauchte eine Frau. Eine andere Frau.
Und da begann das Problem; einerseits widerstrebte es mir, Tascha zu betrügen, andererseits sehnte ich mich mit wachsendem Hunger nach der Umarmung eines schlanken, weiblichen, menschlichen Körpers. Etwas, was mir meine schwarzschimmernde Geliebte nicht (mehr) bieten konnte.
Das fortdauernde Grübeln schlug sich zwangsläufig auf mein Gemüt nieder. Ich wurde ruhiger, melancholischer, depressiver; eine Tatsache, die auch Tascha nicht entging. Ich konnte nicht sagen, ob sie den wahren Grund für meine Verdrossenheit erahnte, jedenfalls tauchte sie aber gerade immer dann wie aus dem Nichts auf, wenn ich besonders hart mit mir und meinem Schicksal haderte. Noch bevor ich sie überhaupt richtig wahrgenommen hatte, war sie auf meinen Schoß gesprungen, kuschelte sich wohlig schnurrend gegen meinen Bauch und liebkoste mit ihrer Schnauze oder kleinen Zunge zärtlich meine Wange. Es war mir, als wollte sie sagen: »Schau, ist das etwa nichts? Verlangst du noch mehr? Reicht es dir denn nicht, dass ich noch immer an deiner Seite bin; trotz allem?«
Wenn ich diese Geisterstimme vernahm, (oder hörte ich sie wirklich?) spürte ich mehr und mehr, wie Wut und Verzweiflung in mir hochstiegen. »Jaaaa! Du hast verdammt recht!«, wollte ich dann Tascha entgegenschleudern. »Ich brauche mehr als dein ewiges Geschmuse. Ich treib's nicht mit Tieren, und wenn du zehnmal 'ne verfluchte Wiedergeburt oder so was bist!«
Natürlich sprach ich diese Worte niemals laut aus. Aber ich dachte sie und lastete damit in meinen Augen genügend Schuld auf mich.
An jenem Spätnachmittag, als ich meine Unzufriedenheit mit Alkohol zu mildern versuchte und mir damit einen noch schlechteren Dienst erwies, bröckelte ein erster Stein aus meiner bislang so tadellosen Fassade. Als sich Tascha gerade wieder einmal auf meinem Schoß zusammenrollen wollte, fegte ich die überraschte Katze mit einer derart heftigen Armbewegung vom Stuhl, dass sie beinahe gegen die angrenzende Wand geprallt wäre.
»Scher' dich weg, blödes Vieh!«, hörte ich mich voller Entsetzen brüllen. Für einen kurzen Moment war ich nicht mehr Herr meiner Sinne gewesen, und es hatte gereicht, mein ›wahres Ich‹ zum Vorschein zu bringen.
Tascha federte den Flug schräg auf drei Beinen ab und blieb dann regungslos stehen. Jedes andere Tier hätte angesichts einer solchen Attacke erst einmal das Weite gesucht, nicht so Tascha. Stumm und unbeweglich verharrte sie auf der Stelle, den Kopf leicht zur Seite geneigt, die Augen starr auf mich gerichtet. Obwohl ich sofort versuchte, meine unbedachte Tat zu entschuldigen, sie mit Kosenamen und Leckereien lockte, blieb sie, wo sie war und starrte mich unentwegt an. In ihrem Blick las ich eine Mischung aus Trauer, Bitterkeit, Mitleid und Empörung.
Gratuliere, schienen ihre Augen zu sagen, du hast ja lange durchgehalten, bevor du meiner überdrüssig wurdest. Tolle Leistung! Nicht einmal sechs Monate. Du jämmerlicher Versager!
Ich hatte keinen anderen Ausweg gesehen, als immer wieder ein klägliches »Bitte, verzeih' mir!« von mir zu geben. »Ich habe nicht gewusst, was ich tat. Bitte, glaube mir.«
Zu meiner größten Bestürzung musste ich feststellen, dass meinen Worten die nötige Überzeugungskraft fehlte, denn selbst jetzt noch gab es einen Teil in mir, der diese Tat voll und ganz billigte. Und Tascha schien dies zu spüren. Langsam, ohne eine Spur von Flucht, durchschritt sie den Raum, sprang auf den Fenstersims und von dort auf das Vordach. Sie verschwand so lautlos, als habe sie sich vom Rand des Daches in die Lüfte geschwungen.
Drei Tage lang blieb sie verschwunden, dann saß sie plötzlich wieder in meinem Arbeitszimmer, stolz und unnahbar. Fast so, wie bei unserer ersten Begegnung. Auch wenn in ihrem Blick weder Tadel noch Verärgerung mitschwangen, so hielt sie doch einen deutlichen Sicherheitsabstand zu mir. Erst nach über einer Woche gestattete sie mir erstmals wieder, sie zu streicheln. Und doch war nichts mehr so wie vor ihrem Verschwinden.
Ich hatte meine Maske fallen lassen, und das vergaß Tascha nicht. Unsere Beziehung war um etwas ärmer geworden; sie hatte ihre Reinheit verloren und war dadurch beinahe schon alltäglich geworden. Ein geschmackloser, grotesker Scherz des Schicksals, wie ich fand.
Da ich nicht genau wusste, ob Tascha nicht vielleicht doch meine Gedanken lesen konnte, wählte ich nun stille Cafes und schmierige Kneipen, um dort ungestört meine düsteren Fantasien ausbrüten zu können. Ich glaube, dies war der Moment, an dem die Wahrheit endlich ans Licht kam. Kein Selbstbetrug mehr und keine falsche Höflichkeit. Von da an spürte ich in meinem Inneren, wie aussichtslos meine neue Beziehung zu Tascha war. Wie naiv, wie unmöglich. Ob ich es wollte oder nicht, ich wusste einfach, dass nichts mehr so werden konnte, wie vor ihrem ›Tod‹.
Es würde kein gutes Ende mit uns nehmen, dessen war ich mir nun sicher.
Die Kneipen und Bars wurden zu meinem zweiten Zuhause. Oft saß ich einfach nur in einer dunklen Ecke und starrte auf die nichtssagende, zerkratzte, mit kreisrunden Flecken beschmierte Platte eines Tisches. Das vor mir stehende Bier, welches lediglich meine Anwesenheit rechtfertigte, wurde nicht selten schal. Manchmal allerdings hielt ich es auch für sinnvoll, mich mit Lager und härteren Sachen vollzuschütten.
Doch weder im nüchternen, noch im volltrunkenen Zustand kam ich der Lösung meines Problems auch nur einen Schritt näher. Nur für kurze Augenblicke, dann nämlich, wenn der Alkohol meinen Verstand noch nicht völlig umnebelt hatte, gab es für mich Lichtblicke der Selbsterkenntnis und der Weisheit.
Was bin ich, was ist der Mensch nur für ein undankbares Geschöpf, sagte ich mir dann. Selbst wenn er überirdisches Glück erfahren durfte, verlangt er gierig nach mehr. Gelingt es ihm aber nicht, sich zu bescheiden und Schicksalsschläge zu akzeptieren, dann ist er nichts weiter als eine wilde, unmoralische Bestie. Nichts als ein charakterloses, aufrecht gehendes Geschöpf, für das Begriffe wie ›Liebe‹ und ›Ehre‹ nur leere Worthülsen sind.
War ich tatsächlich schon soweit gesunken?
Wehmütig rief ich mir Passagen aus meinem Tagebuch in Erinnerung. Waren der damalige liebestrunkene, junge Mann und meine jetzige blasse und gierzerfressene Gestalt überhaupt noch ein und dieselbe Person? Ich schwor mir tausend heilige Eide, alles zu tun, um diesen klaffenden Spalt in meinem Inneren wieder zu schließen.
Dann jedoch, wenn das Gin-Bier-Whisky-Gemisch in meinem Körper eine bestimmte Schwelle überschritten hatte, vergaß ich plötzlich alle ehrenwerten Vorsätze. Ich warf sie derart unbekümmert über Bord, als habe nicht ich sie gefasst, sondern ein anderer, mir völlig Unbekannter, offensichtlich Wahnsinniger. Mit jedem weiteren Glas ertränkte ich meine restlichen moralischen Skrupel und mein Selbstmitleid übernahm die Oberhand.
Ich wehklagte über die Ungerechtigkeit des Lebens; ich war lediglich das schuldlose Opfer widriger Umstände. Ein Spielball der Götter. Sollte ich etwa wegen einer dahergelaufenen Katze mit einer ägyptischen Seele den Rest meines Lebens als Eunuch verbringen? Nie und nimmer!
Nach diesem stets gleich verlaufenden Disput fühlte ich, wie neue Energie durch mich hindurchströmte. Ich richtete mich kerzengerade auf, straffte meine Rückenmuskeln, strich mir einige widerspenstige Strähnen aus der Stirn und ließ meinen Blick ruhig durch den Raum wandern.
Ich hielt Ausschau nach zarten Rundungen, nach verheißungsvollen Lippen und rätselhaften Augen. Ich suchte nach einer geeigneten Frau, mit der ich die Nacht verbringen wollte.
Ich erinnere mich an eine Nacht, in der ich in einer schäbigen Kneipe irgendwo im Osten der Stadt versumpft war. Es handelte sich um eine jener zwielichtigen Spelunken, in denen der Tabakqualm ständig so dicht hing, dass man sich beim Bezahlen die Geldscheine direkt vor die Nase halten musste, um nicht versehentlich ein viel zu hohes Trinkgeld springen zu lassen. Mir gefiel der Laden, dessen Namen ich sofort nach dem Betreten wieder vergessen hatte. Nirgendwo konnte man besser untertauchen. Mich störte die schlechte Luft nicht, und an das Gegröle der Zechbrüder hatte ich mich während meiner nächtlichen Wanderungen von einer Bar zur nächsten längst gewöhnt. Es war ähnlich wie beim Fotografieren: Wenn ich wollte, konnte ich Menschen und Geräusche einfach ausblenden.
Ich zwängte mich durch einen schmalen Gang, der links neben der langen Theke und an den Barhockern vorbeiführte. Der Zwischenraum war so eng, dass an keiner Stelle zwei Männer nebeneinander gehen konnten. Weiter hinten entdeckte ich durch die Rauchschwaden hindurch die Schemen weiterer Gäste, die sich in einem angrenzenden, offenbar größeren Raum lautstark anfeuerten.
Da jeder der Plätze an der Theke besetzt war und selbst zwischen den Stühlen breitschultrige Kerle lehnten – alles Typen, die ich nicht unbedingt gerne zum Barbecue eingeladen hätte –, kämpfte ich mich notgedrungen zum oberen Ende an eine freie Stelle durch. Genau vor mir thronte das silbern glänzende Ungetüm einer uralten Registrierkasse. Dahinter lugten mich die Schweinsäuglein eines knapp sechzehnjährigen Mädchens an. Ihr strähniges, fettiges Haar war nachlässig in der Mitte gescheitelt und zu zwei unförmigen Zöpfen geknotet worden. Ich fand, dass die Zöpfe gut zum übrigen Erscheinungsbild passten. Das Gesicht war aufgeschwemmt und mit Pickeln übersät. Als sie mich als neuen Kunden abfällig mit einem Hochziehen der rechten Oberlippe taxierte, entblößte sie eine Reihe von gelblich-braunen Zahnruinen.
Gut, dass es hier nichts zu essen gibt, dachte ich. Bei einer solchen Köchin hätte ich lieber eigenhändig Schaben gefangen und geröstet. Da wusste man wenigstens, was man aß.
Da mich das Mädchen immer noch stumm mit hochgezogener Lippe anglotzte, machte ich den Anfang. »Ich hätte gern ein Bier«, sagte ich. Das fette Pickelgesicht zeigte kaum eine Regung; nur die Lippe zog sich noch weiter nach oben. Ein atemberaubender Anblick, dachte ich.
»Getränke macht Luke«, sagte sie gelangweilt. »Ich mach' nur die Kasse.«
Ich musste mich wohl oder übel zu ihr vorbeugen, um den Hinterkopf eines schmächtigen, großen Mannes hinter der Theke ausfindig zu machen.
»Es ist ein bisschen zu voll da vorne, um mir ein Bier zu bestellen«, kommentierte ich die Lage. »Passt nicht mal ein Aal dazwischen.«
Die zukünftige ›Miss Pickel 1994‹ blieb wie angewurzelt vor ihrer Kasse stehen; wenigstens tat sie mir den Gefallen, den Mund wieder zu schließen. Ihre Lippen beschrieben nun einen erstaunlich weit geschwungenen, nach unten offenen Halbkreis. Sie sah aus, als habe ich ihr für die nächsten 10 Jahre ihre Pommes Frites gestrichen.
»Heeeeeeh, Luuuuuuuuuuke!«, kreischte sie, ohne auch nur den Kopf um einen Zentimeter in die Richtung des Angesprochenen zu wenden. »Mach mal ein Helles für den hier!«
›Den hier‹ betonte sie ungefähr so freundlich wie ein Mitglied des Klu-Klux-Klans den Namen ›Nigger‹; aber ich war mittlerweile auch das gewohnt. Grinsend wartete ich auf mein Bier.
Im düsteren Durchgang zwischen den beiden Räumen gab es eine Nische, in der wie zufällig ein kleiner runder Tisch und zwei wacklige Stühle standen. Nachdem ich endlich ein Glas mit einem undefinierbar gelben, schäumenden Inhalt erhalten hatte, zog ich mich unauffällig in jenen versteckten Winkel zurück.
Der Platz war für meine Zwecke wie geschaffen. Wenn ich mich leicht über den Tisch beugte, konnte ich sowohl den stickigen Thekenschlauch links, als auch den größeren Spielraum rechts beobachten. Gerade drang von dort wieder ein mehrstimmiges Gejohle an mein Ohr. Der überwiegende Teil der Nachtschwärmer hatte sich um einen in der Mitte befindlichen Billardtisch herum versammelt. Die Gruppe stand teilweise so dicht gedrängt, dass ich meist keinen der Spieler, sondern nur ab und an das hintere Ende eines Queues ausmachen konnte.
An den Seitenwänden waren ein halbes Dutzend der gerade aktuellen Computer-Spielautomaten aufgereiht; nur eines der Geräte war jedoch besetzt. Ein junges Pärchen – offensichtlich Billardmuffel – entlockten einem mit ›Star Trek‹-Symbolen bemalten Kasten elektronisch verzerrte Donnergeräusche, die sich aber kaum gegen die ständige Brandung des Stimmengewirrs behaupten konnten.
Kraftlos ließ ich mich auf meinem Stuhl zurückfallen und verschmolz mit der Schwärze meiner privaten Höhle. Ohne Durst zu verspüren, tastete meine Hand nach dem Glas. Ich war überrascht. Angesichts des vor Dreck starrenden Schuppens schmeckte das Zeug erstaunlich gut. Mein Entschluss war damit gefasst: In dieser Nacht würde ich wieder einmal dem Alkohol das Kommando über meinen Körper überlassen.
Jemand stieß achtlos gegen den Tisch und unterbrach meine dösende Flucht aus dem Hier und Jetzt. Verärgert beugte ich mich vor; ich konnte gerade noch sehen, wie ein breites, in fadenscheinige Cord-Hosen gezwängtes Gesäß in Richtung Billard-Zimmer schwankte. Der Zipfel eines grauen, gerippten Unterhemdes zwängte sich zwischen enormen Fleischwülsten und dem tief einschneidenden Gürtel der Hose hervor. Ein alles andere als ästhetischer Anblick. »Scheißkerl«, murmelte ich vor mich hin. Bei dem herrschenden Geräuschpegel der Kneipe hätte der Betreffende meinen Fluch allerdings auch dann nicht gehört, wenn er neben meinem Tisch stehengeblieben wäre.
Mit einem tiefen Stöhnen ließ ich mich auf meinem Stuhl zurückfallen und schloss die Augen. Es half nichts. Mein Bewusstsein war wieder da und zwang mich zu denken. Aber ich wollte nicht denken. Nur nicht nachdenken! Wenn man dieses Spielchen zu lange trieb, wurde man reif für die Klapsmühle. Und der Grad meines momentanen Wahnsinns reichte mir völlig.
Hilflos griff ich zu meinem (ersten?), (zweiten?) Glas und leerte den Rest in einem Zug. Doch auch jetzt noch waren sie da und lauerten auf meine Seele, die Erinnerungen. Diese verfluchten, quälenden Erinnerungen.
Ich dachte wieder zurück an die ersten Tage nach ihrer Verwandlung. Es war eine Zeit der Verblendung, des Irrsinns und der Zärtlichkeit gewesen. Ich sah sie vor mir, Natascha, jetzt eine Katze, wie Lust, Verlangen und Wildheit in ihren Augen schimmerte. Und ich sah die Bilder. Natürlich. Hunderte von Bildern.
Wie in einem Rausch hatte ich nur noch ein Motiv für meine Fotografien gekannt: Natascha. Es war verrückt und irgendwie makaber; mit ihrem wundervollen menschlichen Körper hatte ich sie nicht ein einziges Mal abgelichtet. Nicht ein EINZIGES Mal! Nun aber, da dieser Körper gestorben und begraben war, schoss ich ein Katzenfoto nach dem anderen.
Ich fühlte mich dabei schuldig und schlecht, wie ein Sohn, der für seine Mutter ein Leben lang kein Wort des Dankes oder der Liebe hatte, ihr Grab aber mit einem Meer aus Blumen überschüttete. Es war so falsch. Und doch kannte ich keine bessere Therapie, um das Grauen zu verdrängen. Ich hatte sogar eine Ausstellung mit ausgewählten Arbeiten gemacht. Natascha als einziges Modell einer ganzen Vernissage. Ich musste auch jetzt noch den Kopf schütteln. Endlich hatte meine Geliebte den Platz, der ihrer Ausstrahlung und ihrem Wesen zukam, der ihre Schönheit regelrecht forderte, aber weder ›Cosmopolitan‹ noch ›Harper's‹ würden je ein Cover mit ihr drucken.
Finster starrte ich auf den Grund meines leeren Glases. Das Schicksal hatte sich für mich einen noch weitaus ironischeren und hämischeren Schlussakkord zurückbehalten. Die Ausstellung ›BLACK CAT‹ wurde ein voller Erfolg, fast schon eine Sensation. Erstmals fand sich mein Name auch im Feuilleton-Teil überregionaler Zeitungen und Magazine wieder. Meine völlig unorthodoxe Art und Weise, wie ich mich einem eigentlich vertrauten ›Gegenstand‹ genähert hatte, verhalf mir zu ungeahnten Verkäufen. Ich konnte für einige Bilder Preise verlangen, die mich ins Mittelfeld der internationalen Elite katapultierten. Allein schon von den Einnahmen für Abdruckrechte hätte ich mir für mindestens sechs Monate eine Villa auf den Bermudas mieten können. Aber ich verreiste nicht. Wohin auch? Es gab Dinge, denen man nicht entfliehen konnte. Nataschas Tod würde mich in all meinen Träumen heimsuchen, einerlei in welch entlegenem Winkel der Welt ich mich auch immer verkriechen mochte. Wie ein endloses Videoband spulte sich die grausige Szene immer und immer wieder vor meinen Augen ab – und es gab keine Löschtaste.
Das erinnerte mich wieder an den Zweck meines Besuches in dieser heruntergekommenen Spelunke.
»Es gibt eine Löschtaste.« Ich lächelte, ohne die Lippen zu verziehen. Wenn auch nur für kurze Zeit.
Ich ging zur Theke und hob mein Glas über die Köpfe der anderen Gäste. Als Luke das Zeichen verstand, nickte er mir kurz zu, nahm ein bereits abgezapftes Bier vom Tablett und schob es Richtung Kasse. Es zog dabei eine feuchte Spur wie eine Schnecke. Ich gab dem Mädchen das abgezählte Geld und tauschte die Gläser aus. Am liebsten hätte ich mir gleich drei Bier auf einmal bestellt, nur, um nicht immer wieder dieses fette, tumbe Gesicht sehen zu müssen. Aber warum sollte ich mich aufregen? Gab es überhaupt etwas, das es wert war, sich darüber den Kopf zu zerbrechen?
Ja, dachte ich, aber dieses ›Etwas‹ hatte ganz und gar nichts mit einem spätpubertierenden Teenager zu tun.
Kaum wieder in der Nische angekommen, setzte ich das Glas an meine Lippen. Schaum benetzte meine Nasenspitze und tropfte von dort kitzelnd über mein Kinn. Ich strich es nicht weg. Ich musste trinken. Ich versuchte nicht, die Flüssigkeit in mich aufzunehmen, sondern selbst von ihr verschluckt zu werden. Ich wollte in ihr ertrinken.
Ich befand mich in einem schwach beleuchteten Raum. Die Vorhänge waren zugezogen, und die einzige Lichtquelle, eine Nachttischlampe, wurde durch ein schwarzes Seidentuch gedämpft. Ich lag auf dem Bett, nackt wie es schien. Nur eine Kamera um den Hals geschlungen. Kühl und schwer lastete sie auf meiner Brust. Ich richtete mich auf den Ellenbogen auf und beobachtete den schmalen, gleißenden Spalt einer nur leicht angelehnten Tür. Das Warten machte mich nervös. Die fast völlig verschatteten Stühle vor dem Bett, die niedrige Kommode, der Tisch am Fenster, all das machte auf mich einen befremdenden Eindruck. Aber gleichzeitig waren mir diese Dinge auch wieder vertraut. Ein unangenehmes Gefühl beschlich mich. Wo war ich hier? Auf wen oder was wartete ich?
Plötzlich wurde mir bewusst, wie ausgeliefert und hilflos ich in meiner Nacktheit war. Mein Blick blieb starr auf den Lichtstreifen gerichtet. Hinter dieser Tür konnte sich alles verbergen. Alles. Das höchste irdische Glück genauso wie das entsetzlichste Grauen.
Ich fragte mich, ob ich noch länger warten sollte, ob ich nicht ein zu großes Risiko einging, wenn ich einfach nur darauf hoffte, dass ›Rot‹ und nicht ›Schwarz‹ kam. Der Einsatz in diesem Spiel war mein Leben. Und wenn ›Schwarz‹ kam … Mein Atem stockte, ich hatte zu lange gezögert.
Langsam, ohne ein Quietschen, schwang die Tür zurück. Zuerst erkannte ich nur das vom Licht überstrahlte Rechteck der Öffnung; es blendete mich derart stark, als bestünde das angrenzende Zimmer aus einem einzigen Halogenscheinwerfer. Dann, ganz allmählich, zeichneten sich die Konturen eines Körpers ab. Jemand kam auf mich zu. Ich konnte weiche, fließende Rundungen erkennen. Eine Frau, nackt von Kopf bis Fuß. Ihr von hinten angestrahltes blondes Haar schien an den Spitzen Feuer gefangen zu haben.
Meine Unruhe, die sich nun auch mit Erregung mischte, wuchs. Kein Wort wollte sich in meiner trockenen Kehle formen lassen. Ungläubig starrte ich auf ihren Schoß, ihre vollendet geformten Brüste, ihre leicht geöffneten Lippen, auf denen ein feines (spöttisches?) Lächeln lag. Wer war diese Fremde?
Obwohl ihr Gesicht auch jetzt kaum mehr als ein Schemen im Dämmerlicht war, hätte ich schwören können, sie nie zuvor gesehen zu haben. Es war verrückt, denn nur einen Atemzug später beschlich mich erneut das paradoxe Gefühl, diese nächtliche Szene bereits schon einmal erlebt zu haben. Gleich würde sie mich fragen, ob ich die Bibel kannte.
Aber es kam anders …
Kurz vor dem Bett verharrte diese lichtgeborene Venus. Während mir ihr Gesicht zugewandt blieb, drehte sie sich nun seitlich zur Tür, so dass jetzt auch die Knospen ihrer Brüste Feuer fingen. Ihre schlanken Arme hatte sie locker gebogen über den Kopf gehoben.
»Na, was sagst du?«, fragte sie mich. »Ist es okay so?«
Ich antwortete nicht; stattdessen richtete ich wie selbstverständlich die Kamera auf sie. Im Sucher sah ich nur Schwarz, und doch begann ich immer wieder auf den Auslöser zu drücken, ohne Blitz. Ich wusste genau, brauchbare Fotos hätten nur dann entstehen können, wenn ich mit einem Stativ und sehr langen Belichtungszeiten – vielleicht sogar mit einem Infrarotfilm – gearbeitet hätte. So aber würde ich dem Zelluloid nur einen schwachen Grauschimmer entlocken können. Nicht zuletzt deshalb hatte ich überhaupt erst keinen Film eingelegt.
Mein unbekanntes Modell nahm ohne jede Anweisung neue, ungewöhnliche Stellungen ein. Ich blickte nun am Sucher vorbei, gleichzeitig erregt und irritiert. Ich fotografierte mit den Augen; das elektrische Klicken der Kamera war lediglich die unrhythmische Melodie für ihren Tanz.
Die Frau begann zu stöhnen. Immer wilder und obszöner wurden ihre Bewegungen. Ihre Finger umschmeichelten die Fülle ihres Busens, kniffen fest in die steil aufgerichteten Spitzen, umkreisten den flachen Bauch und vergruben sich dann tief zwischen den matt glänzenden Schenkeln. Der Kameraverschluss ratterte in einem unkontrollierten Stakkato. Mit jedem weiteren Taktschlag verstärkte sich ihr lustvolles Keuchen und Stöhnen, es wurde fordernder, hemmungsloser. Der Fotograf wurde zum Voyeur; schließlich stimmte ich in ihr Stöhnen ein. Licht, Schatten und Geräusche wirbelten in einem orgiastischen Strudel, der meine Sinne raubte.
Als ich aus meiner Ohnmacht erwachte, war ich wieder allein im Raum. Die Tür zum anderen Zimmer war wie zuvor angelehnt. Nun drang allerdings ein sehr gemäßigtes Licht durch den Spalt.
Sie war dort. Ich wusste es genau. Ich wollte aufspringen, um zu ihr zu eilen, aber ich zögerte. Die Kamera um meinen Hals war verschwunden, an ihrer Stelle hockte nun eine große, feucht glänzende Kröte auf meiner Brust. Seltsamerweise empfand ich keine Abscheu.
Ich richtete mich vorsichtig auf, und lautlos hüpfte das Tier in die Dunkelheit. Der Weg zur Tür erwies sich schwieriger als vermutet. Oft hatte ich den Eindruck, als vergrößerte sich der Abstand mit jedem meiner Schritte. Der Raum dehnte sich aus. Etwas wollte mich am Weiterkommen hindern, aber ich kämpfte dagegen an.
Endlich erreichte ich erschöpft, aber vor Begierde brennend, das Ende des Ganges. Ein leises Tropfen war zu hören. Nur leicht tippte ich mit den Fingern gegen die Klinke, die Tür glitt zurück. Diesmal verursachten ihre Scharniere ein hohes Wimmern, wie das Klagelied einer Katze. Ich konnte nun den Raum erkennen; es handelte sich um ein Badezimmer.
Tropfengeräusche.
Rechts befand sich eine geschlossene Duschkabine, ihr gegenüber ein WC mit Bidêt. Türkisfarbene Kacheln überall. Sprunghaft wanderte mein Blick umher und blieb dann auf eine Stelle direkt vor mir gerichtet. Sie stand mit dem Rücken zu mir vor einem Spiegel, immer noch nackt. Wasser tropfte. Sie schien sich zu waschen. Um ihren Kopf war ein dickes, weißes Badetuch geschlungen. Ich wagte kaum zu atmen. Sie hatte sich nach vorne gebeugt und war offenbar ganz in ihrer Schönheitspflege versunken.
Zögernd bewegte ich mich vorwärts. Das dargebotene Gesäß war wie eine verlockende Frucht. Ein köstlicher, praller Pfirsich. In der abgerundeten Spitze des Dreiecks zwischen ihren leicht gespreizten Beinen kräuselte sich dichtes, flauschiges Haar. Mein Atem wurde heftiger. Noch immer zeigte sie keine Reaktion.
Ich fragte mich, warum sie nicht schon längst von den donnernden Schlägen meines Herzens aufgeschreckt worden war. Sie musste mich doch einfach hören. Es war um einiges lauter als das spärlich fließende Wasser.
Ich stand nun direkt hinter ihr. Unschlüssig. War ihre Ahnungslosigkeit bloß Täuschung? Wartete sie vielleicht nur darauf zu spüren, wie sich mein Körper gegen den ihren presste? Es war mir einerlei; auch ihr Name, ihre Herkunft oder ihr Wesen waren ohne Belang. Was ich wollte, war ihr makelloses, festes Fleisch. Ich wollte diesen lustverheißenden Körper besitzen, ihn mir gefügig machen. Ohne jedes lästige ›Wenn‹ und ›Aber‹.
Als meine Hände ihr Gesäß fest umklammerten, zuckte sie nicht zusammen. Das war für mich Beweis genug. Sie hatte nur danach gefiebert, von mir genommen zu werden. Grinsend schlang ich meine Arme um sie, tastete nach ihren Brüsten. Ich beugte mich über sie und schmiegte meinen Kopf eng an die Kuhle ihres Halses. Eine schwarze Locke wand sich unter ihrem Turban hervor und kitzelte meine Nase.
Etwas tropfte in das Becken unter uns. Meine Hände wurden ungestümer; mit roher Gewalt pressten sie ihre vollen Brüste fest zusammen. Keuchend fügte ich ihr Schmerz zu. Ich wollte sie schreien hören, aber nichts geschah. Kein Laut entrang sich ihrer Kehle. Und plötzlich erstarrte mein Körper. Kraftlos öffneten sich meine Finger und erlösten das stark gerötete Fleisch von seiner Pein. Ich rang heftig nach Atem, aber immer noch sah ich die Haarlocke direkt vor meinen Augen. Sie war tatsächlich schwarz.
Schwarz.
Wie eine düstere Prophezeiung hallte das Wort durch meinen Kopf. Das konnte nicht sein. Mein Foto-Modell hatte blondes Haar getragen. Mit Entsetzen musste ich feststellen, dass ich nun wirklich nicht wusste, wen ich in meinen Armen hielt.
Noch bevor sich meine Gedanken überschlagen konnten, wand sich die Fremde geschickt aus meinem schlaffen Griff und drehte sich um.
Sie war keine Fremde. Ihr Gesicht war mir wohl vertraut. Aber dies trug nicht dazu bei, mein Grauen zu mindern – ganz im Gegenteil.
Ich wollte fliehen, egal wohin, nur weg von dieser unheimlichen Gestalt. Aber ihre Augen, ihre unergründlich schwarzen Augen lähmten meine Entschlusskraft.
Natascha!
Meine Lippen wagten nicht, ihren Namen laut auszusprechen.
Starr stand sie vor mir; ihr Leib, so weiß, als wäre sie mit Kreide geschminkt, zeigte keinerlei Verletzung oder Narbe. Nur ihr Mund war ein weitklaffender Schnitt, der sich als dunkelroter Halbmond von einem Ohr zum anderen zog. Ein triefendes, verschmiertes Maul mit einem garstigen Lächeln. Ja, sie lächelte, denn das Blut, welches ihr in stetigen, klumpigen Tropfen vom Kinn rann, war nicht ihr eigenes. Und erst jetzt sah ich auch den noch dampfenden, weichen Fleischklumpen in ihrer Hand.
Ich wusste sofort, dass es der angefressene Teil eines menschlichen Herzens war. Es war mein eigenes Herz, welches sie mir bei lebendigem Leib aus der Brust gerissen hatte. Ich musste tot sein, und doch hielt ihre Macht mein Bewusstsein wach. Mein Tod schien eine zu geringe Strafe für mein Vergehen.
Vergeblich suchte ich in ihren kalten, finsteren Augen nach einem Hauch von Gnade. Demütig senkte ich mein Haupt. Ich wagte erst wieder aufzublicken, als zärtliche Finger meine Arme streichelten. Unendliche Erleichterung durchströmte mich. Natascha hatte meine Entschuldigung angenommen; ihre Liebe siegte über den Hass. Glücklich, mit Tränen in den Augen, strahlte ich sie an.
Was ich nun aber sah, ließ auch den letzten Rest von Hoffnung für immer in mir sterben. Ich war das Opfer eines allerletzten, grausamen Scherzes geworden. Die Kreatur, in deren festem Krallengriff ich mich befand, war in Wahrheit eine riesige, schwarze Katze.
Ihre Augen hatten sich zu bösen Schlitzen verengt; der weit aufgerissene Rachen entblößte ein Meer aus nadelspitzen Zähnen. Dieser Mund wollte nicht vergeben oder lieben. Er wollte töten und fressen, immer nur fressen.
Ein grässlicher, fauchender Schrei besiegelte mein Schicksal.
»Eeeeeeeehuuuuuuuhh!!!«
»Heeeeeeeeuuuuuuuuuke!!«
»Heeeeeh, Luuuuuke!!«
Luke?
Verwirrt riss ich die Augen auf. Da ich anfangs nur Dunkelheit und stechenden Rauch wahrnahm, wäre ich beinahe in Panik aufgesprungen und hätte laut »FEUER!« gerufen. Erst als das Mädchen an der Kasse zum vierten Mal ihr wohlklingendes »Heeeeeh Luuuuuuke« plärrte, dämmerte es mir langsam, wo ich mich befand. Ich fühlte mich, als hätte man mich stundenlang durch die Mangel gedreht. Mit zittrigen Händen fuhr ich mir über die Stirn.
Kalter Schweiß klebte in meinen Haaren. Vor mir auf dem Tisch zählte ich sechs leere Bierkrüge und ebenso viele ineinander gestapelte Schnapsgläser. Hatte ich vergessen, die Gläser umzutauschen, oder hatte mir eine Bedienung immer neue gebracht? Ich wusste es nicht.
Prüfend schnupperte ich an der Glaspyramide. Gin, Katzenwasser. Wirklich überaus passend. Ich seufzte. Da ich offenbar niemandem eine Runde spendiert hatte, ging wohl alles auf mein Konto. Verdammtes Zeug, dachte ich. Verdammter Saufkopf!
Erst jetzt schlugen die Geräusche der Umgebung wieder wie eine Sturmflut über meinem Kopf zusammen. Stimmengewirr, Gesprächsfetzen, hohes verzerrtes Lachen, Gläserklirren, heiseres Brüllen, das knarrende Schaben von Stuhlbeinen am Boden. Wie lange hatte ich geschlafen? Ich musste meinen Arm mit der Uhr ausgestreckt in den Gang halten, um das Ziffernblatt ablesen zu können.
1 Uhr 52. Seit meiner letzten Bestellung konnten demnach kaum mehr als 20 Minuten vergangen sein. Nur zäh brach sich die Erinnerung einen Weg durch meinen pochenden Schädel. Ich war Natascha begegnet! Meine Geliebte hatte wieder ihren alten Körper besessen. Sie war tatsächlich auferstanden, so, als hätte es jene schicksalhafte Nacht im Zoo nie gegeben. Und doch hatte ich versucht, sie zu betrügen. Hastig schnellten meine Hände nach oben und betasteten zitternd meine Brust. Die Finger glitten aber nur über den unversehrten Stoff meines Polo-Shirts. Ich spürte den schnellen Schlag meines Herzens. Es gab keine heiße, klaffende Wunde. Nach wie vor strömte das Blut ungehindert durch das kilometerlange Netz meiner Adern.
Ein Traum. Alles war nur ein Traum. Ich stöhnte leise vor mich hin. Ein halbes Dutzend doppelter ›Gordon's‹ hatte mir lediglich eine Geisterfahrt durch die verkorksten Windungen meines Unterbewusstseins beschert. Es war nichts weiter als ein schlechter Trip gewesen.
Mit beiden Händen massierte ich eingehend meine pochenden Schläfen. Ein gewisses Unbehagen blieb auch jetzt. Ich erinnerte mich an jede Einzelheit meiner geisterhaften Begegnung. Das düstere Zimmer, die unbekannte Blondine, das türkis schimmernde Bad … Alles hatte so beängstigend real gewirkt. War es wirklich nur ein Traum gewesen? Und wenn nein, was war es dann? Meine Gedanken taumelten wie wild durcheinander. Eine Offenbarung? Eine Vision? Oder etwa eine Warnung?
Der stärker werdende Druck in meiner Blase machte mich darauf aufmerksam, dass es vorerst naheliegendere Dinge gab, um die ich mich kümmern musste. Nachdem ich mich notgedrungen in das stinkende Loch mit der Aufschrift ›Lass' dein ‚Bud' hier, Buddy!‹ gezwängt hatte (Die Hygiene in dieser durch ein undichtes Wasserrohr halb überschwemmten Kloake musste selbst einen abgebrühten Vietnam-Veteranen kurzfristig glauben machen, er habe Charlies Straflager noch immer nicht verlassen.), warf ich mir meine dünne Sommerjacke über die Schulter und ging im Slalom durch die auch jetzt noch dichte Menge zum Ausgang.
Niemand beobachtete mich, am allerwenigsten Lukes hässliche Kassiererin. Als ich an ihrem Platz vorbeiging, glotzte das übergewichtige Mädchen nur ausdruckslos ins Leere. Kein großer Verlust, dachte ich. Auf ihr gelangweiltes »'nen schönen Abend noch, Mistaaah« konnte ich nun wirklich dankend verzichten.
Ein feiner Nieselregen hatte eingesetzt. Winzige Tröpfchen hüllten die Straße in einen gazeartigen Schleier. Ich ließ meine Jacke aber auch weiterhin über der Schulter baumeln. Nach der stickigen Enge der Kneipe genoss ich den seltenen Niederschlag. Der Regen war zudem warm; nur durch die Verdunstung auf der Haut spendete er mir etwas Kühle. Tief sog ich die feuchte Luft in meine Lungen. Ich fühlte mich weder müde noch betrunken.
Meinen Beinen gelang ein bemerkenswert gerader Gang. Nicht die Spur eines Schwankens. Angesichts der Alkoholmenge, die in meinem Blut zirkulieren musste, war dies schon eine beachtliche Leistung. Lächelnd schüttelte ich den Kopf. »Hast dich ja schon gut an das Zeug gewöhnt, Alter«, raunte ich mir selbstironisch zu. »Wenn du fleißig trainierst, kann aus dir noch ein ganz passabler Junkie werden.«
Großartige Aussichten!, bemerkte die andere Stimme in mir. Aber noch war es nicht so weit. Für die überraschende Nüchternheit machte ich nicht eine Art organische Anpassung an meine Sucht verantwortlich. Nein, das, was mich aufgerüttelt und meine betäubten Hirnwindungen frei gefegt hatte, war einzig und allein mein düsteres Rendezvous mit Natascha gewesen. Mein tödliches Rendezvous.
Die letzten, blutigen Bilder meines Alptraums hielten mich noch immer gefangen. Unruhig wanderte mein Blick zur anderen Straßenseite. War dort nicht ein Schatten gewesen, der sich schnell in einen Hauseingang geflüchtet hatte? Die friedliche Stille der Nacht verwandelte sich plötzlich in etwas Lauerndes. Die Nacht war lebendig geworden – und böse.
»Alles nur dummes Zeug!«, sagte ich mir selbst. »Jetzt siehst du wirklich schon Gespenster.«
Meine Beine beschleunigten dennoch ihren Schritt. Obwohl ich nur Augenblicke zuvor den Regen begrüßt hatte, fröstelte mich nun. Unsichtbare Eiskristalle bedeckten meine Arme.
Während ich noch ungeschickt beim Laufen die Jacke überzog, hastete ich immer schneller durch das menschenleere Gewirr der Gassen. An einer unbeleuchteten Kreuzung bremste ich derart abrupt ab, als sei ich vor eine unsichtbare Mauer gelaufen. Von der anderen Seite her bewegte sich ein kleiner, schmaler Schatten tippelnd auf mich zu.
Ich hielt den Atem an; deutlich vernahm ich das leise Klicken von Krallen. Ich stand mitten auf der Straße, unfähig, auch nur einen Finger zu bewegen. Glücklicherweise gab es hier keinen Durchgangsverkehr, denn selbst vor einem herandonnernden Truck hätte ich wohl kaum mit der Wimper gezuckt.
Das Klicken kam näher. Trübe, wässrige Augen musterten mich argwöhnisch. Das Tier beschnüffelte meine Schuhe, hob prüfend ein letztes Mal seinen Kopf und setzte dann gelangweilt seinen nächtlichen Spaziergang fort. Noch immer gelähmt, beobachtete ich, wie der dicke Ringelschwanz des Schattens zwischen zwei geparkten Autos verschwand.
Ein Hund. Nur mühsam formte mein Verstand das Zauberwort, welches mich aus meiner Starre befreien konnte. Es ist nur ein Hund gewesen, dachte ich aufatmend. Nur ein verlauster, kleiner Straßenköter.
Mechanisch staksten meine bleischweren Beine zur gegenüberliegenden Seite. Hinter dem nächsten Block ließ bereits das bunte Leuchten von Neonreklame auf die Nähe zum Laconia Drive oder der Chatham Street schließen. Schwer keuchend lehnte ich mich gegen die raue Fassade einer Hauswand.
Was ist nur los mit dir?, fragte ich mich stumm. Diese verfluchte Promenadenmischung hat dir eine Scheißangst eingejagt. Aber in Wahrheit war es nicht der Hund; eigentlich hattest du etwas anderes erwartet, nicht wahr? – Ja, musste ich mir eingestehen. Ich hatte mich davor gefürchtet, einer Katze zu begegnen. Doch warum nur? Ich liebte doch Katzen. Auch eine ganz bestimmte?, fragte mich eine gehässige, innere Stimme.
Mühsam stieß ich mich von der Wand ab und torkelte dem Licht entgegen. Der verrückte Traum saß mir noch immer tief in den Knochen. Gewissensbisse waren schuld daran. Aber was war denn schon dabei, an andere Frauen zu denken? In meiner Situation war dies doch nur zu verständlich, vollkommen natürlich. Ich blieb stehen. Und was war, wenn ich einmal einen dieser Wünsche in die Tat umsetzen würde? Beging ich dann tatsächlich so etwas wie Verrat?