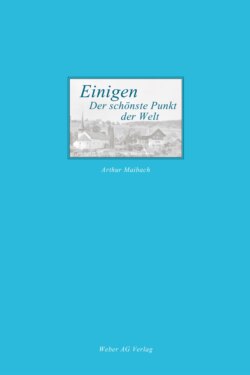Читать книгу Einigen - der schönste Punkt der Welt - Arthur Maibach - Страница 11
ОглавлениеDie Strättliger Chronik
Sei es die Geschichte der Gründung der Eidgenossenschaft mit dem Helden Wilhelm Tell von Friedrich Schiller oder die Sage des Heiligen Beatus, der den Drachen tötete, oder die Aussagen des Eulogius Kiburger, der die Strättliger Chronik schrieb und unseren Ort als das Paradies bezeichnete. In all diesen Geschichten ist ein Teil Wahrheit, es wurden aber auch Begebenheiten aus anderen Schriften übernommen und mit viel Fantasie einer bestimmten Region oder einem Dorf, oder wie im Fall Einigen, einer Kirche zugeordnet. Freuen wir uns doch, dass Eulogius Kiburger mit seiner schriftstellerischen Ader und dem Wissen aus lateinischen Werken, welche er zur Strättliger Chronik verarbeitete, uns eine wunderbare «historische» Vergangenheit schenkte.
An dieser Stelle werde ich kurz auf die Beatussage zurückgreifen:
Die Bollandisten in Antwerpen und später in Brüssel haben vom Jesuitengeneral den Auftrag erhalten, im Sammelwerk Acta Sanctorum alle Traditionen zum Leben der Heiligen zu publizieren und kritisch zu verarbeiten. Ein Riesenwerk für Jahrhunderte!
Um 1680 kommen die Bollandisten zum 9. Mai, zum Beatustag. Pater Gottfried Henschen legt alle vorhandenen Beatustexte auf sein Forscherpult. Dazu gehört natürlich auch das Buch von Daniel Agricola (1511), das in Interlaken und bei der Beatushöhle zum Einsatz gekommen war. Aber vor Henschenius liegen auch die frühmittelalterlichen Texte aus der Vendôme (z.T. aus dem 9. Jahrhundert), die das Leben eines dortigen Beatus schildern. Ein minutiöser Vergleich bringt es an den Tag: Agricola kann nur so ausführlich über den Beatus vom Thunersee hinschreiben, weil die Vendôme-Texte, die er offenbar zur Verfügung hatte, ihm alle Details lieferten, nämlich: Beatus (natürlich der von der Vendôme) wird von Petrus zum Apostel berufen und durch die kirchlichen Weihen priesterlich bevollmächtigt, er lebt in apostolischer Armut und verdient sein Brot durch seiner Hände Arbeit, er tut den Mitmenschen viel Gutes, bedient sogar seinen Begleiter, er predigt geistesmächtig und bekehrt die Heiden, er sucht im Alter eine einsame Wohnstätte, er kommt an den See und wird von den Schiffsleuten auf eine Höhle droben in den Felsen hingewiesen, er will den Fährmann, da er kein Geld besitzt, mit einem Messbuch entlöhnen, er vertreibt mit Todes- und Glaubensmut den von den Anwohnern gefürchteten Drachen aus der Höhle, er lebt und stirbt dort und findet daselbst sein Grab. Alles dies in Gallien, in Vindocinum, in der Vendôme, südwestlich von Paris, wo es ebenfalls einen See, eine Felswand, eine Drachenhöhle und den Namen Dunensis gibt. Dies alles liest Agricola in den Texten aus Frankreich und macht kurzen Prozess: Er überträgt das Ganze an den Thunersee, denn auch dort taucht ja seit Jahrhunderten der Name «Beatus» ebenfalls auf. Es geht da, so wird er argumentiert haben, letztlich um den selben Sankt Beatus.
Was er aber nicht tut: Er erwähnt seine Quelle aus Frankreich mit keinem Wort. Er kopiert … und damit basta!
Hier schafft nun Jesuitenpater Henschenius 1680 Klarheit, und dies wahrscheinlich für alle Zeiten. In den Acta Sanctorum legt er sein Ergebnis nieder. Sein Ordensbruder Henricus Moretus bestätigt und verfeinert 1907 die Beweisführung mit weiteren eindrücklichen Materialien aus der riesigen Dokumentensammlung der Bollandisten in Brüssel.
Fazit: Von jetzt an wird die Frage auftauchen: Sind die Geschichten um Beatus, wie die Sagen, Volksüberlieferungen und Legendenerzählungen sie berichten, in dieser Art hier bei uns am Thunersee wirklich passiert? Gehören sie nicht definitiv in ihr Ursprungsland Frankreich?4
Nun sei noch zu erwähnen, dass in der gesamten Geschichte um den Heiligen Beatus nur der See, die Felswand und das naheliegende «Dunensis», in unserem Fall «Thun», erwähnt werden. Die weitere Region und die Dörfer am See sind nicht genannt. So wird Einigen mit keiner Silbe erwähnt, obschon der Heilige Beatus auf seinem Mantel über den See fuhr.
Als Verfasser der Strättliger Chronik nennt sich Eulogius Kiburger Kilchherr des Paradieses, der Kirche zu Einigen. An jener Stelle wird erwähnt, wie er im Jahr 1446 einen Teil des Kirchendaches neu herstellen und einen Taufstein machen liess, da man vorher in einer «hölzernen Stande oder Kübel» zu taufen genötigt war. Auch ein Sakramentshäuschen von Stein liess Kiburger in der Mauer anbringen, weil vormals das Sakrament in eine Kiste gelegt und oft von groben Leuten darauf gesessen wurde. Als Patrone der Kirche nennt er seine gnädigen Herren von Bubenberg. Ebendaselbst auf Seite 39 berichtet er den Tod Heinrichs von Bubenberg 1464. Auf Seite 117 wird die Jahrzahl 1448 genannt. Aus dem der Chronik beigebundenen regimen pestilenciale geht hervor, dass Eulogius Kiburger schon 1439 im Dienste der Bubenberg stand. Hierauf findet man ihn seit 1456 als Leutpriester zu Worb; als solcher hatte er seit 1478 zugleich die Stelle eines Kammerers und Kaplans von Münsingen und seit 1488 diejenige eines Stiftscanonicus von Bern inne. Mit geistlichen Pfründen wohl versehen, hatte er das Recht, Stellvertreter für diejenigen zu bezeichnen, die er nicht selbst verwalten konnte. Am einträglichsten war wohl die Kaplanei von Münsingen, eine Stiftung der Gertrud Segesser, Heinzmann von Steins Witwe, von 1463, mit einem Einkommen von 50 Gulden ewiger Gült. Im Jahr 1485 wurde diese Pfründe von ihrem Patron, Ritter Adrian von Bubenberg, dem eben neu errichteten Collegistifte von Bern einverleibt, was mehrjährige Streitigkeiten mit den Leuten von Münsingen zur Folge hatte. Während derselben und vielleicht gerade deshalb erhielt Kiburger, Günstling der zwei mächtigsten damaligen Berner Geschlechter, 1488 als Kirchherr von Worb zugleich noch eine Chorherrenstelle von Bern. 1492 liess er das Jahrzeitenbuch von Worb niederschreiben. Später siedelte er an das Vincenzen-Stift nach Bern über, wo er 1506 starb, und zwar in hohem Alter, da er über sechzig Jahre im Kirchendienste gestanden hatte.
Als Abfassungszeit der Strättliger Chronik ist die Mitte des 15. Jahrhunderts anzusetzen. 1456 verliess Kiburger Einigen, nicht aber den Dienst des Hauses Bubenberg, dem zu Ehren das Werk unternommen wurde, denn die Bubenberger hatten auch das Patronat von Worb. Immerhin mag er seine Arbeit noch in Einigen vollendet haben. Dass er den Tod Heinrichs von Bubenberg meldet, deutet darauf hin, dass die uns erhaltene Originalschrift erst nach 1464 ins Reine umgeschrieben wurde. Aus dem Umstand, dass auf Seite 106 der Feiertag Mariä Opferung noch fehlt, darf jedenfalls der Schluss gezogen werden, dass die Chronik vor 1466 verfasst wurde.5 Einigen ist mit der Strättliger Chronik sehr stark verbunden. Seien es die Sagen, die Geschichten rund um unsere Kirche, das Paradies oder die Wunderquelle. So erlaube ich mir, zur besseren Verständigung eine Zusammenfassung der Chronik, welche Herr Dr. Jakob Baechtold verfasste, in ungekürzter Fassung dem interessierten Leser weiterzugeben.
Es folge eine rasche Inhaltsübersicht der Stretlinger Chronik:
(I.) Zu den Zeiten des Papstes Alexander I. und des Kaisers Hadriuns Elius, als man zählte 121 Jahre nach Christo, lebte ein römischer König Ptolemäus, hochgelehrt in der Kunst der Mathematik und Astronomie. Auf der Jagd wollte er einst den Pfeil gegen einen Hirsch absenden, als zwischen den Hörnern desselben ein Kreuz erschien und ihm zurief, dass er den Herrn Christum selber verfolge. (Ursprung des Stretlinger Wappens.) Ptolemäus liess sich vom Papste taufen und erhielt den Namen Theodricus. Um der Christenverfolgung zu entgehen, schied er sich von der Heimat und all seinem Gut und kam zu einem Herzog von Burgund. Dieser behielt ihn bei sich. Durch blosses Handaufstrecken wehrte Theodricus einen zornigen Löwen. – Es erhob sich ein Krieg zwischen dem Herzog von Burgund und einem König von Frankreich, statt der Schlacht wurde ein Zweikampf angeordnet; Dietrich überwand schlafend seinen Gegner, dafür erhielt er die Tochter des Herzogs mit dem Namen Diemut und das Land Kleinburgund mit den Burgen um den Wendelsee, namentlich den goldenen Hof Spiez und die Gegend um Einigen, genannt das Paradies. An dem Orte, das da heisst zum goldenen Luft, erbaute er die Burg Stretlingen und wurde der Stammvater eines grossen Hauses. Sei Sohn war Albrecht von Stretlingen.
(II.) 218 Jahre nach der Geburt Christi zu den Zeiten des Papstes Calixt und des Kaisers Philippus Materno war ein Herr von Stretlingen mit dem Namen Berchtold. Damals war weit und breit im mindern Burgund noch kein Gotteshaus; zu göttlicher und St. Michaels Ehre baute derselbe auf seinem Schloss eine Kapelle. – Berchtolds Gemahlin Aureliana gebar einen Sohn Sigfried, der von einem bösen Geist besessen wurde. Deswegen verfiel der Vater in solche Ungeduld, dass er alle, die auf der Landstrasse vorüberwanderten, gefangen nahm, ob er darunter einen fände, der seinen Sohn befreien möchte. Es gelang ihm, einen frommen Priester zu greifen, der den Teufel austrieb. – Der geheilte Sigfried wollte über die hoch angeschwollene Kander reiten, da bat ihn ein Aussätziger, er möchte ihn auf sein Pferd nehmen und auch hinübersetzen. Als der Elende auf dem anderen Ufer abgestiegen war, verlangte er von dem Herrn flehentlich, dass er ihn küssen möchte. Jener tat es mit Widerstreben zur Ehre St. Michaels und erfuhr darauf, dass er Christum geküsst. Sigfrid hinterliess einen Sohn Caspar von Stretlingen, einen treuen Schirmer des Volkes, aber einen scharfen Richter gegen die Übeltäter. Er trug allezeit einen Strick an seinem Gürtel, um die Bösewichter auf frischer Tat zu hängen. – Einst als er des Morgens sein Schloss verliess, hörte er die Stimme des Erzengels St. Michael, der ihm befahl, den ersten Mann, der ihm begegnete, aufzuknüpfen. Das Schicksal traf den Stretlinger Schlossvogt selber, welcher gestand, dass er sein Amt missbraucht, seinem eigenen Herrn sogar nach dem Leben getrachtet hätte. – Auf ihn folgte der gute Wernhart von Stretlingen. Zu diesem kam einst im harten Winter der Teufel in Pilgergestalt; Werner lieh ihm seinen Mantel, damit er sich deckte, worauf sich der Böse mit dem Mantel davonmachte. Derselbe Herr Wernhart trat eine Wallfahrt an nach dem Berge Garganus, wo sich St. Michael erzeigt hatte. Beim Scheiden gab er seiner Hausfrau Susanna die Hälfte eines Rings und fünf Jahre Frist: wenn er nach dieser Zeit nicht zurück sei, möge sie einen anderen Gemahl nehmen. In Lamparten wurde er fünf Jahre lang gefangen gehalten. In derselben Nacht aber, da zu Hause Frau Susanna die Hochzeit mit einem anderen feiern wollte, erschien der Teufel im Gefängnis und trug Wernharten im Auftrag St. Michaels durch die Lüfte, setzte ihn in Stretlingen ab und liess ihm auch den geraubten Mantel zurück. Als Spielmann erschien der Totgeglaubte unter den Hochzeitgästen und gab sich durch den Ring, den er in ein Trinkgeschirr fallen liess, seiner Gemahlin zu erkennen.
(III.) Hernach war ein Herr Arnold von Stretlingen, der ausserhalb der Burg eine Leutkirche erbauen wollte. Der Platz, wo man zu graben anfing, wurde jede Nacht verschüttet. St. Michael aber wies den Bauleuten selbst die dazu geweihte Stelle samt einem Wunderbrunnen. Eine Stimme wurde gehört, hier sei ein Schatz, den niemand bezahlen möge, heilsam für alle Siechtümer des Leibes und der Seele. An diesem Orte wurde nun die Kirche zum Paradies (später Einigen genannt) gebaut. Der Bischof von Lausanne kam zur Einweihung, und Herr Arnold von Stretlingen stiftete einen reichen Kirchensatz mit Zehnten und Freiheiten. – Die Besitzungen der Kirche des Paradies wurden weitläufig ausgemarcht und die Privilegien des Kirchherrn daselbst bestimmt. Das geschah im Jahre 223. (Die erste Kirche wurde in der Mitte des siebten Jahrhunderts erbaut. Anmerkung des Verfassers.) – Die Kirchweihe vollbrachte St. Michael selbst und befahl dem Volk, sein Heiligtum (ein Stück von dem Mantel des Erzengels) aus dem Schloss Stretlingen nach dem Paradies in einer Prozession überzuführen. – Während der Einweihung störte ein vom Teufel Besessener die feierliche Handlung; der Bischof schloss denselben in den hohlen Fronaltar und trieb den Bösen aus. Löbliche Ermahnung an das Volk, das Heiligtum und namentlich die Kirchherren in Ehren zu halten. Herr Arnold verlieh diesen reiche Gaben und Privilegien. Bestätigung des Priesters Cuno als Kirchherr des Paradieses. Unter anderen Freiheiten wurde ihm erlaubt, ein Taubenhaus zu halten, Jagdhunde, Federspiel und alles, was zum Weidwerk gehört; ebenso solle ihm und sonst niemandem die Fischerei im Wendelsee gehören. Der Bischof erteilte allen Guttätern der Kirche Segen und Ablass. – Hierauf verfasste er alles, das da geschehen war, in eine Schrift, damit dieselbe durch den Papst bestätiget würde und schied von hinnen. Arnold gedachte selbst nach Rom zu ziehen, starb aber vorher im Jahre 315. Sein Sohn, ebenfalls Arnold geheissen, vollendete das Werk und fuhr zum Papst Silvester und erzählte von den grossen Zeichen, die in der Kirche des Paradieses geschehen waren. – Erstens, die wunderbare Heilung eines Lahmen durch St. Michael. – Zweitens, die Auferweckung eines Gehängten. – Drittens, heilsame Beschwörung einer Jungfrau, die den Bösen durch einen Trunk in sich aufgenommen. (Die Vergabungen an den Kirchherrn stets genau berechnet.) – Bestätigung der Engelweihe durch päpstliche Bullen, Verleihung von Ablass auf ewige Zeiten. Den Kilchherren des Paradieses wurde die Gewalt gegeben, den bösen Geist zu bannen; aus besonderer Gnade dürfen sie auch einen Kautzhut tragen, wie die Chorherren von Lausanne. Heimkehr und feierliche Verkündigung der erlangten Privilegien.
(IV.) Im Jahre 933 war ein Herr von Stretlingen mit dem Namen Rudolf, seine Frau hiess Berta. Beide führten ein Gott wohlgefälliges Leben. Rudolf wurde zum König von Burgund gewählt. Seine Tochter Adelheid vermählte sich mit Lothar, dem Sohne des Königs Hugo von Lamparten; nach Lothars Tode wurde sie dem König Otto zum Weibe gegeben und der Sohn dieser Ehe, ebenfalls Otto, stieg nachmals zur Würde eines Kaisers. Rudolf sah einst im Traume eine hohe Stadt mit zwölf Toren. Ein Priester legte das Gesicht als eine Mahnung aus, dass der König um den Wendelsee zwölf Töchterkirchen des Gotteshauses zum Paradies erbauen sollte. – Hierauf gründete Rudolf die zwölf Kirchen Frutigen, Leissigen, Aeschi, Wimmis, Uttigen, Thierachern, Scherzligen, Thun, Hilterfingen, Sigriswil, Amsoldingen und Spiez. Die beiden letzten wurden zu Stiften erhoben. Bei dem alten Turm von Spiez, den Attila erbaut hatte, legte der König eine Stadt an. Weil Rudolf aber die Mutterkirche zu vernachlässigen begann und die Töchter über Gebühr erhöhte, verhängte Gott ein grosses Siechtum über ihn und im Traum sah er sich vor den Richterstuhl des Allerhöchsten gestellt. Auf der Himmelswaage wurden seine guten und bösen Werke gegeneinander abgewogen; schon wollte der Teufel die letztere Schale herunterziehen, da drohte St. Michael, zu dem Rudolf seine Zuflucht genommen, dem Bösen mit dem Schwert, dass er zurückfuhr und die gute Schale stieg. Der König aber verwandelte seinen bösen Sinn, und an der nächsten Kirchweihe strömte über die Massen viel Volkes nach dem Paradies zu dem Kirchherren Lütold, Ablass der Sünden zu gewinnen. – Hier wurden der versammelten Menge drei Wunder, die Heilung eines Blinden, eines Kranken und eines Lahmen verkündigt. König Rudolf und Kaiserin Adelheid fuhren nach Rom, um der Mutterkirche vom Papst Leo VIII. neue Privilegien zu erwerben. – Der Papst bestätigte die englische Kirchweihe und den Ablass, erhöhte das Ansehen der Paradieskirche und des Priesters daselbst dadurch, dass er die zwölf Töchterkirchen verpflichtete, jährlich eine Wachskerze der Mutter zu opfern. Rudolf und Berta aber starben bald nach dieser Zeit und wurden in Peterlingen begraben.
(V.) Hernach als man zählte 1123 lebte ein wahrhaftiger, andächtiger und keuscher Herr von Stretlingen, Burkart. – Ein Grosser des Landes gab ihm seine Tochter Sophia zur Ehe; allein sie wurde vor dem Beilager vom Teufel besessen und weigerte sich, dem Gottesdienste im Paradiese beizuwohnen. Mit Gewalt liess ihr Gemahl sie während eines heiligen Amtes in der Kirche festhalten; der Priester Diethelm band die Rasende mit der Stola, schloss sie in den Hochaltar und vollbrachte die Beschwörung. Aber am dritten Tag starb sie. In jener Zeit war in deutschen Landen eine grosse Pestilenz ausgebrochen, so dass in der Herrschaft Stretlingen kaum einer den andern begraben mochte. Da gelobten die zwölf Kirchen und alles Volk einen Kreuzgang nach dem Paradiese und schwuren, denselben jährlich zu wiederholen. Da hörte der grosse Tod auf. – Und auf der Kirchweihe wurden zwei Zeichen verkündet, die Heilung einer lahmen Frau und die eines siechen Mannes, dem St. Michael im Traume erschienen. Herr Burkart aber hatte mit Kaiser Friederich V. in Cremona zu verhandeln und zog von dort nach Rom zu Honorius III. und erlangte, dass durch eine öffentliche Steuer seiner Kirche, die während der Pestilenz schwer gelitten hatte, aufgeholfen und dadurch der Zulauf wieder vergrössert wurde.
(VI.) Unter Friederich I. war ein Stretlinger mit Namen Diebold 1156. Seine Frau hiess Anna. Durch Unterweisung des Teufels fing er an, ein wilder verkehrter Wüterich zu sein und ein Zerstörer der kirchlichen Freiheiten. Er zog auch die Hinterlassenschaft der verstorbenen Kirchherren wider göttliches und menschliches Recht an sich. An der Kirchweihe aber hielt ihm der neue Priester Dietrich in Gegenwart der ganzen Gemeinde sein Unrecht vor, strafte ihn mit kühnen Worten und wies ihn von der Kirche. Diebold kehrte wütend auf seine Burg zurück, aber am dritten Tag fuhr der Teufel in ihn und peinigte ihn auf den Tod. Als er durch den Kirchherrn wieder entledigt worden war, wollte er dennoch das geraubte Gut nicht herausgeben. Deshalb wurde er abermals besessen und starb ohne alle Vernunft, und seine Seele wurde den bösen Geistern übergeben, die trugen sie in das nahegelegene Moos, das deswegen das Höllmoos heisset. Dort liess sich die arme Seele mit grossem Klageruf hören und kam nicht eher zur Ruhe, bis der Kirche das Ihrige nebst anderen Gaben wieder erstattet wurde. Die Söhne Diebolds, Richard, Otto und Marquard von Stretlingen, schickten einen Boten zum Papste Alexander III. und erhielten neue Freiheiten und Heiltümer für das Paradies. Dafür sollten aber dreissig Messen gelesen und beim Höllmoos ein Bruderhaus gestiftet werden.
(VII.) Als man zählte 1194, zu Zeiten Heinrichs VI., herrschte Konrad von Stretlingen, ein grosser, gerader, grusssamer Mann. Seine Züchtigkeit zeigte sich namentlich an einer Kirchweihe beim Tanz, wo er die unziemliche Rede eines Gesellen ernst strafte. – Bei der selben Gelegenheit wurden in der Kirche zwei Zeichen vom Priester gemeldet, die Heilung zweier Kinder, von denen das eine blind gewesen, das andere in den Brunnen gefallen war. Konrad von Stretlingen ritt hernach nach Jerusalem und seiner Frau zu Liebe auch zu St. Katharinen Grab am Berg Sinai; auf der Rückfahrt erlangte er vom Papst Innocentius III. neue Freiheiten für seine Kirche in guten Bullen. Sein Kirchherr aber erhielt weitere reiche Gaben.
(VIII.) Ihm folgte 1213 Bernhard von Stretlingen, ein christlicher Herr. Seine Gemahlin hiess Adelheid. Bernhard nahm das Kreuz auf sich und fuhr nach Jerusalem, und dort wurde ihm als Heiltum ein Stück des Kreuzes Christi zu Teil. Darauf begab er sich zu dem hl. Vater Honorius IV., dass er ihm den Ablass der Sünden und die Steuer für seine Kirche aufs Neue bestätige, und offenbarte ihm drei Zeichen. – Das erste von einem unschuldig Gehängten, der durch die Hilfe St. Michaels vom Galgen fiel. – Zum anderen und dritten von der Heilung eines blinden Mädchens und der Auferweckung eines Ertrunkenen. Der Papst gewährte Bernhard dessen Bitte und der Gottesdienst im Paradiese blühte mehr als zuvor.
Hernach war ein anderer Herr zu Stretlingen, Anshelm, ein unsauberer, unkeuscher Mann. Seine Gemahlin Hedwig rief oft St. Michael an, dass er ihr in diesen Sachen behülflich wäre. – In einer Nacht beim Mondschein kehrte Herr Anshelm von einem Werk der Unkeuschheit heim, und wie ihn Frau Hedwig vom Fenster aus erblickte, fing sie an zu schreien, denn er war ganz schwarz und vom Teufel besessen. Als er am Morgen zur Kirche wollte, brüllte selbst das Vieh ob dem Anblick. Reuig beichtete er, da kam ihm seine frühere Gestalt wieder. – An der Kirchweihe wurde die Heilung eines Besessenen verkündigt. Herr Anshelm aber machte sich auf und erlangte von Papst Alexander V. Privilegien und Reliquien für das Paradies.
(IX.) Darauf war 1223 Wilhelm Herr zu Stretlingen, ein besonderer Gönner der Kirche und des Kirchherrn. Allein durch grosse zeitliche Güter fällt der Mensch oft von seiner Andacht ab; so ging es auch den glückseligen Umwohnern des Paradieses. – Die zwölf Kirchen wurden widerspenstig und erhoben sich gegen ihre Mutter, entrichteten die Abgaben nicht mehr; auch das umliegende Volk erhob sich, tötete den Priester des Paradieses, verbrannte Kirche und Beinhaus und verwüstete das Schloss Stretlingen. Sieben Jahre lang dauerte der Landeskrieg, da wurde Friede gemacht und die Untertanen des Paradieses versprachen eine neue Kirche zu bauen. Allein weil sie übel Wort hielten, strafte Gott mit Kröpfen, Höckern, der fallenden Sucht und anderen Siechtagen. Nach Erbauung der neuen Kirche kam der Bischof von Lausanne, dieselbe zu weihen. – Darauf erschien St. Michael allem Volk und verkündigte, dass er selbst die Weihung des Heiligtums zum andern Mal vorgenommen hätte. Der Kirchherr Rudolf hielt eine ernstliche Ansprache an das widerspenstige Volk. – Zugleich offenbarte er drei Zeichen, die Heilung einer lahmen, einer ertrunkenen und einer blinden Frau. Herr Wilhelm nahm mit dem römischen Kaiser Friederich an einem Kreuzzug teil und gelangte nach schmerzlichem Abschied über Lamparten nach Sizilien, wo sie sich einschifften und glücklich gegen die Heiden stritten. Das war im Jahr 1233. In Rom gewann er von Gregor IX. Bestätigung aller früheren Privilegien für die neue Kirche. Bei der nächsten Kirchweihe aber strömten wohl viertausend Menschen dahin und auch der Bischof von Lausanne erschien unter ihnen.
(X.) Im Jahr 1272 wurde Rudolf von Habsburg zu einem römischen König gewählt, in allem seinem Fürnehmen ein glückhaftiger Mann. Damals lebte der milde Herr Sigmund von Stretlingen und seine Frau Küngold. Er war gar sauber und keusch. Eine Frau, die den Willen ihres Herzens an ihn geworfen hatte, liess er durch seinen Knecht abweisen. Rudolf von Habsburg verlieh 1280 der Stadt Spiez das Recht, einen Wochenmarkt abzuhalten. – Auf der Kirchweihe wurden vier Wunder verkündigt. – Auf Unterweisung seines Kirchherrn Notker begab sich Herr Sigmund zu Papst Gregor X. nach Lugdanum und erhielt sämtliche Rechte, wie seine Vordern. (XI.) Hernach lebte Heinrich von Stretlingen, Herr zu Laubeck, dessen Gemahlin Elisabeth hiess. Er war ganz und gar ein Kind der Welt, das der christlichen Dinge wenig achtete. Zu der Kirchweihe des Paradieses lud er Edel und Unedel ein, veranstaltete dabei grosse Tänze und allerlei Spiels mit Singen, Springen, Kugelwerfen, Steinstossen, Essen, Trinken und anderen Sünden, daraus grosser Neid und Hass, Totschlag und Krieg entstand. Auf der Kirchweihe war man kaum des Lebens mehr sicher, so dass die umwohnenden Herren ihren Untertanen den Besuch derselben untersagten, und die zwölf Töchterkirchen ihre Wallfahrten nach dem Paradiese einstellten. In Thun aber errichtete man solchen Abbruchs wegen dem Erzengel Michael eine Kapelle; andere wandten sich nach Faulensee zu der Kapelle St. Columbans. So kam das Paradies zu Fall. Die Kirchherren zogen weg und traten in das Stift zu Amsoldingen, die Stretlinger verliessen ihre Stammburg und legten ihren Sitz nach Spiez. Die Bullen und Briefe der Kirche gingen verloren; Glockenhaus und Altäre stürzten ein. Der Einöde (einige) wegen wurde der Ort fortan zu Einigen genannt. Herr Heinrich schied darnach von dieser Zeit. Gott vergebe ihm seine Sünden! Er liess einen Sohn zurück, Rudolf von Salveswyl, der 1348 starb.
(XII.) Zum letzten war ein Herr von Stretlingen mit dem Namen Walter, ein friedsamer, guter Herr. Seine Hausfrau hiess Mechtild. Der trug ein betrübtes Herz über den Verfall des Paradieses und ritt deshalb zu dem hl. Vater Innocencius VI. nach Avignon und bat um Bestätigung der verloren gegangenen Privilegien für seine Kirche zu Einigen. Das alles bewilligte der Papst und spendete reichlich Ablass. Der Bischof von Lausanne verkündigte auf der nächsten Kirchweihe diese Freiheiten. Mit Walter aber starb das Geschlecht von Stretlingen aus; der letzte des Stammes, Herr Ulrich, war Kirchherr zu Spiez. Der Kirchensatz von Einigen kam darauf in die Hände meiner gnädigen Herren von Bubenberg, denen zu Ehren dieses deutsche Buch aus dem Latein aufgesetzt ist, damit sie wissen mögen, wie ihre Vordern sich gehalten. Der allmächtige Gott aber kann das Kirchlein zu Einigen wiederum gross machen und der hochgelobte St. Michael seine Wunder noch heut bei Tage da erzeigen!6
Soweit zur kurzen Zusammenfassung der Stretlinger Chronik. Sei es mir erlaubt, zur besseren Verständigung noch einige Zeilen aus Baechtolds Werk zu zitieren: «Nach dieser Inhaltsangabe wird es unnötig sein, viele Worte über den Unwert der Stretlinger Chronik als geschichtliche Quelle zu verlieren. Historische Wahrheit wird hier, wo die Dinge aufs Unglaublichste mit den krassesten Anachronismen durch einander geworfen sind, Niemand suchen wollen. Als seine Quelle nennt Kiburger häufig ein lateinisches Buch, aus dem er übersetze für die Ungelehrten. Dass wir es mit einer Übertragung zu tun haben, ist nicht glaubwürdig; wohl aber zeigen unverdächtige Personal- und Lokalnotizen bei Vergabungen an die Kirche zu Einigen, dass öfters alte Jahrzeitbücher, auf die stets verwiesen wird, und Donationenrödel benutzt worden sind. An einer Stelle der Chronik ist sogar deutlich gesagt, dass die lateinische Vorlage ein Anniversarium war: der Kirchengüter im Paradies seien so viele gewesen (wie das lateinische Abschriftbuch innehält), als Tage im Jahr. So viel über das lateinische Buch, das der Stretlinger Chronik den Stempel einer grösseren und ehrwürdigen Tradition aufdrücken soll.»7
Auch wenn die Strättliger Chronik noch heute als nicht glaubwürdig gilt, fand ich bei meinen Forschungen sehr viele Wahrheiten. Ich weiss, dass sehr viel übernommen und auf Einigen zurechtgeschrieben wurde. Aber etliche Begebenheiten können nachvollzogen werden und stammen mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht aus der Fantasie Kiburgers. Es würde aber den Rahmen dieser Arbeit bei weitem sprengen, dieses Thema zu ausführlich zu bearbeiten.
4 Ernst von Känel, Streiflichter zur Christianisierung des Thunerseegebietes und der angrenzenden Regionen, S. 33–34, Berlin Pro Business 2005
5 Die Stretlinger Chronik, Ein Beitrag zur Sagen- und Legendengeschichte der Schweiz aus dem XV. Jahrhundert, S. 31-34, Dr. Jakob Baechtold, Verlag von J. Huber, Frauenfeld 1877
6 Dr. Jakob Baechtold, Die Stretlinger Chronik, S. XXXVII – XLVIII, Verlag von J. Huber, Frauenfeld 1877
7 Dr. Jakob Baechtold, Die Stretlinger Chronik, S. XLVIII, Verlag von J. Huber, Frauenfeld 1877