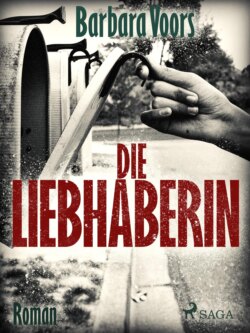Читать книгу Die Liebhaberin - Barbara Voors - Страница 10
3. Februar 1999
ОглавлениеIch sinke auf einen Stuhl im Frauenumkleideraum der Konzerthalle. Denke zurück an das Kaffeetrinken mit Johannes. Es war wie ein Fieber, denke ich verwundert, das meinen Körper durchfuhr und mich aufgewühlt zurückließ, bevor es zum nächsten weiterzog. Unsere Stimmführerin, die erste Cellistin Marianne, ist eine schmale, ältere Frau mit harter Stimme. Sie kommt herein und wirft mir einen kurzen Blick zu. Sie ist zum Teil für die Leistungen von uns Cellisten verantwortlich. In letzter Zeit erschien sie mir irgendwie wachsam, als hätte sie mich besonders im Auge.
»Mir geht es gut«, sage ich nachdrücklich, sie hat nichts gefragt. »Was proben wir heute?« fahre ich fort, bin mir aber sofort peinlich bewußt, daß ich längst geübt haben sollte. »Ich meine, was nehmen wir als erstes?«
»Wir werden einen Trauermarsch spielen«, antwortet sie kurz, »Mahlers fünfte.«
»Natürlich«, sage ich und gehe hinaus, um das Cello aus dem Instrumentenschrank zu holen.
Sie kommt hinterher. Eine kurze Aufforderung ertönt aus dem Lautsprecher: »Zur Orchesterprobe auf der Bühne Platz nehmen.«
»Wie steht es, Molly? Du scheinst Schwierigkeiten zu haben, dich ... zu konzentrieren.«
»Es ist wegen meinem Sohn Marvin. Und vielleicht auch wegen meiner Tochter, Rosanna, ja, du weißt.«
Ich verstumme, als ich ihren irritierten Blick sehe.
»Du meinst die Arbeit. Nur eine Flaute. Du hast selber gesagt, es gibt bessere und schlechtere Tage.«
»Freilich. Sieh nur zu, daß jetzt die besseren kommen«, sagt Marianne.
Erst als wir schon auf der Bühne sind und auf unseren roten Samtstühlen direkt vor dem Dirigentenpult Platz genommen haben, verstehe ich die Warnung. Auf der linken Seite, schräg vor uns sitzen die zweiten Geigen, rechts die ersten Geigen und dazwischen die Bratschen. Einige Plätze schräg hinter mir sitzt Johannes mit seiner Trompete. In meinem Rücken befinden sich außerdem die Holz- und Blechbläser, weiter hinten die Schlagzeuge und seitlich davon die Harfe, und zuallerletzt folgen die Kontrabässe.
Der Konzertmeister erhebt sich, und wir stimmen die Instrumente. Dann betritt unser Chefdirigent Maarten van Eijken den Raum, ein höflicher Mann in den Sechzigern, mäßig ehrgeizig (für mich genau richtig), der seit fünf Jahren in der Stadt wohnt. Sehr freundlich, erhebt nie die Stimme, was auch gar nicht nötig ist. Das Orchesterleben kennt keine demokratischen Abstimmungen oder Ausbrüche, zumindest nicht hier auf der Bühne. Dirigenten sind oft etwas langhaarig, damit die graue Mähne im Takt der Musik schwingen kann. Ansonsten erscheinen sie in schwarzer Hose und Rollkragenpullover, das ist auch Hermans Alltagsuniform. Im Orchester sitzen allerlei Männer mit Brille, Bart und schütterem Haar, die jüngeren sind frischere Kopien der älteren. Die meisten jüngeren Frauen sind auf eine seltsam nichtssagende Weise schön, und die älteren wirken proper und irgendwie gut gehalten.
Jetzt konzentrieren wir uns, diese Gruppe von Menschen, die im besten Fall wie ein Musikkörper, bei dem alle Teile äußerst empfänglich sind, funktioniert, und die sich im selben Takt in dieselbe Richtung bewegen, wobei keine Einschnitte oder Fehlstriche zu hören sind. Das zu erreichen ist phantastisch, aber der Weg dorthin ist zuweilen schmerzlich lang.
Wir beginnen zu spielen. Zuerst Johannes, der seine Trompete aufnimmt und eine Art Todesfanfare erklingen läßt, lang und anhaltend, die Geigen fallen ein, wie Stimmen aus dem Jenseits, ein kurzes Abwarten, dann schließen wir Cellisten uns an. Wir gleiten sachte hinaus auf das Meer, wohl wissend, daß dieses Schiff sinken wird, doch weshalb sollte man jetzt umkehren? Das Wiegen wirkt beruhigend: Laß mich hier los, sinke mit mir, senke mich ins Meer, bis ich den Griff löse, ziehe mich über das Seegras am Meeresgrund. Jetzt die Holz-und Blechbläser, dann die Harfe, erst ganz schwach, danach stärker, Tempo, weine zusammen mit mir, denn bald gibt es mich nicht mehr, wir kennen den Schluß, weshalb dann die Klage? Der Trauermarsch. Alle werden wir auf diesem Weg ausgelöscht werden. Jetzt höre ich die Trommel. Kurz, wie ein Klopfen nur. Wer da?
Ich zucke zusammen, als der Dirigent die Arme für eine Unterbrechung hebt. Woran denke ich!? Konzentration, Molly. Eine Instruktion vom Dirigenten: »Kann ich die Fagotte noch einmal hören? Etwas klarer dort. Stärker. Wir beginnen noch einmal von vorn. Alle zusammen, meine Damen und Herren.«
Wir kommen in Gang. Halten inne. Eine weitere Instruktion, ständiges Wiederholen, Ungeduld macht sich breit. Es ist, als hätte die Platte einen Kratzer. Blas doch einer den Fussel unter dem Tonabnehmer weg, und plötzlich sind wir wieder auf dem Weg. Die Bogenstriche folgen unserer Atmung, ein und aus. Die Hände des Dirigenten erneut ausgestreckt für eine Unterbrechung.
»Denken Sie daran, daß hier Schwere zu spüren ist. Also langsam. Sie kommen zu schnell. Noch einmal? Jetzt aber besser.«
Er benutzt seinen Körper zur Illustration dessen, was er uns sagen will, während wir spielen. Die Musik spiegelt sich in seinem Gesicht: Stärke, Schwäche, Schönheit, Trauer, Unzufriedenheit. Mit seinem ganzen Körper versucht er zu vermitteln, was er von uns will, mal erhebt er sich kraftvoll, mal setzt er sich still hin und schließt die Augen.
Wie Vögel im Käfig bewegen sich seine Hände durch die Luft, immer im Kreis.
Wir nehmen erneut Anlauf. Ich habe Schwierigkeiten mitzuhalten. Meine Finger fühlen sich schweißnaß an und rutschen auf den Saiten, der Bogen in meiner rechten Hand wird schwer, als wollte er zu Boden fallen. Mein einer Fuß ist eingeschlafen, wirkt wie tot unter mir. Sicher habe ich gewußt, daß keiner entkommen kann. Aber woher diese plötzliche Fixierung? Schweiß rinnt zwischen meinen Brüsten, wenn ich nur einen Moment loslassen und ihn wegwischen könnte. Unter dem Pony Hitze, wie Kleister. Ich versuche die Haare nach oben zu blasen. Der Cellist, mit dem ich den Notenständer teile, zuckt zusammen. »Wo sind wir?« frage ich plötzlich. Ein rascher Blick zur Stimmführerin und dann wieder auf die Noten. Unterbrich uns doch, denke ich verzweifelt. Sonst bricht er an dieser Stelle immer ab, statt dessen erwartet er ein Fließen, und ich bin nicht dabei.
Jetzt stoppt er die Sache endlich, und ich bemerke, daß ich seit langem aufgehört habe zu spielen. Der Bogen hat sich nur in der Luft bewegt, und die Finger sind wie im Krampf erstarrt. Mein Fuß ist noch immer gefühllos.
»Mein Fuß«, flüstere ich meinem Nachbarn zu.
Ein Blick von der Stimmführerin, sie beugt sich vor: »Bist du krank?«
»Nein, mir gehts gut.«
Was ist nur mit mir? Eine Menge Lämpchen an der Decke der Konzerthalle, wie symmetrisch ausgestreute Sterne am Himmelsgewölbe. Über uns die Scheinwerfer.
»Danke«, flüstere ich.
Danke wofür? Schweigend hat der Dirigent den Taktstock niedergelegt. Bald wird er sagen ... o, ich ertrage es nicht: »Darf ich die Cellostimme noch einmal hören?« Ich stehe rasch auf.
»Du hast recht, ich bin krank. Ich höre auf für heute.«
Ich räuspere mich und sage zu den verblüfften Kollegen: »Das geht vorbei. Nur etwas Fieber.«
Als ich mich, das Cello vor mir her tragend, zwischen den Musikern hindurchzwänge, begegne ich Johannes’ Blick. Er errötet leicht, ich ebenfalls, ein Lächeln wie um zu sagen »Fieber«?
Wie immer, wenn ich mich rastlos oder unsicher fühle, will ich in Geschäfte gehen. Ich schließe das Cello ein und eile rasch aus der Konzerthalle, damit mich niemand fragen kann, was passiert ist. Einfach nur ein schlechterer Tag. Schwindel, Wallungen, Schweißausbrüche, was weiß ich? Mein Körper spielt mir einen Streich, und ich bin nicht mehr in ihm zu Hause. Ich bin ausgezogen, und er bewegt sich ohne mich. Nur ein Hut, ein Kleid, eine Polstergarnitur sind vonnöten – dann bin ich wieder wie neu.
Wie ein Barbar, der in eine verwüstete Stadt einzieht, nehme ich mich der Sache an. Viele Jahre Training haben aus mir so etwas wie eine Expertin gemacht. Anfangs war es das Geld meiner Eltern, das mir zusetzte, ich wollte es in Umlauf bringen. Ein seltsamer Neid auf Freunde, die am Monatsende mit tiefen Seufzern darüber klagten, daß sie sich voneinander Geld leihen mußten. Ich vermißte diese Kameradschaft des Mangels, und das machte mich geschmacklos großzügig oder boshaft geizig.
Dann kam Herman und verlangte, verlangt es noch immer, dafür bezahlen zu dürfen, daß ich unser Leben dekoriere und ihm einen geschmackvollen Rahmen gebe. Um es der Welt zu beweisen. Und genau das habe ich in den jetzt bald fünfzehn Jahren getan. Ich habe gemalert und tapeziert, abgerissen und aufgebaut, möbliert und neu möbliert, den Tischler bestellt und abbestellt. Die Kinder kamen rasch, und dadurch gab es ungeahnte Möglichkeiten für neue Einkäufe: Wickeltische, Regale, Sonntagskleidung, Overalls, Latzhosen, Teddybären, Puppenwagen, Schlittschuhe, Helme, Schlitten und Computer. Es hörte nie auf. Die Kinder wurden die Nabe, um die sich unser Konsum drehte. Und als sie selbst anfingen, sich um die Sache zu kümmern, kehrte ich zu meinem eigenen Verbrauch zurück. Aber noch immer muß ich mich beherrschen, wenn Rosanna in schlecht aufeinander abgestimmten Kleidungsstücken ins Zimmer kommt. Nur ein bißchen daran herumfingern, die Farbskala erklären dürfen. Was Marvin trägt, weiß ich nicht mehr. Ich fühle Scham, betäube mich, kaufe ein. Tue so, als sei nichts, und nehme neuen Anlauf: Ein Kleid vielleicht oder sogar ein zweites?
Es ist Ausverkauf, und wir Konsumenten überfallen die Stadt wie ein Schwarm Heuschrecken die frische Saat. Es ist mein Versagen bei Marvin, das mich von Geschäft zu Geschäft treibt. Und auch das Problem mit meinem Job, mit der Musik, die mich im Stich läßt, mit meinen frierenden Fingern und mit mir, die stumm dasitzt und nicht mithalten kann.
»Ein schwarzes Top, vielleicht?« fragt eine Verkäuferin, die sich bestens darauf versteht, die beginnende Panik eines Kunden wahrzunehmen, der begreift, daß er nichts braucht: O bitte, bieten Sie mir irgend etwas an.
»Ein Top«, murmele ich, ohne ihr in die Augen zu sehen und betrachte das Teil, als sei es ein Meisterwerk, das ich von einer Kopie unterscheiden muß.
»Ein schwarzes Top kann zu fast allem getragen werden. Ich möchte behaupten, eigentlich zu allem«, sagt sie mit großer Geste in dieser intimen Kaufsituation.
Ich kaufe es. Ich kaufe, egal was es ist, und sie weiß es. Ich möchte mich betäuben. Zehn schwarze Tops und ein rosafarbenes, wenn sie es will. »Ein kleiner Hüftschmuck aus Pelz« geht auch noch mit. Keine Ahnung, was ich damit soll.
»Das Allerneueste«, fügt sie hinzu.
Ich habe Lust zu sagen: Das können Sie sich bei mir sparen.
»So was kriegt man immer los«, sagt sie unerwartet und zuckt selbst zusammen, wie ein Schauspieler, dem ein Satz aus einem alten Stück herausgerutscht ist.
Wir sehen uns betreten an, doch schon bin ich vor der Tür des Ladens, und schließlich habe ich ja bezahlt! Ich bin ein gehorsamer Konsument, und jetzt stehe ich mit all den Tüten da, die sich vor meinem Körper bauschen, ich schäme mich, wenn ich anderen Leuten mit genauso vielen Einkäufen begegne – doch kann ich einfach nicht damit aufhören.
Völlig verschwitzt und mit schmerzenden Beinen sitze ich schließlich im Bus nach Sjövik, die Tüten unbeweglich auf dem Sitz neben mir wie ein Haufen wohlerzogener Kinder. Ich schließe die Augen und warte auf die Sättigung, die sich nach jeder manischen Einkaufstour einstellt. Zusammen mit einem leichten, beharrlichen Gefühl der Scham. Genau das treibt uns wieder hinaus.
Der Bus durchquert winterdunkle Vororte. Ich schaue aus dem Fenster, und mein Gesicht liegt wie eine Projektion vor den Häusern, an denen wir vorüberfahren. Meine Augen in euren Häusern, meine Lippen streifen über die Autos, meine Hand drückt sich gegen die Scheibe, und ein ganzes Einkaufszentrum verschwindet. Dann steige ich an meiner Haltestelle aus, stelle die Tüten ab, um die Handschuhe überzuziehen, und in diesem Augenblick entdecke ich das Plakat. Es klebt neben dem Busfahrplan und ist größer als der Zettel, der in meinem Briefkasten steckte. Dieselben Herzen und jetzt auch Vögel, aber nirgendwo »Kann nicht genug bekommen«. Statt dessen ist das ganze Plakat mit einem wieder und wieder geschriebenen Satz bedeckt: »Wer ist der Besteller?«
Aber ich habe doch wohl nichts bestellt, ist mein erster Gedanke. Auch hier wieder diese Naivität der Illustrationen, dennoch aber ein bezwingender, repetitiver Stil, der alle kleinen Details berücksichtigt. Aus einer gewissen Entfernung muß es beinahe ein Muster ergeben. Ich weiche ein Stück zurück und richtig, von hier aus kann man nicht mehr erkennen, was dort geschrieben steht. Mit ängstlichem Kribbeln trete ich noch einen Schritt zurück, dann gleich noch ein paar, bis ich auf der gegenüberliegenden Straßenseite stehe. Jetzt sehe ich es. Schwach, aber dennoch deutlich entsteht aus Vögeln, Herzen und Schrift ein Name: »Molly«. Ich kneife die Augen zusammen und blicke noch mal hin. Den Kopf schräg gehalten. »Molly«.
Ich will nach Hause zu Rosanna. Fange an zu laufen. Muß die Tops anprobieren, ein Bad nehmen, Kerzen anzünden. Wiederum dieses Gefühl, beobachtet zu werden. Liebe Molly, da ist niemand! Einmal um die eigene Achse gedreht. Wie idiotisch, wie dumm. Ich renne jetzt, der Schnee klebt schwer unter meinen Füßen, als würde ich Wasser treten, weit vom Land entfernt.