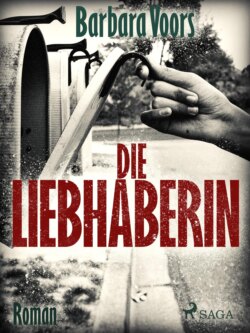Читать книгу Die Liebhaberin - Barbara Voors - Страница 9
26. Januar 1999
ОглавлениеIch glaube zu wissen, wann die Rastlosigkeit ihren Anfang genommen hat. Es war damals, als Marvin noch zu Hause wohnte, wir brauchten uns nur zu sehen, da wackelten die Wände ganz von selbst, zugleich aber arbeiteten wir verzweifelt daran, eine Familie zu sein. Herman war ausnahmsweise einmal daheim, und die Vorstellung, daß wir an einem Wochentag alle vier um den Abendbrottisch versammelt wären, ließ mich förmlich alles tun, um es uns ... ja, richtig gemütlich zu machen. Ich deckte den Tisch, wirbelte durch die Zimmer, flambierte, trug auf und legte vor. Elegant geschichtete Speisen auf vier angewärmten Tellern. Vier Stunden Mühe für zwanzig Minuten Gleichgültigkeit. Ich weiß noch, daß ich Hermans Blick suchte: Hilf mir jetzt. Aber er schien in Gedanken an die Arbeit versunken, diese Falte zwischen den Augen, die anfangs so hinreißend wirkte, ist heute so tief, daß sie nie mehr verschwindet. Alle kauten vor sich hin, und sonst war nichts zu hören. Doch dann legte Rosanna das Besteck hin und stand auf.
Endlich, dachte ich, endlich jemand auf meiner Seite.
»Mama, ich halte dein Gekaue nicht mehr aus. Ich ertrage es einfach nicht!«
Dann fing sie an zu weinen und lief aus dem Zimmer. Marvin zuckte die Schultern: »Was sagt ihr doch immer? Teenies, ja verdammt«, fügte er hinzu, als ob das nötig wäre.
Die Haustür schlug zu. Das sorgfältig drapierte Essen gefror auf meinem Teller. Herman schien verwirrt – wie jemand, dessen Auto im Straßengraben gelandet war und der nicht wußte, wie das hatte passieren können und wie er sich nun um seine Mitfahrer kümmern sollte.
»Gibt es Dessert, Molly?« brachte er heraus.
Ja, die flambierte Frau, wollte ich antworten, aber die Worte blieben mir im Hals stecken, ich kippte das Essen in den Mülleimer und ging.
Also Rosanna erträgt es nicht, mich kauen zu sehen. Auch eine Erkenntnis. Ich glaube sogar, sie erträgt mich überhaupt nicht mehr. Damals hatte es angefangen. Aber ja, ich weiß alles über die notwendige Loslösung von den Eltern und das Austesten von Grenzen, mir ist auch klar, daß man seine Kinder loslassen muß. Bei mir hat das aber das Gefühl ausgelöst, ich sei zwar zur Hälfte eine Mutter, die einfach alles aus vorbehaltloser Liebe tut, zur anderen Hälfte fühlte ich mich jedoch als Grenzwächter. Ich bin nicht dafür gemacht. Die Mängel einer Mutter – die sind irgendwie tabu. Die Abwesenheit des Vaters ebenso. Doch abwesende Eltern können sich den Luxus leisten, mit Unverständnis zu reagieren, wenn sie letztlich auftauchen.
An jenem Abend erschien Rosanna in unserem Schlafzimmer. Herman war wieder abgefahren, und sie stand zitternd in der Tür. Ich ging hin, wollte sie umarmen, doch merkwürdigerweise fiel ich auf die Knie, und sie wiegte meinen Kopf an ihrer Brust, während ich den Tränen freien Lauf ließ. Als hätten wir plötzlich die Rollen getauscht, ohne daß wir verstehen konnten, wie es dazu gekommen war. Nicht so, konnte ich gerade noch denken, vermochte jedoch nicht, damit aufzuhören.
Ich ziehe mich an, um zu den Proben zu fahren, die wir vor den zwei Konzerten dieser Woche haben. Normalerweise läuft die Sache folgendermaßen ab: Ungefähr vier Tage Probe (davor eigenes Üben), Generalprobe, vielleicht zwei Konzerte und dann ein paar Tage frei, bevor alles wieder von vorn beginnt. So ist es immer, und manchmal habe ich das Gefühl, daß sich alles unentwegt wiederholt. Nach fast zwanzig Jahren im Orchester ist das ja auch so. Dieses Programm mit diesem Gastdirigenten haben wir doch wohl schon gespielt? Moment mal, habe ich den Bogen gerade abgelegt oder muß ich ihn jetzt aufnehmen? Wie bei einer Ehe, die zum Totentanz geworden ist: Dieselben Sätze werden wieder und wieder gesagt, du bist müde, und ich bin sauer, die Kinder hängen herum, und das Wetter ist mies, du beleidigst, und ich weine ... Mein Gott, das haben wir doch alles schon gehabt? Diese Worte gehen mir durch den Sinn, wenn Herman und ich ein weiteres Mal über dieselbe Sache streiten. Genau dieses unangenehme Gefühl habe ich heute auch bei meiner ehemals so geliebten Arbeit. Aber das haben wir doch schon gespielt! Ich betrachte die neuen Musiker im Orchester mit derselben Aversion, die ich den Werbeplakaten entgegenbringe. Ich beneide sie um ihren Enthusiasmus und ihr Können. Aber ich sehe auch ihre Blicke, darin liegt kein Neid. Ich weiß sehr wohl, daß ich nicht dasselbe Niveau halte wie früher.
Angefangen habe ich als eine Art Wunderkind. Eine Fünfjährige, die am Klavier saß und mit Leichtigkeit Mozart spielte, absolutes Gehör und baumelnde Beine in roten Sandalen. Es wurde geklatscht. Außerdem wie süß, mit diesem rabenschwarzen Haar. Meine Eltern trugen mich durch die Salons, selten streiften meine Füße den Boden. Doch seltsamerweise ist es mit dem Talent wie mit meinem alternden Körper: Die Paßform stimmt nicht mehr. Es war, als wenn ich in ihm nicht zur Reife gelangen konnte, und ich ahne, daß ich aus Faulheit und Selbstüberschätzung meine Gabe nie richtig verwaltet habe.
Ich sagte, daß meine Eltern mich getragen haben. Das taten sie auf jede erdenkliche Weise. Entzückt und verzaubert von diesem Talent, in die Welt gesetzt von unmusikalischen Eltern, bereiteten sie mir einen Platz im Leben. Sie gingen vor mir her und bahnten mir den Weg, schnitten die Dornen ab. Nichts, woran man sich stechen konnte. Privatschulen, ausgewählte Lehrer und ständige Rückenstärkung. Ich ging zum Cello über, was noch besser lief. Eine Karriere als Solistin lag vor mir, so hieß es. Ich wurde getragen und übte, übte und wurde getragen. Sicherheitshalber gaben mir meine Eltern frühzeitig ein Erbe, genau so viel, daß ich mich nie um Geld kümmern mußte. Ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden man in einem Kiosk stehen muß, um das Geld für eine Reise beisammen zu haben. Theoretisch weiß ich es schon, aber ich weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ich ahnte nicht, wie schädlich dieses Nichtwissen sein kann.
Ich sagte, ich wurde getragen, emporgehoben ist ein besseres Wort. Ich wurde über und durch das Leben gehoben. Vermutlich ist es dasselbe wie bei der Leidenschaft. Das Leben ist mir immer widerfahren, ich bin nie selbst darauf zugegangen. Dinge sind geschehen, und ich habe sie geschehen lassen, meine aktiven Entscheidungen sind gering an der Zahl. Kreuzten irgendwelche Möglichkeiten meinen Weg, stellte ich mich in die richtige Richtung, um mitgesogen zu werden, und wenn jemand die Tür zuschlug, habe ich aufgepaßt, daß ich auf der richtigen Seite landete.
Als Zwanzigjährige bewarb ich mich beim traditionsreichen Orchester der Konzerthalle als Cellistin und wurde angenommen. Davor hatte man schwierige Prüfungen hinter Stellwänden abzulegen, ich übte schändlich wenig und wurde sofort für ein Probejahr eingestellt, das ich spielend bewältigte. Der Gedanke war wohl, daß ich Erfahrungen sammeln und dann meine Karriere als Solistin fortsetzen sollte, doch waren das die Ambitionen meiner Eltern, nicht meine eigenen. Ich bin nie ehrgeizig gewesen und ahnte frühzeitig, daß mein Talent eins von der verblassenden Art ist. Noch einmal: Mir widerfahren Dinge, aber ich gehe nicht auf sie zu. Ich bin nicht wie Herman, ich bin kein Aufsteiger. Also blieb ich im Orchester mit seinen festen Anstellungen und seiner Sicherheit. Ein paar vielbeachtete Auftritte als Solistin hatte ich hinter mir, und die hatten stets ein gewisses Sättigungsgefühl erzeugt. Die Scheinwerfer wurden schließlich wieder ausgeschaltet, und wie lange reichte das Lob anderer? Ich hatte keinen Ehrgeiz, so wie Herman ihn hatte. Und ich mußte auch niemanden versorgen, kein ganz unwichtiger Umstand.
Als ich einundzwanzig war, starben meine Eltern bei einem Autounfall, und damit trieb mich niemand mehr an. Das Orchester wurde meine Familie, und ich hatte Freude am Spielen, alle anderen Pläne wurden ad acta gelegt. Und dann kam Herman. Er war zielbewußt, ich war seine junge Trophäe, und wir hatten einen Hof um uns herum, der wie ein bequemes Schutzdach wirkte. Uns machte der Regen nicht naß, uns sollte es an nichts mangeln. Kann man von einem vergeudeten Talent sprechen? Ich übe nur gerade so viel, wie notwendig ist. Was mich beklommen macht, sind die Blicke der neuen Musiker. O, ich weiß genau, was sie denken. Wenn man mich heute hinter dieselbe Stellwand zum Probespielen für meinen Orchesterplatz setzte, käme ich dann überhaupt bis in die zweite Runde?
Ich habe keine Ahnung, wohin das führen soll, daß man sich in den eigenen Schwächen wälzt, zumal ich wohl mehr über mich weiß, als Rosanna zu glauben scheint. Doch im Unterschied zu den jungen Leuten unter Zwanzig habe ich keine Freude daran, die Dinge zu drehen und zu wenden. Was mich beunruhigt, ist das Bild, das ich von mir selber habe. Mir scheint: Je mehr ich schreibe, desto schwieriger wird es, daran festzuhalten, daß ich eine gute Mutter, eine erfolgreiche Musikerin und eine glückliche Ehefrau bin.
Die Musik führte Herman und mich zusammen, das habe ich wohl schon gesagt. Noch bevor die Leidenschaft uns packte, was sie eigentlich sofort tat. Ich glaubte, daß unsere leidenschaftliche Liebe genauso lange währen würde wie die zur Musik. Jetzt bin ich mir bei keiner von beiden mehr sicher. Aber ich glaube, daß die Musik eine Sehnsucht nach Schönheit und Vollendung ausdrückt, die, wie wir wissen, das Leben nie bieten kann – außer in den großen Momenten. Man sucht die Nähe zur Musik, in der Hoffnung, diese Augenblicke wiederzuerhalten, einen Schimmer vom Paradies. Und wir Musiker sind dabei der verlängerte Arm der Schönheit und bezahlen einen Preis dafür: Tinnitusprobleme, Schmerzen in Rücken und Schultern sowie bei einigen von uns eine verschlissene Lippenmuskulatur. »Ergonomischer Wahnsinn«. Mit dieser Bezeichnung beschrieb ein älterer Kollege einmal das Leben in einem Orchester. Kraß, dachte ich, aber vergaß seine Worte nicht. Oftmals habe ich gedacht, daß es mit der Musik wie mit der Liebe ist: Bestenfalls besteht sie aus einer Abfolge von Bewegungen, die ein tiefes Glücksgefühl erzeugen, andere Male wieder ist sie ein wildes Durcheinander von Mißverständnissen und falschem Tempo, bei dem die Bewegungen, die wir in der Hoffnung auf Nähe ausführen, meist nur Lächerliches ergeben.
Aber noch immer berührt mich die Musik tief. Manchmal, wenn ich spielfrei habe und die Garderobenfrauen im Foyer sehe, die mit geschlossenen Augen das Spiel des Orchesters über Kopfhörer verfolgen, dann packt sie mich. Sie hebt mich empor von dem Platz unter den Marmorsäulen, wo ich stehe, führt mich weit weg. Aber dann verklingt das Tönen, ich bin zurück am selben Ort, öffne die schweren Glastüren der Konzerthalle zum Markt mit der kolossalen Skulptur und lasse die Musik hinter mir.
Ich höre es draußen auf der Straße hupen, es ist das Auto, das mich in die Stadt mitnehmen wird. Kristin Roberts steigt aus und winkt. Langes blondes Haar zu einem Büschel hochgebunden, 32 Jahre alt und zwei kleine Kinder irgendwo zwischen zwei Jahren und den ersten ausgefallenen Milchzähnen. Wenn wir uns sehen, scheinen die Arme der Kleinen geradezu um ihren Körper festgezurrt. Wie sie es nur packt. Wie habe ich es nur gepackt! Wir verdrängen, ja verdrängen sogar, daß wir es tun. Aber Kristin sieht großartig aus, dieses strahlende Lächeln.
»Die Kinder«, sagt sie immer, als würde schon das Wort allein Kursivschreibung erfordern. Sie sind ihr ein und alles, will sie damit sagen. Ich bin beeindruckt und erschrocken, beides zugleich. Sicher habe auch ich geliebt, aber so ...
Kristin bewegt sich vor einem Hintergrund von Brei, der ist zu sehen, wenn wir uns treffen, Flecke von Aufgestoßenem, und ich will nicht wissen, wovon sonst noch, auf ihrer Schulter. Sie springt bei einem professionellen Chor ein, der ab und zu mit unserem Orchester singt. Sie hat eine phantastische Stimme; nutzt sie nur nicht völlig. »Die Kinder kamen dazwischen«, so sagt sie. Es ist kein Jammern, nur eine Feststellung. Dafür bewundere ich sie. Eigentlich ist sie meine einzige Freundin hier draußen, ich sollte sie ordentlich festhalten. Ich behandle sie wie eine kleine Schwester, mal mit Liebe, dann wieder lasse ich sie meine Macht spüren. Wie ich es auch bei meinen anderen wenigen Freunden tue.
»Mal rauszukommen!« ruft sie und umarmt mich kurz.
Sie hört sich an wie eine Strafgefangene bei ihrem ersten Ausgang.
»Mir ist, als wäre ich zwei Wochen nicht aus dem Haus gewesen«, fährt sie fort und hält mir die Autotür auf.
»Anstrengend«, erwidere ich mit einem Nicken.
»Nicht, daß ich klagen will.«
»Nein, Gott bewahre.«
Darüber lachen wir. Sie hat ein schönes Lachen, ist übrigens eine sagenhaft schöne Frau, das sagte Herman zu ihrem Mann Johannes, der seit gut einem Jahr mein Kollege im Orchester ist.
Ich fange an zu lamentieren, das tue ich immer, wenn ich mit Kristin zusammen bin. Über Rosannas störrische Art, über Hermans Abwesenheit und dann über Marvin, von dem ich behaupte, ich könnte nicht über ihn reden, aber natürlich tue ich es dennoch.
»Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, Molly«, sagt sie mit einem Blick in den Rückspiegel, wobei sie die Spur wechselt, um auf die Autobahn abzufahren, »keiner von uns kann alles bewältigen.«
Außer dir, denke ich mürrisch.
»Wer hat von schlechtem Gewissen geredet?«
»Niemand. Ich hatte nur den Eindruck.«
»Wer hat herumgeschrien, er möchte früher aus dem Haus kommen?« erwidere ich rasch.
Immer dasselbe: Ich öffne die Tür sperrangelweit, werde übertrieben privat, und dann ziehe ich sie krachend zu, klemme Finger ein. Keiner kommt mir hier herein. Wir fahren schweigend weiter.
»Habt ihr auch so einen merkwürdigen Zettel über die Midlife-crisis bekommen?« bemühe ich mich.
»An alle Mitmenschen in Sjövik? Gibt es da so viele? Mitmenschen, meine ich. Vielleicht hat sie gerade das gemeint.«
»Sie?«
»Ich fand, es sah aus wie die Schrift einer Frau. Aber was weiß ich.«
»Rede weiter«, sage ich, überrascht von meiner eigenen Aufforderung. »Was hast du noch gesehen?«
Sie denkt nach.
»Daß diese fliegenden Menschen mich an eine Ausstellung erinnerten, die ich mal in London gesehen habe. Es waren Zeichnungen, die von Patienten deutscher Nervenheilanstalten aus den vierziger Jahren stammten. Darunter gab es schmucke, exakte kleine Kalender, in denen ein Patient alle künftigen Daten und Wochentage für hundert Jahre im voraus berechnet hatte. Dieser Zettel hat mich an die Ausstellung erinnert«, sagt sie mit einem Schulterzucken.
»Und der Text?«
»Über den habe ich nicht viel nachgedacht. Irgendwas über die Midlife-crisis. Das wirkt ein bißchen ... weit weg«, sagt sie.
»Ich verstehe. Weit weg, das ist natürlich der richtige Ausdruck.«
Wir parken neben der Konzerthalle. Vor unseren Füßen liegt der große Platz, in der Winterkälte senkt sich das Grau der Statue auf uns herab. Kristin eilt zu ihrer Arbeit, und ich gehe in den Marmorsaal, die Brüste der Figuren zeigen in meine Richtung, im Hintergrund übt jemand eine Tonleiter. Johannes Roberts ist seit langem vor Ort: groß, gut aussehend und liebenswürdig auf eine so passende Weise, daß es zuweilen unpassend erscheint. Er besitzt einen welpenhaften Charme, dieses leicht Hilflose, das dennoch immer korrekt ist. Er wirkt ständig verwundert: daß er eine so schöne Frau hat, so nette Kinder, die Villa in Sjövik und seine Arbeit. Als würde er mitten in all dem mit großem Erstaunen aufwachen, was ihn hin und wieder danebengreifen läßt. Im Orchester werfen ihm viele Frauen verstreute bewundernde Blicke zu, ein Solotrompeter mit solchen Oberarmen und einem Waschbrettbauch.
Johannes hat sich vor der Begegnung mit dem Dirigenten eingespielt. Er ist noch jung, denke ich mit gewissem Sarkasmus und schäme mich. Wir nehmen jeder eine Tasse Kaffee und setzen uns schweigend. Ich gähne, wir haben nicht viel gemeinsam außer der Musik, und auch die kaum.
Im selben Moment überfällt es mich. Dasselbe Gefühl wie beim Lesen des kopierten Zettels: Unruhe und Übelkeit. Ich blicke in die Kaffeetasse, als sei die Antwort darin zu finden. Ich schlucke und schlucke, als hätte ich Gras im Hals.
»Molly, Liebe, was ist mit dir? Bist du krank?«
»Nein, überhaupt nicht. Es ist nur ...«, ich suche nach geeigneten Worten, »irgendwas stimmt nicht.«
Etwas im Augenwinkel, ich drehe mich hastig um. Niemand dort. Jemand in Schwarz, etwas ist dort gewesen. Ich schüttle mich.
Johannes legt seine Hand auf die meine, die Übelkeit verschwindet. Statt dessen ein leichtes Schwindelgefühl, wir holen beide rasch Luft. Seine Hand, mein Blick in seinem Blick. Dann ist sie da: die Begierde. Sie überrascht uns beide, wir stehen auf, Tassen kippen um, und wir murmeln etwas von Probe und gehen auseinander.
Eiskaltes Wasser über heiße Wangen. Das Überraschendste von allem? Hatte es sich so angefühlt? Ewigkeiten her, ein Erwachsenenleben lag dazwischen. Ein schmerzliches Gefühl des Verlustes. Ich hatte es vergessen: Der wichtigste Bestandteil der Begierde ist die Freiheit. Ein überwältigendes Gefühl von Freiheit.