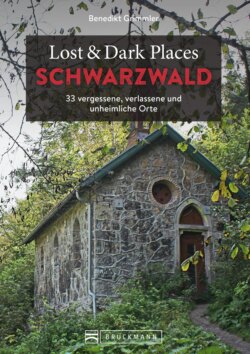Читать книгу Lost & Dark Places Schwarzwald - Benedikt Grimmler - Страница 21
ОглавлениеDAS GARTENHAUS – Der Landkomtur des Deutschen Ordens Johann Franz Freiherr von Reinach, seit 1688 Herr auf Beuggen am Rhein, hätte sich wohl nicht träumen lassen, was einmal aus seinem kleinen barocken Teehaus werden würde, als er es 1694 im hübsch angelegten Schlosspark errichten ließ. Seit 1246 saßen die Ritter des Ordens auf der Burg am Ufer, stürmische Zeiten waren schon über das Anwesen hingegangen, das noch immer einen wehrhaften Eindruck macht, einst gut geschützt durch eine halbkreisförmige turmbestückte Mauer mit Wassergraben um das Haupthaus mit Kirche. Doch zu Reinachs Tagen waren die Zeiten rauer Kreuzzugstypen vorbei, der Orden diente vor allem der Versorgung adliger Söhne und die mochten es, wie Reinach, eher repräsentativ. Beuggen, Sitz einer Kommende, wurde barock umgebaut, mehr Residenz als Wasserfestung.
Im Jahr 1806 musste der Orden seinen Besitz aufgeben, das badische Herzogtum verleibte sich das Schloss ein, wusste aber nichts damit anzufangen, außer einen Großteil des wertvollen Inventars zu Geld zu machen. 1814 wurde die Region Kriegsgebiet, als die alliierten Truppen gegen Napoleon nach Frankreich zogen. Beuggen wurde zu einem der vielen improvisierten Feldspitäler (siehe Tennenbach, Kapitel 31), in denen katastrophale Zustände herrschten. Wer hierhergebracht wurde, konnte im Prinzip nur noch sein Testament machen: völlig überbelegt, aber unterversorgt, fanden Seuchen hier ideale Verbreitungsmöglichkeiten. Reihenweise starben die eingelieferten Soldaten. Dies ging bis 1815, an die 3300 Insassen hatten hier den Tod gefunden, an sie erinnert ein Denkmal von 1911. Das Gartenhaus spielte zu dieser Zeit eine makabre Rolle: Es diente als Lager für die täglich anfallenden Leichen, bevor diese in Massengräbern verscharrt wurden.
Wappen allerorten. Jeder Komtur hinterließ sein »Markenzeichen«.
DAS WAPPEN – Nach der Räumung des Lazaretts lag Beuggen leer und einsam am Wasser. Nur der Pfarrer der Schlosskirche lebte noch dort, die restlichen Gebäude waren nicht nur vollends leergeplündert, sie stanken und starrten auch vor Schmutz: eiter- und blutgetränktes Stroh moderte herum, die Bevölkerung mied den Ort, der weiterhin als Seuchenherd galt. Waren das nicht beste Voraussetzungen, um hier jemanden unbemerkt zu verstecken? Und so soll die Verschwörerclique am badischen Hof um die ehrgeizige Gräfin von Hochberg und Major Hennenhofer hier den vorgeblich toten, aber als Faustpfand am Leben erhaltenen badischen Erbprinzen ab 1815, weitab von der Residenz Karlsruhe, untergebracht haben. Drei bis vier Jahre muss der Junge damals alt gewesen sein, als er hier mit einer Kinderfrau, Anna Dalbonne, einzog. Sein Name: Kaspar Hauser. Sein Aufenthaltsort: Das Teehaus. Den Beleg für diese Theorie habe er viele Jahre später selbst geliefert. Nach seiner Auffindung in Nürnberg zeichnete Hauser aus dem Gedächtnis ein Wappen, das er schwach als an seinem früheren Gefängnis angebracht erinnerte. Hausers krakelige Wiedergabe zeigte eine Wappenform, in der sich rechts unten ein stehendes Tier, diesem links gegenüber drei Querbalken und über dem Ganzen zwei gekreuzte Schwerter zeigten, darüber eine Art Hut oder Krone mit Kreuz. War das nicht das am Teehaus angebrachte Schild unseres Landkomturs von Reinach? Kaum – die Übereinstimmungen entspringen eher der Fantasie, es gibt einen stehenden Löwen, es gibt (zwei) Balken, es gibt kleine gekreuzte Schwerter und eine Krone ohne Kreuz. Aber es waren ja viele Jahre vergangen und Hauser mochte manches vergessen oder verwechselt haben.
Repräsentativ oder wehrhaft: Was ging hinter den Toren Beuggens vor?
DIE FLASCHENPOST – Schließlich war da die Flaschenpost, deren Existenz nicht zu bezweifeln war. Ein elsässischer Schiffer hatte sie am 22. September 1816 bei Kembs aus dem Rhein gezogen und den Behörden übergeben. Sie ging bis nach Paris ins Polizeiministerium, doch schlau wurde man aus dem lateinisch abgefassten kurzen Text nicht so recht: Cuicumque qui hanc epistolam inveniet: Sum captivus in carcere, apud Lauffenburg, juxta Rheni flumen: meum carcer est subterraneum, nec novit locum ille qui nunc folio meo potitus est. Non plus possum scribere, quia sedulo et crudeliter custoditus sum. Zu Deutsch: Wer auch immer diesen Brief findet: Ich werde in einem Kerker bei Lauffenburg am Rhein gefangen gehalten: Mein Kerker liegt unter der Erde, und den Ort kennt derjenige nicht, der sich nunmehr meines Blattes bemächtigt hat. Mehr kann ich nicht schreiben, da ich sorgfältig und grausam bewacht werde. Nun, folio war ein Lesefehler, es handelte sich um das alte lange S: solio, »des Thrones«, war wohl gemeint. Doch am rätselhaftesten war die Unterschrift: S. Hanès Sprancio. Hinzu kam, dass das Original des Zettelchens verloren ging und nur noch eine amtliche Abschrift von 1816 direkt nach der Auffindung als halbwegs verlässlich gelten kann. Aber S. Hanès Sprancio, war das nicht eindeutig ein Anagramm von »Sein Sohn Caspar«? Oder lautete die Unterschrift gar Hares Sprauca? »Caspar Hauser«. Klarer geht es kaum. Allerdings deutete mancher den Schriftzug eher als Haeres Franciae, »Erbe Frankreichs«, wo ebenfalls Thronstreitigkeiten herrschten. Schließlich saß der vermutete Kaspar Hauser zwar angeblich tatsächlich nahe Laufenburg, eben in Beuggen, in Gefangenschaft, aber nicht in einem Kerker unter der Erde, sondern in dem uns wohlbekannten kleinen hübschen barocken Teehaus im Park. Von dort wurde er, so die Legende, nun schleunigst weggebracht.
Das besondere Erlebnis
Nicht weit entfernt vom Schloss, im Ortsteil Riedmatt direkt am Rheinufer, liegt die Tschamberhöhle. Beim Bahnbau verschüttet, später wieder zugänglich gemacht, ist die seltene Muschelkalkhöhle von einem Bach durchflossen, der sie auch weiterhin formt. Auf gut 600 (von insgesamt 1600 bislang erforschten) Metern kann sie besichtigt werden, der Besucherrundgang endet an einem faszinierenden unterirdischen Wasserfall. www.tschamberhoehle.info/de
Hat auch Kaspar Hauser hier (heimlich) gespielt?