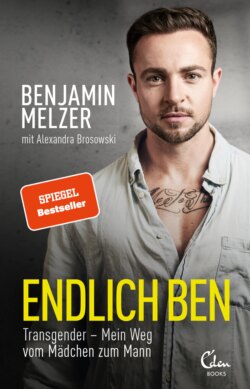Читать книгу Endlich Ben - Benjamin Melzer - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеManchmal war ich Finn oder Chris, meist aber Max – jedoch niemals Yvonne. Meinen Geburtsnamen sagten nur die anderen. Meine Familie, Freunde, Lehrer. Keine Ahnung, wo ich diese Jungennamen aufgeschnappt hatte. Damals war ich drei oder vier Jahre alt, und diese Namen quollen aus meinem Mund heraus wie die Papierschlange aus einer Kasse. Wie bestellt. Daran erinnern sich auch meine Eltern – widersprochen haben sie mir nie. Sie hielten es für einen »Spleen«, eine »Kleinkindmacke« und irgendwie für »niedlich«. Das galt auch für meine Lieblingsklamotten und meine Vorlieben beim Spielen. Pink, Glitzer oder Schmuck? Um Himmels willen! Eine Geschichte, die auf Kaffeekränzchen mit Omas und Tanten gerne unter dem Motto »Typisch Yvonne!« zum Besten gegeben wurde: Klein Yvonne konnte gerade laufen und steckte in einem Kleidchen mit großem Spitzenkragen. Dieser wehte ihr immer wieder ins Gesicht, was sie so wütend machte, dass sie mit hochrotem Köpfchen versuchte, ihn mit ihren Händchen abzureißen, begleitet von hysterischem Kreischen. Von da an waren solche Kleidchen mit Kragen tabu.
Also weder Kleidchen noch Püppchen, stattdessen immer burschikos und zum Raufen aufgelegt. Ich war so ein typischer Wildfang.
Tief in mir hockte bereits meine eigene Wahrheit. Irre, wie früh die Seele weiß, dass da etwas schiefgelaufen ist.
Eine Stimme im Kopf flüstert dir die Wahrheit zu. Sie wird immer lauter. Aber du bist eben noch viel zu klein, um ihr Gehör zu schenken. Du verstehst nicht, worum es geht und was anders ist. Da sind nur diese lauten Stimmen in dir, die was anderes schreien als das, was wahr sein soll. Ständig dieser große Konflikt in dir: Äußerlich bin ich ein Mädchen, innerlich ein Junge.
Das rosa oder hellblaue Etikett wird einem schon im Kreißsaal verpasst. Ist auf eine Art auch gut so, damit es zu keiner Verwechslung kommt. Doch ich bin falsch etikettiert worden. Rosa gelabelt, obwohl ich eigentlich in die blaue Ecke gehöre. Ich bin zwar noch nicht Vater, kann mir aber gut vorstellen, wie dieser Tag für meine Eltern gewesen sein muss. Natürlich haben sie mir alle Geschichten von meiner Geburt erzählt. Wie stolz und froh sie damals waren. Und dann dieser besondere Moment im Kreißsaal: Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Die Frage aller Fragen – denn in den 1980er-Jahren gab es diese 4-D-Ultraschallgeräte ja noch nicht. »Hauptsache gesund«, behaupten Eltern immer. Aber unbewusste und somit unausgesprochene Hoffnungen spielen eine Rolle. Was nun, wenn das geborene Mädchen eigentlich ein Junge hätte sein sollen? Ich aber hatte eine kleine Scheide zwischen den Beinen. Damit stand mein Etikett fest. Yvonne ist geboren!
Mein zweiter Vorname hätte »Ambivalenz« sein können. Da gab es das fröhliche, lustige, beliebte Kind mit der vorlauten Klappe. Und daneben immer auch das einsame, fragende, suchende Kind mit dem Kloß im Hals. Das frohe und beliebte Kind war stets sichtbar, das traurige konnte ich lange Zeit gut verbergen. Die Bühne meines Lebens war dafür auch wie geschaffen. Der Kulisse fehlte es an nichts. Tatsächlich bin ich extrem privilegiert aufgewachsen. Wir hatten sogar ein Ferienhaus in Spanien, eine eigene kleine Jacht und ein Sportflugzeug. Eine beachtliche Leistung von meinem Papa, der aus sehr einfachen Verhältnissen stammte. Ohne fremde Hilfe hatte er sich nach oben gekämpft und einen erfolgreichen Betrieb für Küchen- und Treppenbau gegründet. Mein Vater ist wahrlich kein einfacher Mensch, aber seine Energie und Zielstrebigkeit finde ich bemerkenswert. Als Kind genoss ich seine Stärke und Präsenz. Nicht so eine Luftpumpe wie so mancher Vater in meinem Freundeskreis.
Überhaupt war die Rollenverteilung bei uns zu Hause von außen betrachtet ganz klassisch. Alle Männer in meiner Familie sind Macho-Level 3000. Meine Mutter hingegen ist Frau durch und durch. So eine richtige Tussi, aber im besten Sinne. Schöne Kleidung, lange Haare, Schmuck und Make-up. Sie kann nicht mal mehr auf flachen Schuhen laufen, weil sie immer nur Pumps getragen hat. Meine Mama ist das weiblichste Wesen, das ich kenne, aber sie wollte aus mir niemals ein Abbild von sich machen. Als sie meine Abneigung gegen Rüschen, Glitzer und Co. bemerkte, hörte sie auf, mich wie eine Puppe auszustaffieren. Von Anfang an war sie meine Verbündete. Ob ich mich nun als Yvonne oder Max durchs Leben raufte. Ich kenne niemanden, der so liebevoll und zugewandt ist. In unserer Familie war sie für die Liebe und die gute Laune zuständig. Ganz klar: Das Herz habe ich von meiner Mutter geerbt, den Geschäftssinn von meinem Vater.
Unsere frühen Familienjahre waren ziemlich harmonisch. Kuscheln und auch baden mit Papa war total normal. Der Kampf zwischen uns begann jedoch, als er seinem süßen Töchterchen süße Kleidchen anziehen wollte. Nicht mit mir! Aber wenn mein Vater etwas nicht erträgt, dann sind das Widerstand und Machtverlust. Sein Bild von einer Tochter wollte er verständlicherweise nicht so einfach aufgeben …
Nur leider war seine Art, sich daran festzuklammern und mir zu zeigen, wer der Herr im Haus ist, oft sehr verletzend. Fragte ein Kellner zum Beispiel »Und was möchte Ihr Sohn bestellen?«, bellte mein Vater sofort los »Das ist ein Mädchen, das sieht man doch!«.
Am liebsten hätte ich mich in Luft aufgelöst oder zumindest unter den Tisch verkrochen, doch ich wollte nicht noch mehr Blicke auf uns lenken. Ein echter Horrortrip. Und je älter ich wurde, desto schrecklicher fühlte es sich an. Noch heute sind mir diese peinlichen Szenen präsent … Musste ich meinen Vater in ein Restaurant begleiten, nahm ich schon mit mulmigem Gefühl Platz. Mein Herz klopfte wie verrückt. Wenn der Kellner kam, senkte ich den Kopf, hielt die Luft an. Als was sah er mich? In mir tobte ein Kampf. »Ignoriere mich!«, schrie es aus einer Ecke, während es aus der anderen dröhnte: »Los, ich möchte als Junge gesehen werden!« Schaut alle her. Ich bin es. Max! Und bitte, bitte, Papa, halt einfach mal die Schnauze.
Doch Schnauzehalten lag meinem Vater aber überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Ein Melzer-Mann verlässt die Arena nur siegreich und niemals ohne einen letzten Spruch. Natürlich schön laut, damit auch ja niemand die Vorstellung verpasste. Sein Bass erfüllte die ganze Arena, und er führte die Worte wie Schwerter, die mich durchdrangen und zerfetzten. »Sind Sie blind? Das ist doch ein Mädchen!«
Der Hieb trieb mir die Schamesröte ins Gesicht. Mir war heiß. Eine unerträgliche Stille machte sich breit. Der Typ zurückhaltender Kellner fing an zu stottern und entschuldigte sich; der Typ vorlauter Kellner konterte: »Was? Das soll ein Mädchen sein? Ach, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht« oder: »Das glaube ich ja nicht!«
Prompt holte mein Vater zum nächsten Schlag aus. »Los, Yvonne, zeig deinen Ausweis!«
Meine Mutter hätte so etwas nie von mir verlangt. Never ever! Sie besitzt kluges Feingefühl. Bei meinem Vater hatte ich zunehmend den Eindruck, dass er sich sogar an meiner Scham weidete. Zumindest aber liebt er solche Psychospielchen. Doch mit jeder weiteren Machtdemonstration verlor er immer etwas mehr von meiner Liebe und meinem Respekt ihm gegenüber.
Mein Vater hat allerdings auch eine andere Seite. Diese Behüterseite schätze ich sehr. Und wer weiß, ob er sich nicht sogar in diesen für mich so erniedrigenden Situationen als Hüter empfand: als Hüter seiner Tochter Yvonne. Und egal wie hart er sonst auch war, sobald ich ein ganz praktisches Problem hatte, konnte ich mich darauf verlassen, dass er mir helfen würde. Ob handwerklich oder finanziell. Papa Melzer kann alles. Ein Alphamännchen mit zwei rechten Händen und viel Power. Im Laufe der Zeit hat sich diese Power jedoch immer öfter mit der harten, dominanten, brutalen, lauten, abwertenden Seite zusammengetan, was unserem Familienleben nicht gut bekam. Für mich hatte das besonders verheerende Folgen, denn je größer mein Geschlechtskonflikt wurde, desto mehr Gelegenheiten fand er, um mich zu demütigen.
Mein großes Glück war, dass meine Mutter nicht versuchte, mich in die verhasste Mädchenrolle zu pressen. Auch nicht als kleines Kind. Instinktiv erfasste sie alle Zeichen meiner Anti-Mädchen-Kampagne und ließ es schnell bleiben, meine Haare mit Glitzerspangen oder pinken Haarbändern zu malträtieren. Auch wählte sie für mich eher Kleidungsstücke aus, die als neutral durchgingen, also ohne Chichi und Gedöns. Ich trug meist Hosen und unifarbene T-Shirts. Großes Theater gab es allerdings im Vorfeld besonderer Familienfeiern. Strumpfhosen, Kleider, Rüschenblusen, Röcke. Schließlich macht man sich ja fein zu solchen Gelegenheiten. Und »fein« hieß Kleid. Diese Verkleidungen sorgten schon Stunden vor dem Ereignis für Bambule im Hause Melzer. Ich tobte und schrie, schmiss mich auf den Boden, trommelte mit meinen Fäustchen auf den Teppich oder setzte mich bockig vor meinen Kleiderschrank, damit ja keiner an die Sachen herankam. Für meine Eltern bestimmt nervig und anstrengend. Immerhin hielt ich mit meinem Theater den ganzen Laden auf.
Eine Zeit lang konnten sie mich noch in die Mädchen-Uniform pressen, aber je älter ich wurde, desto heftiger wurden die Auseinandersetzungen. In meinem Kleiderschrank hingen zwar zwei, drei Alibi-Kleider, ansonsten aber nur Hosen, Sportsachen, Hoodies. Während meine Freundinnen sich am liebsten in Prinzessinnengewänder hüllten, fühlte ich mich schon in einem schlichten Rock unwohl. Ich erinnere mich noch gut an die Konfirmation meines Cousins. Da war ich noch relativ klein – etwa vier, fünf Jahre alt. Ich sollte unbedingt ein Kleidchen und weiße Strumpfhosen anziehen. Beides habe ich mir sofort nach dem Gottesdienst vom Leib gerissen und bin dann in Unterhose herumgesprungen – das wiederum fand die versammelte Festgesellschaft süß.
Immer seltener ließ ich mir meine »Klamottenhoheit« nehmen. Das galt auch für meine gesamte Karnevalskarriere. Ich lebe ja nun mal in einer Narrenhochburg. Der Rosenmontagszug und Kinderfasching gehörten zum Pflichtprogramm. Wochenlang jagte eine Verkleidungssause die nächste. Und ich nutzte schon sehr früh die Gelegenheit, um erst in Jungen-, später in Männerrollen zu schlüpfen. Meine Freundinnen waren Meerjungfrauen, Feen, Bibi Blocksberg, Pippi Langstrumpf oder Dornröschen. Ich schämte mich nicht eine Sekunde, als Prinz, Cowboy, Pirat, Polizist, Superhero oder Doktor daherzukommen. Zu Halloween war ich auch nicht Hexe, sondern Zombie. Als Teenager gab ich den Psychopathen aus dem Horrorschocker Scream, und auf der Motto-Cliquen-Party war ich der Zuhälter und nicht die Nutte. An die Cowboy-Zeit erinnert mich übrigens eine Narbe über dem Auge. Die verpasste mir »Sheriff« Stefan beim Wildwest-Spiel mit der Eisenpistole.
Inzwischen bin ich so bei mir, dass ich für eine Hawaii-Mottoparty sogar einen Hula-Rock mit Kokosnuss-BH anziehen würde. Man sieht ja ganz klar, dass ich ein Mann bin, weshalb ich damit spielen kann, ohne mich blöd zu fühlen.
Als Kind tat ich intuitiv alles, um den Jungen, der in mir steckte, hervorzuholen.
Zöpfchenfotos von Yvonne sucht man vergebens im Familienalbum. Für mich gab’s nur kurze Haare, sonst nichts. Wurden die zu lang, griff ich notfalls selbst zur Schere und schnippelte sie ratzekurz. Dann sah ich aus, als hätten mich Ratten angeknabbert, aber das war mir allemal lieber als »Mädchenhaare«.
Gegen diese blöden Ohrlöcher konnte ich allerdings nichts mehr ausrichten. Die hatte man mir verpasst, als ich noch zu klein war, um mich dagegen zu wehren. Das gehörte sich eben so: Kleines Mädchen trägt Ohrringe. Punkt. Ansonsten ist es, wie gesagt, meiner Mutter zu verdanken, dass meine Kindheit kein ewiger Spießrutenlauf war. Es gab sogar lange Phasen, in denen ich mich bestens durchmogeln konnte, ohne ständig von außen auf meinen inneren Kampf gestoßen zu werden. Ich fühlte mich als Max, habe mich so verhalten und gekleidet, und das Umfeld hat es mitgetragen. Man sprach einfach nicht drüber. Ich war das Mädchen, das eben lieber Hosen und kurze Haare trug.
»Seit mein zweites Kind denken konnte«, sagt meine Mutter, »hatte ich einen kleinen Jungen, der Yvonne hieß.«
Wir wohnten damals in Marl, also mitten im Ruhrgebiet, wenngleich sehr abgelegen am Waldrand. Für mich und meinen neun Jahre älteren Bruder ein echtes Kinderparadies mit Teich, großem Garten, einem Gästehäuschen und Holzhütte auf dem Grundstück. Bis ich mich allein mit Fahrrad oder Bus von A nach B bewegen konnte, zwang diese Abgeschiedenheit meine Mutter zu vielen Fahrdiensten, die sie aber, ohne jemals zu murren, übernahm.
So gesehen verbrachte ich meine Kindheit in einer Bilderbuchidylle. Geliebt, gefördert und behütet. Doch obwohl ich von Natur aus ein fröhlicher Mensch bin, lustig und voller Tatendrang, ausgestattet mit Dickkopf und frecher Schnauze, sehe ich auf etlichen Kinderfotos traurig, bockig oder sogar verheult aus. Mein innerer Geschlechterkampf hinterließ seine Spuren. So fürchtete ich zum Beispiel nichts so sehr, wie in neue Gruppen zu kommen. Nicht dass ich nicht schnell Freunde gefunden hätte – ganz im Gegenteil: Mit mir wollten alle zusammen sein –, aber der Moment, in dem ich als Yvonne vorgestellt wurde, war jedes Mal furchtbar. Ich fühlte mich doch wie Max und nicht wie Yvonne! Insofern war es auch nicht verwunderlich, dass die anderen Kinder erst mal erstaunt dreinschauten.
»Hä? Dieser Junge ist ein Mädchen?«
Es mögen nur Nuancen gewesen sein, aber ich nahm jede hochgezogene Braue, jedes Räuspern und Kichern wahr. Mein Michandersfühlen war so fest verankert, dass mich die nicht passende Resonanz der anderen Kinder zutiefst verunsicherte. Was die hörten (»Ich heiße Yvonne«), war nun mal nicht kompatibel mit dem, was sie sahen. Wie ein falscher Ton, der lange nachschwingt. Ein ungehaltenes Versprechen. Vielleicht hatten die Mädchen ja auf eine neue Spielfreundin in der Puppenecke gehofft. Oder eine Einsame auf eine neue Gefährtin. Die Jungs wiederum hatten mich gar nicht auf dem Zettel. In ihrer Ecke mit Autos, Superhelden und Raufereien hatte ich als eine Yvonne eigentlich nichts zu suchen.
In den Kategorien, die nach Rosa und Blau, Helden und Feen unterscheiden, war ich immer irgendwie falsch. Denn ich sah aus wie ein Junge und benahm mich auch so, trug aber einen Mädchennamen.
Heute mag man sich fragen, weshalb das Thema Transgender weder in meiner Familie noch in der Schule jemals aufkam. Dass meine Eltern keine Beratungsstelle aufsuchten, fällt aus heutiger Sicht tatsächlich schwer zu glauben. Sicherlich waren da Fragezeichen, doch waren die in den ersten Jahren nie so groß, dass sie unser Familienleben grundlegend störten. Mal abgesehen davon, dass das Thema Transgender erst seit einigen Jahren als gesellschaftlich relevant gilt und entsprechend diskutiert wird. In den Achtzigern und Neunzigern des vergangenen Jahrhunderts – ohne Internet, Handy und Social Media – konnte beziehungsweise musste sich meine Familie durchmauscheln. Zumal es kaum Aufklärung und Beratung gab. Außerdem war ich kein verschlossenes oder gar depressives Kind – und optisch wohl am ehesten ein »Es«. Hübsch, aber eben weder Junge noch Mädchen. »An Yvonne ist ein Junge verloren gegangen«, hieß es immer. Mit dieser Schublade konnten alle Beteiligten ziemlich gut leben. Nach außen hin sogar ich. Schließlich war ich damit aus der Schusslinie. Und für die anderen Kinder gab es eh nur die eine entscheidende Frage: »Ist die doof? Oder kann man gut mit ihr spielen, bolzen, buffern?« Hey, ich bin ein Ruhrpottkind, noch dazu ein sportliches. Ich galt als Teamplayerin und war schon im Kindergarten die Vorreiterin, das Alphamädchen, Chefin-Boss und Mädchenschwarm. Jawohl.
Ich war der Junge, der Yvonne hieß.
Auf diese Weise gelang es mir zumindest sehr lange – wenn auch mal mehr, mal weniger gut –, die innere Zerrissenheit, die mich permanent begleitete, auszublenden.