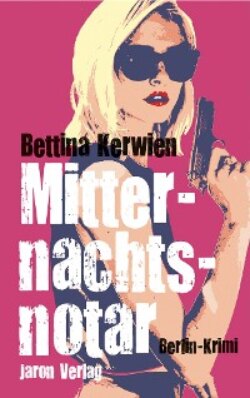Читать книгу Mitternachtsnotar - Bettina Kerwien - Страница 11
Erweiterter Suizid
ОглавлениеSanders bildet sich ein, dass Fräulein Könitzer ihm ein wenig fester den Oberarm drückt, als es das beim In-den-Mantel-Helfen bräuchte. Der Mantel ist klamm.
»Wie alt ist er? Berend?«, fragt er.
»Der neue junge Herr Sanders wird im Herbst zwölf Jahre alt«, antwortet Fräulein Könitzer.
Sanders nickt und verabschiedet sich ohne weitere Sentimentalitäten.
Draußen regnet es noch immer. Er steigt in seinen Wagen. Die Tür schließt sich mit einem satten Geräusch, die Welt bleibt draußen. Er startet den Motor, fährt ein paar Hundert Meter, fährt wieder rechts ran. Kein Kaffee. Positive Väterlichkeit kann Sanders seinem Vater nun wirklich nicht nachsagen. Wenn der Mann eine Weltöffnungsfunktion in seinem Leben gespielt hat, dann beschränkt sie sich auf Sachlichkeit, Maßanzüge und die Abwesenheit von allem anderen.
Sanders hört dem Frühlingsregen auf dem Wagendach zu. Das Wasser läuft in hypnotischen Kaskaden über die Scheiben ab. Sein Kopf wird warm und schwer. Er lässt ihn gegen die Nackenstütze fallen. Er hat die ganze Nacht kein Auge zugemacht, aber er wird einen Teufel tun, tagsüber zu schlafen, auch wenn der Regen ihm noch so ein süßes Schlaflied singt. Denn wenn er während des Tages schläft, träumt er seinen Traum. Sanders hat nicht vor vielen Sachen Angst. Vor seinem Traum schon.
In seinem Traum sitzt er in einem riesigen leeren Kinosaal. Es gibt nur einen einzigen Sessel, und das ist der Sessel, auf dem er sitzt. Der Sessel steht weit vorne, direkt vor der Leinwand. Er möchte aufstehen und wegrennen, aber er kann nicht. Man hat ihn festgeschnallt, den Hals an die Rückenlehne, die Hände an die Armlehnen, die Füße an die Sesselbeine. Sein Kopf ist mit einem Stahlgestell fixiert, wie bei einem Versuchstier.
Sie wohnen damals noch in einem anderen Haus, nur ein paar Straßen von hier. Es ist ein Spätnachmittag im April 1984, früh im Jahr und doch zu spät. Endlich ist er gekommen, der Abend seiner Mutter. Sanders stellt sich das so vor, dass Veronika Sanders keinen Plan hat, es ist nur ein Versuch, ein Selbstversuch. Seine Mutter weiß, wo die Autoschlüssel sind, gefahren ist sie seit ein paar Jahren nicht mehr, sie darf ja, sie kann fahren, sie hätte üben können, aber dann ist er plötzlich da: der Abend des vielzuvielsten Tages.
Veronika Sanders erscheint ihrem Sohn in der dunkelgrauen Schleiflacktäfelung der Bibliothek wie die Weiße Frau. Es riecht nach Pronto und Pelargonien, zu ihren Flamingolippen trägt die Mutter einen beigen Yves-Saint-Laurent-Anzug und goldene Schuhe. Ihre Wimpern flattern wie schwarze Schmetterlinge, ihre vanilleblonden Locken fallen über die Nadelstreifen wie Softeis, so wie es sein soll, eine Mischung aus Paris Match und Die Moderne Hausfrau. Aber der dunkle Schleiflackspiegel zeigt die wahre Veronika, eine verlorene, schreckliche Königin mit schwarzen Adern unter der Pergamenthaut. Sie hat zu viel gelesen, sie stellt das Buch zurück, es ist das Buch des Vaters: Obscurum per Obscurius, ein Zauberbuch, das Veronika unsichtbar macht. Die Mutter wischt mit dem Jackenärmel die Fingerabdrücke vom Regal, zum letzten Mal. Ordnung ist dem Vater wichtig, auch hier in der Bibliothek, einem kalten Nierentischraum, der auf den Garten hinausgeht. Dort blühen rechter Hand die Fliederbüsche des Vaters und linker Hand die Forsythien des Vaters, dahinter färbt das Abendrot den Horizont, der niemandem gehört – niemandem oder allen, auch Martin Sanders’ Mutter. Er glaubt, dass sie den Horizont wiederhaben wollte an diesem Tag, sie wird ihn sich nehmen, ihre Haut soll wieder dick sein, sie soll wieder sichtbar werden.
Veronika Sanders hat Martins Zwillingsbruder Philip, seiner Schwester Rebecca und ihm vor dem Abendbrot Tabletten gegeben. Vitamine sollen das gewesen sein. Der neunjährige Junge weiß nicht genau, was Vitamine sind, aber er kann noch immer die Stille fühlen, mit der sein Bruder neben ihm schläft.
Martin selbst ist so übel, dass er sich erbrechen muss. Er holt sich ein Glas Wasser. Die Wasseroberfläche zittert, als er auf der Suche nach seiner Mutter die Flügeltüren der Bibliothek öffnet.
Alles hier gehört dem Vater, der Flieder im Garten, die Vanillelocken der Mutter, sogar ihre Stimme, mit der sie so beruhigend gurrt: »Sei ganz ruhig, Liebling. Es wird alles gut werden. Ich trage dich ins Auto, und dann fahren wir zum Arzt.«
»Ich hab Angst, Mama.« Martins Stimme schwindet, er weiß instinktiv, dass etwas falsch ist. »Ich will nicht zum Arzt, morgen ist …«
Die Frage, was morgen sein wird, verfliegt, als seine Mutter den Autoschlüssel vom Dielenschrank nimmt. »Alles wird gut.«
Martin wird hochgehoben, seine Mutter stößt die Tür zur Garage mit dem Knie auf, schnallt ihn auf dem Vordersitz des Wagens an. »Du brauchst keine Angst zu haben«, flüstert sie. »Nie wieder.« Martin ist sich sicher, das ist die Wahrheit. Seine Mutter holt Philip und Rebecca, und dann: nie wieder Angst. Philip schläft so tief, dass er auch nicht aufwacht, als die Mutter ihn neben Rebecca auf dem Rücksitz anschnallt.
»Wir fahren zum Arzt«, flüstert Veronika Martin zu. Warum nehmen sie kein Taxi?, wundert sich sein benommenes Selbst. Er ist ein schmales Kind, kaum groß genug für den Anschnallgurt. Seine Mutter setzt sich unbeholfen hinter das Steuer, sie stößt den Schlüssel ins Schloss. Der Wagen springt an. Sie muss vom Schaltknüppel ablesen, wo der Rückwärtsgang ist. Ihre goldenen Pumps verhaken sich in den Pedalen. Der Wagen jault und springt rückwärts. In der Frontscheibe sieht Martin Wunderkerzenfunken, die Helligkeit hüllt den Wagen ein wie das Licht, das Sterbende sehen. Die Garage wird zum Lichttunnel, seine Mutter fährt den Wagen durch eine Waschstraße voller Licht gegen das geschlossene Garagentor. An den Scheiben läuft Feuer ab, der Wagen wird mit Feuer gewaschen, die Flammen brüllen mit Kinderstimmen, wollen Martin mit Raubtierzungen die Kindheit von der Haut lecken.
Er weiß plötzlich, niemand wird ihm helfen außer er sich selbst. Seine Autotür kann er öffnen, die hinteren Türen blockiert ein umgestürztes Regal. Er schreit seine Schwester Rebecca an, sie soll ihm helfen. Aber sie kann kaum die Augen offenhalten, sein Entsetzen ist ihr egal. Philip hängt reglos im Anschnallgurt, Martins Ebenbild, bezaubernd friedvoll in seiner Todgeweihtheit. Martin versteht nur, dass es vorbei ist. Er muss die restliche Kraft in seinem kleinen tauben Körper in die Mutter investieren. Sie schreit, aber sie wehrt sich nur wenig. Er zerrt sie aus dem Wagen, hinter sich her zurück ins Haus.
Diese Müdigkeit. Er schafft es nicht, gleichzeitig die Mutter festzuhalten und die Feuerwehr zu rufen. Die Nachbarn tun das irgendwann, viel zu spät natürlich, die Garage brennt schon lichterloh.
Immer zu spät. Sanders fährt hoch, seine Brust ist schweißnass, seine Hände haben sich um das Lenkrad seines Wagens gekrallt, die Knöchel sind weiß.
Jahrelang war Sanders nichts als ein halber Held. Er hat den falschen Menschen gerettet, die Täterin nämlich, die die Familie des Vaters zerstört hat. Jetzt ist er der letzte Sohn. Der Vater will sich an ihm trösten. Er muss ihm zu Willen sein, soll Rechtsanwalt werden und durch all die geöffneten Türen direkt ins gesellschaftliche Himmelreich marschieren. Aber Sanders hat das Tröstliche in der Selbstverleugnung nie gesehen. Die Schuldfrage hingegen hat ihn nie mehr losgelassen.
Seine fliegenden Hände starten den Wagen. Er macht sich zu viele Gedanken. Um die Vergangenheit. Vor allem aber um eine Zukunft, die er womöglich gar nicht hat.