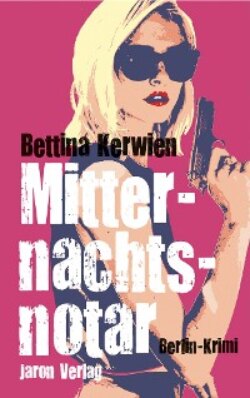Читать книгу Mitternachtsnotar - Bettina Kerwien - Страница 9
Der Herr Vater
ОглавлениеDie abziehenden Ostgewitter lassen die Parks der Dahlemer Gründerzeitvillen an diesem Maimorgen so grün und gesättigt zurück wie Hochmoorwiesen. In den Rinnsteinen und Vorgärten glänzen die Pfützen, und noch immer ist der Regen nicht vorbei. Die Stadt ertrinkt, von den Scheibenwischern seines Wagens in zwei Wahrnehmungsbereiche geteilt: unscharf/scharf, scharf/unscharf und so weiter.
Das Auto hat Sanders gestern per Hand waschen lassen. Nur im Winter ist das in Berlin noch sinnloser als im Frühjahr, aber es gehört zu seinen persönlichen Ritualen. Einmal im Monat Haare schneiden und Auto waschen lassen. Das Auto ist oft genug sein Arbeitsplatz. Er konzentriert sich auf seinen nichtssagenden silbernen Mittelklassekombi, legt den Rückwärtsgang ein, lässt die Kupplung kommen – zu steil, um männlich-markant in die Parklücke zu stoßen. Ist es, weil ihm der verrutschte Anschnallgurt die Halsschlagader abdrückt, oder ist es das Hin und Her der Wischerblätter?
Herr Gott noch mal, er ist doch ein exzellenter Autofahrer. Sanders wischt sich die Hände an der Anzughose ab. Er spürt, dass ein bestimmtes Paar Augen in einem bestimmten Büro im Erdgeschoss seine beschämenden Parkversuche durch die Stechpalmenhecke beobachtet. Er fühlt, wie diese Augen überfrieren. Wie mit dem Kopf gezuckt wird. Eine Bewegung, die einem Schneidemesser gleicht.
Sanders schnallt sich ab. Berührt kurz sein Knöchelholster. Die SIG Sauer ist an ihrem Platz. Noch mal den Rückwärtsgang rein. Diesmal gelingt es besser, nicht perfekt, der Abstand zum Rinnstein ist zu groß, aber es muss genügen. Er holt seinen Mantel vom Rücksitz. Der Trenchcoat umarmt ihn wie eine liebende Mutter. Er schlägt den Kragen hoch, überquert den Bürgersteig und drückt die gebürstete Edelstahlklingel. Sie schnarrt genauso banal wie immer. Im Garten flüstert der Regen in den Rhododendren. Sanders betritt die Eingangshalle, ein schmaler dunkler Schatten in den blinden Wandspiegeln. Seine Ledersohlen treffen einem Metronom gleich auf den Marmor.
Die Gründerzeitvilla seines Vaters riecht klar, glatt und alt wie ein polares Eisschild. Eine Tür öffnet sich neben dem Kamin am Ende der Halle. Ruth Könitzer, die Haushälterin, trägt seit Jahrzehnten dasselbe dunkle Kostüm zur strengen Hochsteckfrisur. Ihr Haar glänzt silbern wie das einer Königinmutter. Sanders kennt Fräulein Könitzer schon seit dreißig Jahren. Trotzdem lächelt sie nicht. »Guten Morgen, junger Herr«, sagt sie stattdessen und neigt den Kopf.
»Wie geht es Ihnen, Fräulein Könitzer?« Kalter Regen läuft ihm aus den Haaren über die Stirn.
»Danke. Bitte geben Sie mir Ihren Mantel, bevor Sie noch den Fußboden ruinieren.«
Sanders reicht ihn ihr. Während Fräulein Könitzer seinen Mantel in die Garderobe bringt, richtet er seine Krawatte und schließt das Jackett, als wäre es eine kugelsichere Weste. Sein Blick wandert am vergoldeten Geländer der Freitreppe entlang hinauf in den ersten Stock. Dort schimmern in der Beletage die grünen Samttapeten. Sanders war seit fast zwanzig Jahren nicht mehr im ersten Stock. Er fragt sich kurz, ob es sein altes Zimmer noch gibt. Mit sechzehn ist er ausgezogen, um Polizist zu werden. Mit achtzehn hat er die Pflegschaft für seine Mutter übernommen. Er weiß nicht viel über die letzten Jahre im Leben seines Vaters. Der Mann hat immer noch dieselbe Haushälterin, aber es gibt eine neue Frau und ein neues Kind, einen Dobermann und ein Chalet in der Schweiz.
»Der Herr erwartet Sie in seinem Büro.« Fräulein Könitzer geht vor. In ihrem Windschatten riecht es nach Keller. Die Haushälterin führt ihn vorbei an dem um diese Zeit noch nicht besetzten Empfangstresen der Anwaltskanzlei, an Aktenrücken in Regalwänden, durch Intarsientüren, über Parkettböden. Nur das Blinken eines WLAN-Routers zeigt Sanders an, dass er nicht durch ein Loch im Raum-Zeit-Kontinuum gefallen ist.
Die Flügeltür zum Büro seines Vaters ist nur angelehnt. Fräulein Könitzer klopft, dann schiebt sie Martin Sanders hinein und löst sich in Luft auf.
Sein Vater sitzt mit dem Rücken zur Tür hinter einem enormen Schreibtisch. Im Hintergrund läuft leise Gitarrenmusik. Johnny Cash, unplugged. Selbst wenn er Musik hört, hat Rainhard Sanders noch die Haltung eines Herrn.
»Vater?«, fragt Martin Sanders dennoch.
Der Schreibtisch von Sanders senior ist leer. Bis auf eine Zeitung mit dem Foto einer umwerfenden Blondine: Liberty Vale. Sie ist nackt, und offensichtlich genießt sie es. So wie auch Sanders die Zusammenarbeit mit ihr genossen hat.
»I never thought I needed help before«, singt Johnny Cash mit brüchiger Stimme. Der Vater rührt sich nicht. Martin Sanders starrt ihm auf den schmalen dunklen Hinterkopf. Wenig graue Haare für sein Alter, denkt er, während Cash sich durch den Song quält. »Help me.« Es ist eine seiner letzten Aufnahmen. Martin Sanders spürt die Erschöpfung, die Trauer. So kaputt, der alte Mann, in seiner konzentrierten Todesnähe.
»Unerträglich, nicht wahr?« Rainhard Sanders hebt die Hand mit der Fernbedienung. Johnny Cash schweigt. Der Vater dreht sich um, steht auf. Groß, hager, militärisch. »Guten Morgen, mein Sohn.«
Martin Sanders absolviert den Händedruck knapp, beiläufig.
»Setz dich.«
Er öffnet den Jackenknopf, nimmt auf dem äußersten Rand des Besucherstuhls Platz. Mit einem Mal fühlt er sich nackt, der Stuhl ist aus Eis.
»Müde siehst du aus.« Rainhard Sanders scannt ihn von Kopf bis Fuß. »Und unrasiert. Ist das – wie sagt man? – hip in deinen Kreisen?«
Martin Sanders fährt sich übers Kinn. Der Dreitagebart, den er seit seinem letzten Fall trägt, erspart es ihm, sich länger als unbedingt nötig mit sich selbst zu beschäftigen. »Du wolltest mir etwas Dringendes erzählen«, sagt er.
Der Vater hebt die Brauen. »Ich verabscheue Moden«, sagt er. »Diese Bärte sind Virenfallen. Widerlich. Und das Risiko, einen Ausschlag zu bekommen …«
»… gehe ich ein«, unterbricht ihn der Sohn. »Ich bin halt eine Spielernatur.«
»Zu meinem Bedauern.« Rainhard Sanders schiebt das Foto von Liberty in seine Richtung. »Ist die Krise jetzt im Detektivgeschäft angekommen? Ich höre, du verkehrst in der Halbwelt?«
»Sagt wer?«
»Mein Kontakt im LKA.«
Sein Vater hat eine umwerfende Art, sich für sein Leben zu interessieren. Martin Sanders’ Zeigefinger zieht Libbys Hüften auf dem Foto nach. Er überlegt, ob er dieses Gespräch nicht einfach beenden soll. Sein Kopf schmerzt. Der Regen oder die Ohnmacht. »Diese Frau ist der Wahnsinn. Findest du nicht?«, fragt er und lächelt der Erinnerung an Libbys Stolz, an ihre Wärme hinterher.
Der Zeigefinger des Vaters fällt auf die Zeitung wie ein Scharfrichterbeil. »Eine Spielzeugpuppe«, zischt er. »Pubertär. Wie kannst du nur?«
»Ich hatte sie für einen Fall als Lockvogel engagiert«, sagt Sanders. »Mit sexy Skandalfotos Politiker gefügig machen – ich dachte, das ist der Job. Aber mein Auftraggeber wollte mehr: die Konkurrenz ausschalten und uns den Mord in die Schuhe schieben. Ohne Liberty wäre ich jetzt tot. Trotzdem. Wir sind nur Freunde, weiter nichts.« Er wünscht sie sich hierher. Ein fremdartiger, warmer Gedanke.
»Mach dir nichts vor, Martin. Das sind billige Reize. Ein Mann von Format ist für so etwas nicht empfänglich.«
»Für mich«, erwidert er, »ist sie eine sehr schöne Frau.«
Sein Vater schüttelt den Kopf. »Schönheit vergeht, Sohn.«
»Ich spreche nicht von Äußerlichkeiten, Vater.« Er atmet flach. Keine Bitterkeit. Dieser Mensch hier wird ihn nicht vergiften.
Rainhard Sanders legt die Fingerspitzen aneinander. »Eine Frau, die sich verkauft. Ich frage mich, wieso du ihr vertraust.«
»Ich kann dich wirklich vollkommen beruhigen, Vater.« Martin Sanders lehnt sich zurück. »Diese Frau interessiert sich kein Stück für mich als Mann. Möchtest du ihre Telefonnummer? Wolltest du mich deshalb sprechen?«
Die Nasenflügel seines Vaters weiten sich. Er schiebt den Schreibtischstuhl zurück, steckt die Hände in die Taschen seiner Anzughose und mustert ihn schweigend. Nicht mal einen Kaffee hat er mir angeboten, fällt Martin Sanders auf.
»Martin. Junge. Wir sollten uns wirklich besser kennenlernen.«
»Sentimentalität steht dir nicht, Vater.«
»Ich will ehrlich zu dir sein. Du findest meinen Beruf anrüchig, ich finde deinen – obskur. Vorsichtig ausgedrückt. Das heißt nicht, dass wir unsere jeweiligen Jobs schlechtmachen, nicht wahr?«
Sein Vater hält ihn für dumm. Der Sohn aus gutem Hause, der auf seine exzellenten Aussichten pfeift. Aber Martin Sanders hat einen Instinkt für die Emotionen anderer Leute. Er ist schon so oft in seinem Leben um Hilfe gebeten worden, dass er eine Bitte sogar erkennt, wenn sie so verquast daherkommt wie die seines Vaters. »Was kann ich für dich tun?«, fragt er.
Die Augen seines Vaters verengen sich, als würde er auf ihn anlegen. Kimme und Korn. »Ich hätte es mir nicht träumen lassen, dass ich für deine Profession jemals eines sinnstiftenden Anwendungsfalls gewärtig werden würde«, sinniert er. »Und doch ist es so.«
»Mach dich nicht lächerlich.«
Sein Vater wischt den Hohn weg. Lehnt sich vor. »Ich habe da ein Immobilieninvestment in Reinickendorf. Die Am Rabennest Sanierungsgesellschaft. Läuft etwas unglücklich. In den Zeitungen steht, die geplanten Luxusumbauten treiben 85-jährige Bestandsmieterinnen dazu, am Gashahn zu manipulieren.«
»Skrupel?«
»Sagen wir, es wird mir zu persönlich.« Rainhard Sanders holt einen gepolsterten Umschlag aus dem Schreibtisch. »Das hier nennt man wohl gemeinhin einen Drohbrief.«
Martin Sanders nimmt den Umschlag entgegen. Darin ist ein weißes DIN-A4-Blatt, bedruckt mit dicker schwarzer Computerschrift. Sanierungsstopp, steht da. Nur ein einziges Wort. Aber es ist noch etwas anderes in dem Umschlag: eine Kinderbrille. Ein Bügel verbogen, ein Glas fehlt, das andere ist gesprungen. Der Schriftzug auf dem kaputten Bügel lautet: Star Wars Eyewear. »Die Brille deines Sohnes«, schlussfolgert Martin Sanders.
Sein Vater nickt. »Ich weiß nicht, wie sie da drangekommen sind. Berend spricht nicht darüber.«
»Kam der Brief mit der Post?«
»Nein, der Umschlag lag einfach im Briefkasten. Und es ist nicht das erste Mal, dass uns so etwas zugestellt wurde. Vor ein paar Wochen kam das hier.«
Er greift unter den Tisch und fördert einen Gummistampfer zutage. Eine von diesen Saugglocken, mit denen Klempner Abflussverstopfungen beseitigen. Martin Sanders weiß nicht genau, wie die Dinger heißen. »Ein Pömpel?«, fragt er.
Rainhard Sanders stellt den Pömpel auf den Schreibtisch. »Lag vor der Haustür. Das ist ein Symbol. Die Rabennest-Bestandsmieter sind allesamt prekäre, randständige Existenzen. Da ist ein Querulant dabei, Jürgen Schrödter, so eine Art Rädelsführer. Ein Rentner, der sich die Zeit damit vertreibt, den Widerstand gegen die Sanierungsgesellschaft zu organisieren. Gewerkschaft, SPD und Linksautonome unterstützen ihn im Bezirk. Im Internet gibt es einen sogenannten Protestblog. Für jeden Tag der Woche melden die eine Demo an, seit dreihundert Tagen. Sitzen im Vorgarten, essen Kuchen und tragen Plakate durch die Siedlung. Der Presse konnte ich entnehmen, dass einer dabei so eine Saugglocke geschwungen hat. Ein Polizist in voller Kampfmontur hat ihn mit erhobenen Händen an die Wand gestellt, gefilzt und ihm das Ding abgenommen. Davon kursiert ein Video im Internet.«
»Lauter Alte, die Krawall machen?« Martin Sanders muss schmunzeln. »Warum setzt du nicht einen deiner angestellten Rechtsanwälte darauf an? Der Brief mit der Brille reicht für eine Strafanzeige.«
»Ich will kein Aufsehen. Mit dem Leitenden Oberstaatsanwalt habe ich schon gesprochen. Ich kenne ihn vom Fortune Club. Aber ohne Strafanzeige sind ihm die Hände gebunden. Und das ganze Spektakel will ich nicht. Ich will Diskretion. Dazu habe ich dich erzogen.«
Richtig. Der Vater hat ihn zum Schweigen erzogen. Dafür schuldet er ihm nichts. »Siebzig Euro die Stunde, netto, plus Spesen«, sagt Martin Sanders, der sonst nie mehr als fünfzig Euro verlangt.
»Respekt, Martin. Du hast Geschäftssinn«, lobt ihn der Mann, der ihn sonst nie gelobt hat.
Martin Sanders zieht ein Diktiergerät aus der Jackentasche, schaltet es ein, legt es über Libbys nackten Körper wie einen schwarzen Balken. »Erzähl mir alles, von Anfang an«, fordert er seinen Vater auf. »Gibt es hier auf dem Grundstück eine Überwachungskamera?«
»Nein, so etwas hatten wir noch nie nötig.«
»Ich rate dir dazu. Woher hast du den Kontakt für das Investment?«
Rainhard Sanders’ Augen glitzern wie der Friedrichstadtpalast im Winter. »Du stellst die richtigen Fragen. Vielleicht lernen wir uns ja durch diese Zusammenarbeit auch persönlich wieder mehr schätzen.«
»Nur die Fakten bitte – Vater.«