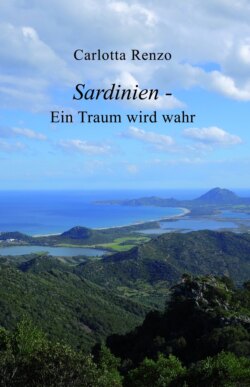Читать книгу Sardinien - Ein Traum wird wahr - Carlotta Renzo - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеNovember 2002
Wir waren aufgeregt wie Kinder, die sich auf Weihnachten freuen und konnten es kaum erwarten, dass auf der Fähre nach der Ankunft in Olbia endlich die Ausfahrt geöffnet wurde. Die Strecke nach Tortoli bewältigten wir wesentlich schneller als sonst, da wir ja keinen Wohnwagen ziehen mussten und außerdem bei einer unserer vorangegangenen Reisen eine andere Route ausfindig gemacht hatten: Es gibt eine Schnellstraße, die von Nuoro fast bis Tortoli führt, die allerdings noch nirgends beschildert war. Die übrigen Kilometer auf der SS 125 nach Süden, zum Teil an der Küste entlang, zogen sich dann unglaublich in die Länge; aber das kam uns sicher in unserer Ungeduld nur so vor…
Der Beschreibung nach, die uns mitgegeben worden war, musste es gleich so weit sein: Zuerst durch Villaputzu fahren, über die lange Brücke (eigentlich sind es zwei Brücken, die über den Flumendosa führen) in Richtung Muravera und dann noch einige Kilometer weiter in Richtung Castiadas. In einer langgestreckten Kurve, in der man rechts in eine kleine, kaum sichtbare Einfahrt zwischen Büschen und stacheligen Kakteen einbiegen muss, sollte uns dann auf einem unbefestigten, kurvigen Weg durch Olivenhaine und Weingärten immer weiter nach oben in die Hügel führen.
Auf dieser ‚weißen’ Straße zogen wir eine mächtige Staubwolke hinter uns her, obwohl wir langsam fuhren; der Geländewagen war optimal für diesen steinigen und von Schlaglöchern übersäten Weg, auf dem ein Ausweichen nur an einigen Stellen möglich war, falls uns tatsächlich ein Auto entgegen kommen sollte. Der Weg ging dann zwar noch ein ganzes Stück weiter nach oben, aber wir konnten jetzt schon das Nachbarhaus und gleich daneben ‚unser‘ Haus sehen.
Als wir ausgestiegen waren, überwältigte uns nicht nur die Aussicht in Richtung Meer. Auch das Grundstück erschien uns riesig; es war noch nicht eingezäunt und der größte Teil davon bestand aus völligem Brachland mit einem ausgeprägten Wildwuchs an stachligen Sträuchern, niedrigen Büschen und einigen wilden Olivenbäumen sowie unzähligen großen und kleinen Steinen und sogar Felsbrocken. Das meiste Gestein hatte eine rostbraune Oberfläche, die teilweise in Dunkelbraun und Schwarz übergeht, was meinem Mann gleich zu Spekulationen Anlass gab. Mineralien sind schließlich eines seiner Interessengebiete.
Das Haus war wirklich noch ein Rohbau, der nur an 2 Seiten verputzt worden war. Wir öffneten eines der unverschlossenen Fenster, die auf der Terrassenseite bis zum Boden reichen, und stellten fest, dass auch innen noch größtenteils der Putz fehlte und der Boden nur aus einer nackten und staubigen Betonplatte bestand. Es gab noch keine Treppe ins Obergeschoss, lediglich eine Bauleiter aus Eisen lehnte zur Benutzung für die Handwerker an der Wand. In den Bädern herrschte gähnende Leere – es gab keine Anschlüsse, keine Sanitärobjekte – nur die dafür vorgesehenen Aussparungen in den Wänden.
Bei genauer Betrachtung des Grundstücks war uns durchaus klar, wie viel Arbeit damit verbunden sein würde, es zu bepflanzen und zu bebauen, dabei die unzähligen Steine zu entfernen, eine Bewässerung anzulegen, und, und, und … Aber in diesem Augenblick ging uns nur ein einziger Gedanke durch den Kopf – wir sahen ‚unseren’ Traum, der vielleicht wahr werden könnte! Sicher war es bis dahin noch ein weiter und vielleicht beschwerlicher Weg. Trotzdem - es grenzte fast an ein Wunder, dass unser Wunsch und unsere Vorstellungen so konkrete Züge annahmen und vielleicht tatsächlich realisiert werden konnten!
Mit diesem Buch wollte ich nicht nur viele meiner Erfahrungen festhalten sondern auch all denen, die einen ähnlichen Traum haben, aber nicht sicher sind, ob sie ihn verwirklichen wollen oder können, Mut machen. Allein der Wille dazu ist ausschlaggebend, alles Weitere ergibt sich fast von selbst. Man mobilisiert Kräfte und Fähigkeiten, die man gar nicht bei sich vermutet hätte! Dazu fällt mir immer wieder der Spruch von Goethe ein, den ich mir seinerzeit an die Küchenwand geklebt habe: ‚Alles was Du erträumst zu tun oder glaubst zu können – beginne es’! Oder einen anderen Spruch, der mir um diese Zeit ebenfalls in die Finger kam: ‚Träume nicht Dein Leben, lebe Deinen Traum.’
Wir machten mit Feuereifer zahlreiche Fotos von Grundstück und Haus aus allen möglichen Blickwickeln, selbstverständlich auch von innen; wir nahmen Maß in allen Räumen, um einen eigenen Plan anzufertigen und auch, um etwas Konkretes von unserem Traum mit nach Hause zu nehmen – nach Hause in den grauen, nassen November, dem wir nun am liebsten sofort und für immer entflohen wären.
Danach fuhren wir wieder in den Ort zurück, um bei einem ausgiebigen, sardischen Mittagsmahl über unseren Traum nachzudenken, das Für und Wider zu diskutieren und vor allem auch zu versuchen, einige negative Punkte zu finden – aber es gelang uns einfach nicht. Alles sah so positiv aus und gefiel uns so außerordentlich gut – es war einfach kein Raum für negative Aspekte. Obwohl es die durchaus gab: Es handelte sich um ein ausschließlich landwirtschaftlich zu nutzendes Grundstück und die Mindestgröße von einem Hektar gemäß der zu dieser Zeit gültigen gesetzlichen Vorschriften erlaubten überhaupt eine Bebauung. Das Haus musste also vorwiegend der Bewirtschaftung des landwirtschaftlichen Geländes dienen und nur ‚nebenbei‘ zu Wohnzwecken, und es durfte eine bestimmte Größe nicht übersteigen – in Relation zu 1 ha waren dies 100 qm überbaute Fläche.
Zudem waren manche der geplanten Räume in der Baugenehmigung für eine andere Nutzung ausgewiesen, z. B. ein Raum, der eigentlich das Gästeschlafzimmer werden sollte, war als Geräteraum und die große Küche als Lagerraum eingezeichnet, das große Zimmer im Obergeschoss mit separatem Bad war ebenfalls nicht für Wohnzwecke gedacht…
Das vorgesehene Schwimmbad war im Bauplan als ‚Wasser-Rückhaltebecken‘ eingezeichnet (ein großartiges Wort in diesem Zusammenhang…), das in trockenen Zeiten als Reservoir für die Bewässerung der landwirtschaftlichen Fläche dienen sollte. Viele dieser Ungereimtheiten seien nach einschlägiger Aussage des Verkäufers im Laufe kurzer Zeit lösbar, d. h. veränderbar. Es bedürfe dazu nur einiger Anträge – diese Dinge würden in Italien schon immer so gehandhabt. Wir waren fest entschlossen, alle diese Hürden zu überwinden, und ein unglaublicher Optimismus hatte sich bereits breit gemacht. Vielleicht wollten wir aber in diesem Augenblick auch alles unbedingt durch die berühmte rosarote Brille sehen…
Das Essen in dem kleinen Restaurant an der Hauptstraße war ausgezeichnet (eine Frau aus dem Ort hatte es uns als einfach aber gut empfohlen). Zuerst gab es verschiedene Vorspeisen aus dem Meer und danach pasta mit arselle und bottarga (eine Venusmuschelart auf Sardinien sowie Fischrogen von der Meeräsche, der geräuchert/ getrocknet und dann gemahlen auf die Nudeln gestreut wird – eine Spezialität, die wir bisher nur auf Sardinien gefunden hatten).
Wir tranken dazu einen einfachen weißen Landwein aus der Karaffe, der uns gut schmeckte. Nach einem espresso fragten wir die Bedienung, ob sie uns eine private Unterkunft für die beiden Nächte, die wir im Ort verbringen wollten, empfehlen könne; also möglichst eine kleine Pension, ein B & B. Sie war sehr hilfsbereit und schrieb uns gleich eine Adresse mit Telefonnummer auf. Wir sollten aber unbedingt vorher anrufen, um uns zu vergewissern, ob die Familie überhaupt Anfang November noch ihre Zimmer vermietet.
Recherchen im Internet hatten ergeben, dass viele Hotels um diese Jahreszeit bereits geschlossen sind, aber wir zogen es sowieso vor, privat zu wohnen. Dabei erfährt man meist eine ganze Menge über den Ort, die Menschen und bekommt alle möglichen Informationen, die auch für unser Vorhaben durchaus nützlich sein konnten. Sicherheitshalber hatten wir sogar unsere Schlafsäcke und Trainingsanzüge mitgenommen, um notfalls auch in einem ‚Mobile Home’ auf dem ganzjährig geöffneten Campingplatz nicht allzu weit vom Ort nächtigen zu können.
Der Anruf erwies sich als positiv; wir konnten ein Zimmer für die beiden Nächte haben, sollten uns aber noch etwas Zeit lassen und erst am frühen Abend vorbeikommen. Also nutzten wir die noch verbleibende Zeit, um nochmals zu ‚unserem‘ Haus zu fahren, die Umgebung bei Nachmittagssonne zu betrachten, die Sicht auf das Meer zu genießen, die Grenzen des Grundstückes herauszufinden (was uns nicht gelang) und auf unserer inzwischen angefertigten ersten Zeichnung die Ungereimtheiten aus der vorherigen Vermessung der Räume am Vormittag zu korrigieren.
Für Anfang November war dies ein unglaublich schöner und warmer Tag – zwischen 20° und 22° C, alles war grün, in den Gärten glänzten die Blätter der Olivenbäume silbern in der Sonne, die Bougainville blühte noch immer verschwenderisch, auch Oleander und Bleiwurz hatten noch genügend Blüten, die Orangen und Zitronen waren fast schon reif zum Ernten – wir waren einfach hingerissen!
Danach fuhren wir noch ans Meer, um den nächstgelegenen Strand zu erkunden, und wir fanden gleich drei Möglichkeiten in der Nähe. Natürlich war es um diese Zeit überall menschenleer. Wir entschieden uns, den Weg durch die Mimosenbüsche ans Meer zu nehmen. Ein sanfter Wind streifte Haut und Haare; die Luft roch leicht salzig. Wir rannten mit hochgekrempelten Hosenbeinen in der flachen Brandung auf und ab – wir waren total glücklich und fühlten uns wie im siebten Himmel!
Langsam verschwand die Sonne hinter den grünen Hügeln, ein paar Wolken im Westen färbten sich immer mehr, bis sie erst gelb-orange und dann feurig rot erschienen: ein herrlicher Sonnenuntergang! Zurückgekehrt zum Grundstück konnten wir feststellen, wie alles zu verschiedenen Tageszeiten bei unterschiedlichem Licht wirkte (zumindest Anfang November). Hochzufrieden mit dem, was wir schon erlebt und gesehen hatten, kehrten wir wieder in den Ort zurück, um unser Nachtquartier ausfindig zu machen. Es gab auch einen Parkplatz ganz in der Nähe in einer kleinen Seitenstraße, und wir schleppten unsere Habseligkeiten hinauf in den zweiten Stock des Hauses.
Hier erwartete uns eine Überraschung, denn wir bekamen ein komplettes Appartement von etwa 70 qm mit Küche, Esszimmer, Wohnlandschaft mit offenem Kamin und einem Schlafzimmer, das sich über die gesamte Hausbreite erstreckte und zusätzlich im Südosten und Nordwesten über einen riesigen Balkon verfügte. Und das Ganze kostete inklusive reichhaltigem Frühstück nur 25 Euro pro Tag, nachdem wir außerhalb der Saison dort waren. Beim Frühstück hatten wir ‚Familienanschluss’ und konnten dabei vieles in Erfahrung bringen, was uns interessierte, ohne unsere eigenen Pläne offenzulegen (nachdem alles noch ganz unverbindlich und ohne jegliche schriftliche Grundlage war). In einem kleinen Ort kennt erfahrungsgemäß jeder jeden und solche Informationen machen schnell ‚die Runde’.
Die Leute waren unheimlich nett und hilfsbereit und führten uns sogar zu einer im Gebirgsstil (!) erbauten Villa im Ort, die zum Verkauf stünde. Das Grundstück war aber sehr klein, hatte keinen Meerblick und nur einen auf großen Umwegen erreichbaren Zugang zum Strand. Den uns genannten Verkaufspreis fanden wir trotz Hausgröße und dem sehr schön eingewachsenen, blühenden Garten ziemlich hoch. Die Leute versorgten uns auch mit weiteren Informationen über käufliche Grundstücke, davon eines hoch über dem Ort (die Aussicht war sicher gut) mit einer riesigen Antenne auf dem Grundstück und einem im positiven Sinne nicht nachvollziehbaren qm-Preis.
Für weitere Objekte empfahlen sie uns, die örtlichen Makler aufzusuchen. Da diese über die Feiertage natürlich geschlossen hatten, betrachteten wir nur die zahlreichen Angebote in deren Schaukasten und staunten über die teilweise doch ziemlich happigen Preise für relativ kleine Grundstücke und Ferienhäuser. Trotzdem hatte alles einen gewissen Informationswert für uns.
Am nächsten Morgen fuhren wir nach dem Frühstück sofort wieder zu unserem Haus, um das Gelände auch in der frühen Morgensonne zu erleben, die Aussicht aufs Meer zu genießen, das an diesem Tag ganz ruhig und glatt in der Sonne wirkte – kein tiefes Blau, weil noch ein leichter Dunstschleier darüber lag. Jeden Tag gefielen uns das Grundstück und die Aussicht noch besser und wir erwarteten gespannt die Ankunft des Eigentümers, der an diesem Nachmittag eintreffen und viele noch offene Fragen beantworten sollte.
Zum Mittagessen suchten wir uns ein Restaurant in Richtung Costa Rei und waren überrascht, wie gut es an einem Novembertag besucht war, vor allem von Einheimischen. Touristen gab es kaum um diese Zeit hier. Auch in diesem Restaurant konnten wir hervorragend essen, und zum Nachtisch servierte man uns als kleines Extra des Hauses neben einem Limoncello noch ein Körbchen mit frisch geernteten Orangen. Obwohl sie klein und äußerlich mehr grün als reif aussahen, schmeckten sie köstlich und süß. Das Restaurant Maistu Andria wurde auf jeden Fall gleich in unsere Liste aufgenommen!
Der Anruf auf dem Mobiltelefon bestätigte dann die Ankunft des Eigentümers, und wir verabredeten uns gleich auf dem Grundstück. Amüsiert hörte er zu, als wir ihm erzählten, dass wir es sofort nach unserem Eintreffen am ersten Tag ohne Weiteres gefunden hatten (es gab schließlich keine Straßennamen oder gar Hausnummern, die einem das Auffinden erleichterten – man konnte sich nur an die Beschreibung halten und das, was wir aufgrund der wenigen Fotos in Erinnerung hatten…).
Bei unserem Zusammentreffen am Nachmittag stellte uns der Eigentümer auch seinen Schwager Francesco vor, der mit seiner Familie in einem Ort etwa 15 km entfernt wohnt. Dem italienischen Dialekt nach war Francesco gar kein Sarde sondern vom Kontinent; ein Neapolitaner, wie er stolz sagte, und seine Frau – bedingt durch die berufliche Laufbahn beim Militär an einem Nato-Stützpunkt im Westen der Insel – hier kennen gelernt hatte. Mittlerweile ist er in Pension und konnte sich daher immer wieder etwas um den Baufortschritt am Haus kümmern. Auch viele Behördengänge für die nötigen Genehmigungen wurden von ihm erledigt.
Gemeinsam besichtigten wir das Haus und stellten zum einen oder anderen Punkt, der uns aufgefallen war, entsprechende Fragen. Dass der Baubeginn des Hauses nun schon Monate zurücklag, muss man auch aus den Gegebenheiten vor Ort verstehen. Viele Sarden fangen nach Erhalt der Baugenehmigung zwar an zu bauen, machen aber immer nur weiter, wenn sie wieder Geld zur Verfügung haben.
Außerdem wird ein Haus meist nicht, wie dies in Deutschland überwiegend der Fall ist, über eine Bank finanziert. Aber auch die Zuverlässigkeit (oder vielleicht eher die Unzuverlässigkeit) der Bauunternehmen oder anderer Handwerker tut ein Übriges, warum der Bau nicht allzu schnell fortschreitet. Weitere Verzögerungen können sich durch nicht vorhandene oder verspätet eingegangene Genehmigungen ergeben. Zwar sollte der Bau nach den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 3 Jahren beendet werden, aber die Genehmigung kann unter Umständen auch verlängert werden. Das führt dazu, dass man innerhalb und außerhalb vieler Orte unzählige Rohbauten und Häuser in verschiedenen Stadien der Fertigstellung sieht, die zuerst den Eindruck vermitteln, es gäbe viele Bauruinen, die zum Verkauf stünden.
Auch die in den vergangen Jahren immer wieder geänderten Bauvorschriften – je nach Politiker und Parteiprogramm – tun das ihrige dazu. Viele der Häuser werden bereits bezogen, auch wenn sie nur leidlich bewohnbar sind. Die endgültige Fertigstellung kann Jahre dauern, oft auch 5 oder gar 10 Jahre und mehr. In vielen Fällen stimmen die tatsächlichen baulichen Gegebenheiten nicht unbedingt mit denen auf der erteilten Genehmigung überein, und es gibt auch viele Schwarzbauten. Teilweise wurden ganze Häuser gebaut, obwohl auf dem Plan vielleicht nur ein Lagerraum beantragt worden war.
Dieses Vorgehen ist leider nicht nur auf Sardinien sondern auch in vielen südlichen Regionen Italiens gang und gäbe. Oft ist die tatsächliche Nutzung eine andere als die offiziell angegebene – Lagerräume dienen dann inoffiziell doch Wohnzwecken. Dies hängt natürlich auch mit der Versteuerung der Gebäude zusammen. Die endgültige Eintragung des Hauses in das öffentliche Kataster erfolgt oft erst nach relativ langer Zeit (oder auch gar nicht…). Damit kann man auch eine Zahlung der fälligen Steuern und Abgaben weit nach hinten schieben. Wie man uns sagte, lassen manche Eigentümer die offizielle Registrierung auch erst bei einem Verkauf oder bei Vererbung durchführen.
Allerdings wurde in den letzten Jahren (zuletzt 1999) vom italienischen Staat immer wieder die gesetzliche Möglichkeit einer sog. ‚Heilung‘ (condono) eingeräumt, bei der man nachträglich gegen Zahlung einer nicht allzu großen Strafe – abhängig vom Grad der Abweichung bzw. des Missbrauchs – die nötige Genehmigung erhalten konnte. Das brachte zusätzliches Geld in den Staatssäckel, und es gab danach einige Schwarzbauten weniger.
Inzwischen wird in vielen Regionen überhaupt keine Genehmigung mehr zum Bau von Häusern direkt am Meer erteilt. Und viele, die in den vergangenen Jahren davor zurückschreckten, einen Schwarzbau auf ein schönes Grundstück in Meernähe zu setzen, ärgern sich jetzt, dass sie es seinerzeit nicht doch getan haben, nachdem ihre Nachbarn, die auf ‚Risiko’ gesetzt hatten, nun die Genehmigung auf dem ‚Heilungswege‘ nachträglich erreichten.
Bei dem zum Verkauf stehenden Rohbau auf dem Grundstück kam noch dazu, dass der Eigentümer aus gutem Grund immer nur dann weiterbauen ließ, wenn er für einige Wochen vor Ort war, um die Arbeiten selbst beaufsichtigen zu können. Der Fleiß, die Zuverlässigkeit (und manchmal auch die Sorgfalt) ortsansässiger Handwerker halten sich teilweise, wie fast überall im Süden, sehr in Grenzen. Es ist sicher besser, an Ort und Stelle zu kontrollieren, was zu tun ist, den Arbeitern notfalls ‚Druck zu machen’ oder sie auch einzubremsen, wenn Dinge mangels entsprechender Aufsicht nicht richtig bzw. schlampig durchgeführt wurden.
Der Verkäufer beabsichtigte, auch dieses Mal wenigstens 2 Wochen an seinem alten Heimatort zu verbringen und in dieser Zeit die Bauarbeiten weiter voranzutreiben. Nachdem wir uns mündlich mittlerweile mehr oder weniger handelseinig waren, konnten bereits einige unserer Vorstellungen für den weiteren Ausbau dabei einfließen.
Für das Bohren des erforderlichen Brunnens war inzwischen die Genehmigung beantragt worden (es geht dort immerhin um eine Tiefe von 70 – 90 m, wobei wir mittlerweile wissen, dass in manchen Landstrichen auf Sardinien bis zu 120 m und mehr nötig sind, bis man auf Wasser stößt).
Auch der Auftrag für die Errichtung eines ersten, einfachen Zaunes war erteilt (bei der Größe des Grundstücks selbst in solcher Ausführung ein kleines Vermögen) und auch der Stromanschluss vom Nachbarn bereits bis zur Grundstücksgrenze geführt. Der geometra (Vermessungsingenieur), der für die endgültige Bestimmung der Grundstücksgrenze einschließlich zusätzlicher Zeugen für die erneute Markierung nötig ist, wusste bereits Bescheid. Die meisten der vorherigen Markierungen, die aus einfachen Eisenstangen bestanden, waren wohl einigen Leuten irgendwie nützlich erschienen und somit verschwunden.
Der Eigentümer schritt bei dieser Gelegenheit mit uns auch das ganze Grundstück in etwa ab, und wir konnten kaum fassen, dass es noch um ein knappes Drittel weiter reichte als vermutet – bis in eine Senke, durch die in regenreicheren Zeiten, meist im Frühjahr, ein Bach von den Bergen herab sein Bett sucht. Große Mengen an kleinen und großen Steinen in dem ausgetrockneten Bachbett waren dafür eindeutige Anzeichen. Nur gut, dass der sicher im zeitigen Frühjahr möglicherweise sogar zum Sturzbach anschwellende Wasserlauf weit genug vom Haus entfernt ist und zudem erheblich tiefer liegt!
Wir waren jetzt schon sehr gespannt, was das Leben dort, auch wenn es anfangs nur einige Wochen im Jahr sein würden, alles für uns an Überraschungen bereithalten würde – ein Leben auf dem Land und Natur pur!!! Allerdings ging uns bei der Betrachtung des Grundstücks wieder durch den Kopf, wie viele Stunden Arbeit allein für die Bepflanzung von einigen 100 qm rund um die Terrasse nötig sein würden – bei unserem Besuch lag dort nur eine Unmenge Schutt und darunter war ausgetrockneter, harter und steiniger Boden. Der größere Teil des Geländes, das wir demnächst unser Eigen nennen wollten, würde noch ganz andere Herausforderungen bringen, auch wenn wir nicht vorhatten, ihn als Garten anzulegen. Wir wollten nämlich – der Entsprechung eines landwirtschaftlichen Anwesens folgend – Olivenbäume pflanzen, wie es auch schon einige unserer Nachbarn getan hatten.
Dazu wäre allerdings einiges Wissen nötig, um überhaupt damit zu starten und noch mehr, um nach einigen Jahren tatsächlich Erfolg, sprich eine zufriedenstellende Ernte, damit zu haben. Der beste Weg war sicher, bei einheimischen Olivenbauern Rat einzuholen, möglichst gut umzusetzen und vielleicht auch regelmäßige Hilfe dabei zu erbitten. Ob und in welcher Form das gelingen könnte, würde eine weitere Herausforderung sein.
Einen anderen Teil des Grundstücks müssten wir vorerst sicher so belassen, wie er derzeit war; wilde macchia mit großen und kleinen Büschen, olivastri (wilden Olivenbäumen) und einigen stacheligen, kleinen Bäumen mit winzigen und total holzigen Birnen – allerdings ohne den immer wieder von den weidenden Ziegen verursachten Verbiss, denn nach Errichtung des Zaunes würden sie nicht mehr ‚einfallen‘ können.
Dem regelmäßig dort vorbeiziehenden Ziegenhirten mit Hunderten von Tieren passte die ganze Sache natürlich nicht besonders. Er hatte sich nach Aussage des Eigentümers bei seinem letzten Aufenthalt auch schon massiv bei allen möglichen Stellen versichert, dass auf jeden Fall die von der Gemeindewasserleitung gespeiste Wasserstelle am unteren Ende des Grundstücks, wo auch ein Weg vorbeiführt, für ihn oder besser für seine Ziegen frei zugänglich bleibt. Der Zaun wurde also zwangsläufig an dieser Stelle etwas innerhalb der eigentlichen Grundstücksgrenze entlang geführt, obwohl nach den einschlägigen Vermessungen auch dieser Teil eindeutig zum Grundstück gehört. Aber sonst wäre nicht nur der erste Ärger gleich vorprogrammiert gewesen, sondern mit Sicherheit ein immerwährender Streitpunkt daraus geworden. Und das sollte unbedingt vermieden werden!
Nach der ausgiebigen Besichtigung von Haus und Grundstück fuhren wir gemeinsam einige Kilometer weit bis Colostrai, wo der Verkäufer vor Jahren ein weiteres Grundstück nahe am Meer erworben hatte. Aufgrund der knappen Entfernung zum Strand (und der inzwischen geänderten Gesetze) darf man es aber nicht mehr bebauen. Daher befindet sich nur eine kleine Holzhütte auf dem Grundstück, die zum Übernachten zwar mit Strom und Wasseranschluss ausgerüstet wurde, aber außer für Ferien nicht weiter nutzbar ist. Der Zugang zum Strand beträgt höchstens 100 m…
Wir machten anschließend noch einen Abstecher zum Haus des Fischers, der sich am nahe gelegenen stagno (Lagunensee) niedergelassen hatte und wo man Muscheln, Austern, Fische und allerlei Meeresgetier günstig und frisch kaufen kann – ein guter Tipp, den wir bei nächster Gelegenheit sicher aufgreifen würden.
Der Verkäufer hatte sich vorerst von uns verabschiedet, und daher blieb uns an diesem Tag auch für eigene Ausflüge noch etwas Zeit bevor es dunkel wurde. Wir wollten den nächstgelegenen Hafen aufsuchen, der aber als ‚porto turistico’ nur für Boote, kleinere Yachten und Motorschiffe tauglich war. Freunde hatten uns darum gebeten, da sie uns mit ihrem Segelboot im Sommer besuchen wollten.
Nach Verlassen der beiden fast aneinander grenzenden Ortschaften Muravera und Villaputzu waren es nur noch wenige Kilometer in Richtung Norden auf der SS 125, bis wir die Abzweigung zum Porto Corallo fanden. Der Hafen war offensichtlich teilweise neu angelegt worden und machte insgesamt keinen schlechten Eindruck; allerdings fehlte es noch an der für solche touristischen Häfen nötigen Infrastruktur. Ein unfertiger Neubau sollte hier wohl Abhilfe schaffen. Wir schossen ein paar hübsche Fotos in der untergehenden Sonne und fuhren danach zurück zu unserem Quartier in Muravera, um uns vom Staub zu befreien und für das Essen umzuziehen.
Wir waren an diesem Abend bei einem guten Freund des Verkäufers, mit dem wir uns persönlich immer besser verstanden, eingeladen. Dieser betreibt bei Quirra, etwa 20 km entfernt, ein sehr gutes und bekanntes Restaurant, das direkt an der SS 125 liegt. Wir sollten aber erst nach 21.30 h kommen, damit sein Freund mehr Zeit für uns alle hätte, uns persönlich zu bedienen, uns am Tisch Gesellschaft zu leisten und mit uns gemeinsam zu essen. Als wir gegen 21.45 h (was für uns schon sehr spät war) im Restaurant eintrafen, fiel uns auf, dass immer noch viele Tische belegt waren, obschon die meisten Gäste beim Käse oder Dessert angelangt waren oder einen Filu Ferru oder einen Mirto serviert bekamen.
Wir hatten zwar schon bei unseren bisherigen Reisen viele exzellente Gerichte auf Sardinien kennengelernt, denn auch wenn die sardische Küche oft als einfach und eher rustikal beschrieben wird, gibt es doch viele Köstlichkeiten, die uns immer wieder in Erstaunen versetzten. Im Landesinneren gibt es meist Menüs ‚della terra’, wohingegen an der Küste eher ‚del mare’ aufgetischt wird.
Was uns aber an diesem Abend geboten wurde, überstieg nicht nur unsere Vorstellungskraft von einem ausgezeichneten Essen, sondern erinnerte sowohl in seiner Länge als auch der Anzahl der verschiedenen Gänge (ausschließlich Fische und Meeresfrüchte) an opulente und exquisite französische Abendessen. Allein vom Tintenfisch gab es drei ganz unterschiedliche Arten als Vorspeisen, eine köstlicher als die andere. Völlig verblüfft hatte der Gastgeber uns aber mit frischen sardischen Austern, deren Aufzucht mittlerweile in den sogenannten stagnos (flachen Salzwasserseen, die mit dem Meer verbunden sind) ebenso betrieben wird wie in den flachen Étangs an der südfranzösischen Küste um Sète und in den Orten am Atlantik, in der Aquitaine.
Als Hauptgang servierte uns der Chef einen wunderbaren spigola (auch branzino oder lupo di mare, d. h. Seewolf genannt) mit einer derart zarten Konsistenz, dass er nur so auf der Zunge zerging. Natürlich sparten wir nicht an Lob für lo chef und die Küche, und wir zeigten unsere Begeisterung in typisch südländischer Weise nicht nur mit Worten, sondern mit Gesten und entsprechender Mimik. Dies machte auch in nicht ganz perfekter italienischer Sprache mehr Eindruck, als wenn wir vieles hätten übersetzen lassen müssen…
Nach 7 oder 8 Gängen – ich konnte gar nicht mehr mitzählen – mussten wir uns noch für einen hervorragenden Käse (zwei Sorten pecorino) und ein gelungenes Dessert ‚opfern‘ und befürchteten, man müsse uns anschließend aus dem Restaurant ins Auto tragen – und dies nicht wegen des Weins oder des ebenfalls noch folgenden Digestifs…
Die Begeisterung auf beiden Seiten steigerte sich in dem Maße wie die Anzahl der Gänge und unser Sättigungsgrad zunahmen, die Familiennamen waren mittlerweile längst vergessen und unwichtig, und wie es im Süden oft üblich ist, werden nach einem solchen gemeinsamen Essen aus Fremden sehr schnell Freunde! Der Restaurantchef fragte mehrmals nach, weil er nicht glauben wollte, dass wir wirklich tedeschi seien – solche Deutschen hätte er noch nicht kennen gelernt in seinem Restaurant, die meisten Urlauber würden nur Pizza oder Spaghetti, und dann auch noch eine Portion auf 2 Tellern serviert, bestellen… Was müssen wir Deutsche doch oft für einen schlechten Eindruck hinterlassen in anderen Ländern, vor allem dort, wo Essen ein ganz wichtiges, wenn nicht sogar das wichtigste Thema ist!
Es war schon sehr spät oder besser sehr früh, als wir uns auf den Heimweg machten, mit vielen guten Wünschen vonseiten des Gastgebers und einer Einladung für unseren nächsten Aufenthalt. Wir versprachen, dies auf keinen Fall zu vergessen! Auch von Ettore (inzwischen waren wir ja beim Duzen und den Vornamen angelangt), dem der ganze Abend oder eher die gemeinsam an einem Tisch verbrachte Nacht ungemein gut gefallen hatte, verabschiedeten wir uns, nachdem wir ihn vor dem Haus seiner Mutter abgesetzt hatten.
Unser Eindruck war, dass wir nach dieser Nacht eindeutig eine noch bessere ‚gemeinsame Sprache‘ mit ihm gefunden hatten, was uns sicher auch beim bevorstehenden Kauf des Hauses und der damit zusammenhängenden restlichen Fertigstellung ein großes Stück weiterhelfen würde.
Beim Frühstück am nächsten Morgen sagten wir auch unserer Gastfamilie arriverderci – es gab einen sehr herzlichen Abschied (und das nach nur zwei Tagen…), und wir wurden eingeladen, uns unbedingt bei unserem nächsten Besuch zu melden, vorbeizuschauen und wenn es nur auf einen espresso sei! Wir versprachen, auf jeden Fall anzurufen, tauschten die Telefonnummern aus und luden unser Gepäck ins Auto. Dann überlegten wir, wie viel Zeit uns noch blieb, denn vor der endgültigen Abreise wollten wir unbedingt noch einmal zum Grundstück hinausfahren.
Es war ein wunderschöner, sonniger Morgen mit einem wolkenlosen, unglaublich blauen Himmel, die Temperatur war gegen 10.00 Uhr schon bei 24° C angelangt und sollte noch 27° C erreichen – und das an einem Novembertag! Für uns phänomenal um diese Jahrezeit… Wir setzten uns auf einen großen Stein unter dem wilden, kleinen Birnbaum und versuchten, die letzten beiden Stunden, bevor wir wieder nach Olbia in Richtung Fährhafen aufbrechen mussten, ganz intensiv zu genießen und uns unseren Träumen für eine Zukunft hier vollends hinzugeben.
Es war einfach unbeschreiblich schön – die Sonne und die Wärme, die sie im November noch ausstrahlte, der tiefblaue Himmel, der Blick aufs glitzernde Meer, die grünen Hügel hinter uns, die Stille, die nur vom Gezwitscher einiger Vögel unterbrochen wurde. Wir malten uns in allen Farben aus, wie schön das Leben hier wohl für uns einmal sein würde… im Garten zu arbeiten, das Gelände herzurichten, Bäume zu pflanzen, Fische oder Meeresfrüchte zuzubereiten und gemütlich und entspannt auf der Terrasse zu essen, Freunde einzuladen, im Winter zu malen und schreiben, Bücher zu lesen und dabei immer die Natur und die Ruhe zu genießen!
Solche Aussichten machten uns fast schwindlig vor Glück, und wir konnten uns kaum losreißen, obwohl die Uhr mahnte… Genug der wunderschönen Träume – es half alles nichts; wir mussten losfahren.
Gerade als wir das Gelände verlassen wollten, erschreckten uns ein paar waghalsige Motocross-Fahrer, die offensichtlich die kleinen, unbefestigten Straßen für ihren ‚Sport’ nutzten. Sie kamen wie die Verrückten den Hügel abwärts gerast, eine riesige Staubwolke hinter sich herziehend, und nahmen die Kurven mehr stehend als sitzend auf ihren Zweirädern – wie sie allerdings um die Kurven herum ein Hindernis erkennen wollten, schien mir schleierhaft – Gott sei Dank, waren wir noch nicht auf den Weg eingebogen; ich hätte sie ungern auf der Motorhaube landen sehen… Hoffentlich würde der Weg unterhalb des Grundstücks im Sommer dann keine Rennstrecke für solche waghalsigen ‚Sportskanonen’ sein!
Überhaupt haben die Sarden – ähnlich wie die Neapolitaner – eine ungeheuer ‚dynamische‘ Fahrweise: Nicht nur, dass die jungen Männer gerne schnell fahren; sie kommen einem in Kurven grundsätzlich auf der eigenen Fahrspur entgegen (oder mindestens in der Mitte davon). Auch die Geschwindigkeiten, mit denen sie die Kurven ‚nehmen‘, sind oft schwindelerregend! Wenn ich dann wieder einmal versuchte, diesen rasanten Fahrern in den Kurven nur annähernd so schnell zu folgen (schaffte ich meist sowieso nicht), handelte ich mir immer sofort die entsprechende Schelte von meinem Beifahrer ein…
Auf dem Weg nach Norden zur Fähre wollten wir unbedingt noch einen Zwischenstopp einlegen, um für die leiblichen Genüsse zu Hause in Deutschland ein paar lokale Spezialitäten zu besorgen: ein paar Flaschen sardischen Cannonau (ein typischer Rotwein auf Sardinien), roten und weißen Mirto (ein 30%iger, likörartiger Aperitif oder Verdauungsdrink, je nach Zeitpunkt und Gusto, sowie Pecorino und eine Packung Carta di musica (eine sardische Brotspezialität, die ihren Namen Notenblättern verdankt, weil sie fast so dünn ist).
Nachdem wir gut in der Zeit lagen, um rechtzeitig zur Fähre zu kommen, konnten wir auf der SS 125 in einem kleinen Restaurant an der Straße noch eine pasta und einen espresso auf der Terrasse genießen, einen letzten, kurzen Abstecher an den Strand machen, die Füße ins sardische Meer strecken und uns ein paar der nachmittäglichen Sonnenstrahlen auf den Rücken scheinen lassen.
Dann musste es aber schnell gehen, obwohl zu dieser Jahreszeit notfalls auch 30 Minuten vor Abfahrt genügen, um noch auf die Fähre zu kommen, vor allem, wenn man das Ticket schon in der Tasche hat. Trotzdem ist war es besser, nicht in den letzten Minuten anzukommen.
Den Sonnenuntergang betrachteten wir bereits von der Fähre aus, und es erfasste uns wieder die schon von früheren Fahrten bekannte, wehmütige Stimmung, sobald wir die enge Hafenausfahrt verließen und langsam aufs offene Meer hinausfuhren.
Auf der Rückfahrt von Livorno nach Firenze tauchten wir ins erste Schlechtwettergebiet ein und fuhren durch Regen und Nebel über die Bergstraßen nach Bologna und Modena. Das schlechte Wetter blieb uns weiterhin treu, und in der Poebene auf der Strecke nach Verona hatten wir richtig dicken Nebel und das typische Novemberwetter, wie wir es auch in Deutschland zu dieser Jahreszeit gewöhnt sind. Verständlicherweise sehnten wir uns schon auf der Rückreise wieder in die sonnigen Gefilde von Sardinien zurück und wären am liebsten gleich wieder umgekehrt.
Wie wir bei unserem Besuch im November erfahren hatten, lag der letzte richtige Regen schon 7 oder 8 Monate zurück – von ein paar kleinen, unbedeutenden Schauern abgesehen, die für die herrschende, große Trockenheit kaum etwas gebracht hatten. Man könne sich gar nicht mehr an den genauen Zeitpunkt erinnern und Regen wäre jetzt mehr als dringend erforderlich. Dieser extreme Niederschlagsmangel erklärt auch die Tatsache, dass fast jeder mit ein bisschen mehr als nur einem kleinen Garten auf jeden Fall einen eigenen Brunnen hat, denn die Wasserleitung der Gemeinde kann in sehr heißen und niederschlagsarmen Jahren ganz unerwartet immer wieder einmal ‚austrocknen‘, d. h. es gibt dann eben an einem Tag für einige Stunden kein Wasser! Gerade im Süden des Landes scheint dies in der Vergangenheit sehr oft der Fall gewesen zu sein, und die Trockenheit wird dann wirklich zum Problem.
Damit war für uns auch klar, dass wir bei Ettore unbedingt massiv darauf drängen mussten, sich rechtzeitig um den Brunnen zu kümmern, der uns von solchen Problemen ziemlich unabhängig machen sollte. Am besten wäre es, jetzt in der trockensten Zeit bohren zu lassen, um sicher zu gehen, dass er auch tief genug würde.
Mit 24.090 qkm ist Sardinien zwar die zweitgrößte Insel Italiens, hat aber in Europa die niedrigste Bevölkerungsdichte. Von den ca. 1,6 Millionen Einwohnern leben allein ca. 400.000 in der Hauptstadt Cagliari und den angrenzenden Orten. Ein Großteil der restlichen Bevölkerung verteilt sich auf die übrigen größeren Städte Oristano, Nuoro, Sassari und Olbia sowie Alghero, Santa Teresa di Gallura, Porto Cervo an der Costa Smeralda (wo auch mit Olbia einer der beiden größten Passagierhäfen und der zweitwichtigste Flughafen Sardiniens ist) sowie Arbatax, Tortoli und noch weitere kleinere Städtchen im küstennahen Bereich. Das Landesinnere ist dagegen wenig besiedelt. Seit 1948 ist Sardinien eine autonome Region innerhalb Italiens und weiter unterteilt in verschiedene Provinzen).
Auf Sardinien wird vor allem Ackerbau (Getreide, Reis, Wein, Oliven und Südfrüchte) sowie Viehzucht (überwiegend Schafe, Ziegen und Schweine, in manchen Gegenden auch Rinder) betrieben. Eine der Haupteinnahmequellen ist mittlerweile aber auch der Tourismus, allerdings ist für viele Sarden dadurch nur ‚Saisonarbeit’ verfügbar.
Die Ansiedlung von Industrie ist leider nicht so geglückt, wie man sich dies erhofft hatte, und die Arbeitslosenrate liegt durchschnittlich bei ca. 20 %. Viele junge Sarden wanderten daher schon in den 60er Jahren ab und hofften, anderswo in Italien, vor allem im Norden oder gar in anderen Ländern Europas bessere Chancen vorzufinden.
Dieser Trend hält immer noch an bzw. hat sich nach einigen Jahren nun wieder verstärkt.
Auch früher war das Leben auf Sardinien immer von Kargheit geprägt, dazu kamen Krankheiten und Seuchen. Die Malaria war Mitte des letzten Jahrhunderts – also vor gerade einmal 50 Jahren – in Sardinien immer noch ein riesiges Problem. Zwar ist sie seit den 50er Jahren definitiv ausgerottet, aber auch heute noch tragen viele Sarden (man sagt sogar, jeder dritte…) die Folgen als schwere Bürde ihrer Vorfahren. Es handelt sich dabei um die Beta-Thalassämie, die besonders bei den Bewohnern der Mittelmeerländer gehäuft vorkommt und eine genetisch bedingte Erkrankung des Blutes ist.
Bei den Betroffenen ist die Bildung des roten Farbstoffs, der den Sauerstoff in den Organismus transportiert, gestört. Entstanden ist die Thalassämie in den Gebieten, die früher von der Malaria heimgesucht wurden. Die veränderten Blutkörperchen waren gegen die Seuche immun, was zwar vor ihr schützte, aber andere Probleme mit sich brachte. Vor allem dann, wenn man die schwere Form von seinen Eltern geerbt hatte, die Thalassämie major. Früher überlebten die Erkrankten das Kleinkindalter gar nicht, heute haben sie eine gute Chance. Wenn man unter dieser Krankheit leidet ist, benötigt man alle 3 Wochen eine Bluttransfusion. Weil dadurch anscheinend aber zu viel Eisen in den Körper gelangt, muss es mit einem Medikament ‚weggefangen’ werden – eine aufreibende Prozedur: 10 – 12 Stunden lang steckt sich der Patient eine Spritze in den Bauch und lässt die Medizin langsam in den Körper laufen – jeden Tag!
Dass eine solche Krankheit und die daraus folgenden Konsequenzen kaum mit einer regelmäßigen Arbeit und damit entsprechendem Einkommen in Einklang zu bringen sind, wird jeder verstehen, und das heißt, dass der Patient nicht für sich selbst aufkommen kann und auch sonst das normale Leben schwer beeinträchtigt ist! Diese Einzelheiten hatte ich aus einer Zeitschrift entnehmen können – von den Einheimischen bekommt man darüber wenig zu hören, außer es gibt Betroffene im Bekanntenkreis, bei denen man zwangsläufig etwas mitbekommt.
Aber zurück zu unseren eigenen, immerhin weniger ernsten Problemen. Als wir uns nach der Rückkehr von Ettore Mitte November wieder bei ihm trafen, stellte ich ihm eine Frage, die mir erst in der Zwischenzeit eingefallen war, nämlich wie die Abwassersituation in dieser Region, speziell einige Kilometer außerhalb der nächsten Ortschaft und im Besonderen auf einem landwirtschaftlichen Grundstück gelöst wird. Ich wurde mit der Information konfrontiert, dass hierfür natürlich nur eine auf dem Grundstück noch zu installierende private ‚Mini-Kläranlage’ mit Sickergrube (Imhoff – der Name ist anscheinend vom Hersteller abgeleitet) infrage kommt.
Alle Häuser auf Grundstücken in der Umgebung, also vor allem diejenigen, die außerhalb geschlossener Ortschaften gelegen sind, sind normalerweise damit ausgestattet. Leider waren in unserem Fall noch keinerlei Vorbereitungen dafür getroffen worden. Die Sickergrube musste also noch ausgehoben, die nötigen technischen Vorrichtungen wie Filteranlage, Abdeckung, etc. eingebaut und dann die Abwasserkanäle dorthin geführt werden.
Allmählich wurde die Liste der noch zu bewältigenden Aufgaben und Arbeiten immer länger und es wurde nötig, sich über viele Dinge nochmals ausführlich mit Ettore, dem Verkäufer, auszutauschen, vor allem, welche Arbeiten bis wann von ihm noch durchgeführt werden sollten. Wir hatten ursprünglich aus Kostengründen sogar ins Auge gefasst, das Grundstück nur mit dem Rohbau zu erwerben und dann selbst nach und nach alles fertig zu stellen – davon waren wir aus verständlichen Gründen mittlerweile wieder abgekommen und nicht nur, weil wir erkannt hatten, dass wir in den nächsten beiden Jahren viel zu wenig Zeit auf unserem Grundstück verbringen konnten.
Nach einigem Nachdenken waren wir uns aber auch einig, dass das Haus auf jeden Fall provisorisch bewohnbar sein sollte, bevor wir es endgültig übernehmen und den Kaufvertrag unterschreiben. Dazu gehörte auch, dass die Treppe ins Obergeschoss eingebaut, die Bäder installiert, alle Leitungen, ob Strom oder Wasser verlegt und die Böden gefliest wären. Auch der Kamin, der sowohl von außen als auch von innen beheizbar und damit mit 2 Zügen ausgestattet sein sollte, würde dann noch gebaut werden müssen. Denn irgendeine Art von Wärmequelle ist an manchen Abenden auch im tiefen Süden dringend notwendig, selbst wenn wir uns voraussichtlich in den beiden kältesten Monaten des Jahres vielleicht nicht dort aufhalten würden.
Inwieweit unsere Vorstellungen dann mit der Realität übereinstimmen würden, war jetzt noch nicht abzusehen. Jedenfalls war eine Heizung bisher baulich nicht vorgesehen, und wir fragten uns, ob wir dies nicht vielleicht noch in Betracht ziehen sollten. Zuletzt beschlossen wir, erst einmal für einige Zeit, vor allem den Winter über, regelmäßig Wetterseiten im Internet zu befragen, um festzustellen, wie sich die Temperaturen dort entwickeln, welche unteren Wärmeoder eher Kältegrade sie im schlechtesten Fall erreichen. Erst dann war es sinnvoll, eine Entscheidung in dieser Sache treffen.
Wie wir von Bekannten hörten, sind November und Dezember üblicherweise noch sehr schöne und warme Monate und 18° C im Dezember (oder sogar um einiges darüber) durchaus möglich. An der Sonne konnte es auch wesentlich wärmer werden, unter Umständen 25° – 28° C. Richtig kalt würde es eigentlich erst im Januar und Februar werden - teilweise nur zwischen 8° C und 14° C tagsüber. Nachts dagegen könnte das Thermometer durchaus manchmal bis auf 4°/6 ° oder im Extremfall sogar auf 0° C abfallen, wohingegen die Temperaturen im März schon wieder zum Leben im Freien einladen.
In diesen Monaten gibt es auch die meisten Niederschläge – im Norden auf den Bergen oft als Schnee, aber hier im Süden nur als Regen, der in seltenen Fällen durchaus auch Tage anhalten kann.
Deshalb ist gerade im Winter die Landschaft unglaublich grün, fast unwirklich, und viele aromatische Kräuter wie Rosmarin und Lavendel, aber auch der gelbe Klee und andere Pflanzen blühen dann. Im zeitigen Frühjahr ist die üppigste Blütenpracht zu sehen; viele Arten von Pflanzen und Büschen, die wild wachsen, wie gelbe Margeriten, weiße Kamille, Zistrosen und eine Pflanze, die intensiv blau blüht, produzieren selbst auf einem solchen im November noch ganz vertrocknet und unwirtlich erscheinenden Grundstück am Hang einen unglaublichen Blütenteppich in den schönsten Farben! Allein, wenn wir daran dachten, freuten wir uns schon riesig, im März wieder nach Sardinien zu fahren…