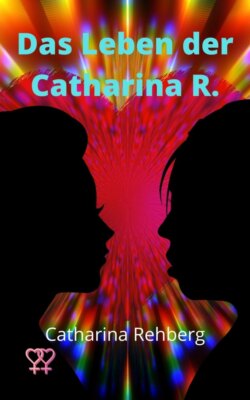Читать книгу Das Leben der Catharina R. - Catharina Rehberg - Страница 4
Kapitel 1
ОглавлениеDa stand ich nun also in meinem neuen Leben. Diese kleine Insel sollte also meine neue Heimat sein. Irgendwie hatte ich sie mir deutlich anders vorgestellt. Was ich sah, war eigentlich nicht groß anders als in meiner alten Heimat, dem Ruhrpott. Gut, das Wetter war deutlich besser hier. Es war Anfang November, und als ich in Deutschland gestartet bin, zeigte das Thermometer frostige 8 Grad unter null. In Bochum, wo ich geboren und aufgewachsen war, lag noch Schnee. Hier stand ich nun vor dem Flughafen und vor meinen Augen drehte sich alles. Als ich aus dem verglasten Flughafengebäude in die Freiheit trat, umfing mich sofort eine unglaubliche Hitze.
Drinnen war die Temperatur noch angenehm und auch mein Kreislauf machte nicht die kleinsten Probleme. Die Tür nach draußen war für mich wie der Schritt in ein neues Leben und sofort zeigten sich die ersten Veränderungen. Mir wurde schwarz vor Augen und ich stand plötzlich nicht mehr ganz so sicher auf meinen kurzen Beinen. War mein Nikotinspiegel dafür verantwortlich? In meiner Handtasche suchte ich nach einer Zigarette und meinem Feuerzeug. Das hatte man mir zum Glück bei der Sicherheitskontrolle bevor ich in das Flugzeug geklettert war gelassen. Schon der erste Zug löste einen langen nicht mehr erlebten Hustenreiz aus. Anstatt das es mir besser ging, wurde es noch deutlich schlechter. Neben mir stand vor einem Blumenkübel eine Holzbank. Ich musste mich dringend setzen, bevor ich gleich an meinem ersten Tag hier umkippte. Die Holzstreben der Bank waren von der Sonneneinstrahlung deutlich zu warm. Das meldeten auch meine Hinterbacken durch die Jeans, die ich für den Flug angezogen hatte.
Aufstehen klappte trotzdem nicht mehr. Mir war schwindelig und konnte mich auf absolut nichts konzentrieren. Mein großer Koffer neben mir stand noch in der prallen Sonne. Ich brauchte ein paar Minuten, bis ich wieder halbwegs normal aus den Augen sehen konnte. Erst dann erschloss sich mir, wo ich eigentlich gelandet war. In Deutschland, die Heimat, die ich hinter mir lassen wollte, war es schon Winter und eiskalt. Hier saß ich in meinen langen Jeans und dem dicken Pullover auf einer Holzbank vor dem Flughafen. Es sah nicht wirklich großartig anders aus als noch in Bochum. Nur die wehenden grünen Palmen und die farbigen Blumen passten überhaupt nicht ins Bild. Ich musste den Pullover ausziehen, denn der Schweiß lief mir schon in strömen übers Gesicht.
Das ist also die Karibik. Meine neue Heimat. Fühlte sich noch nicht danach an. Aber wie kommt eine junge Frau, mit ihren gerade mal 26 Jahren dazu sich ein neues Leben auf einer kleinen Insel in der Karibik aufzubauen. Die Antwort lag in meiner Vergangenheit begründet. Als ich am 10. März 1967 das Licht der Welt erblickte, hatte ich eine schöne Kindheit vor mir. Meine Mutter war schon lange vor meiner Geburt von meinem Vater alleine gelassen worden. Er brachte sein Geld mit Prostituierten und Alkohol durch. Ich habe ihn nie kennengelernt, aber durch die Erzählungen meiner Mutter konnte ich mir dann doch ein ganz gutes Bild machen. Mit ihr verbrachte ich die ersten paar Lebensjahre in einer kleinen Wohnung in Bochum.
Während ich noch nicht mitbekam, was um mich herum passierte, war auch alles in Ordnung. Meine erste Erinnerung setzt ein, als ich zarte drei Jahre alt war. Ich spielte im Sandkasten mit Plastikförmchen, während meine Mutter sich mit den anderen Müttern in der Sonne sitzend unterhielt. Morgens wurde ich dann zu Oma und Opa gebracht und meine Mutter ging zur Arbeit in ein großes Kaufhaus. Danach schob man mich in den Kindergarten ab, wo ich dann bis zum Nachmittag bleiben musste. Mir gefiel das nicht wirklich. Ich durfte zwar spielen, wie ich wollte, aber da waren viel zu viele andere Kinder, mit denen ich nicht unbedingt etwas zu tun haben wollte. Die waren mir viel zu laut und schrien den ganzen Tag nur herum.
Zu Hause durfte ich bei meiner Mutter in der Küche mit Teig matschen oder das frisch duftende Essen umrühren. Sie setze mich dazu neben den Herd auf die Arbeitsplatte, drückte mir einen langen Holzstiel in die kleine Hand und ich durfte dann rühren. Das machte mir sehr viel Freude. Im Hintergrund dudelte ein Radio und meine Mutti schnitt Gemüse, Fleisch oder sonstiges Zeug, während sie mir versuchte, den Text der Lieder durch Mitsingen beizubringen. Singen konnte ich aber nicht. Aber mein Leben war eigentlich schön.
Mit zunehmendem Alter kam dann der Zeitpunkt, an dem ich eine große aus Pappe zusammengeklebte Tüte in die Hand gedrückt bekam und mit den anderen Kids, die ich bereits aus dem Kindergarten kannte, vor ein großes Gebäude gestellt wurde. Man nannte es Einschulung und in der Tüte waren jede Menge Süßigkeiten. Aber das große Gebäude sollte ich nicht sehr lange in guter Erinnerung behalten, da konnten auch die ganzen süßen Sachen in der Tüte nichts daran ändern. Ich musste mich mit anderen Muttis herumschlagen, die mir Buchstaben und weiteren Unsinn zeigten. Wenn es wenigstens beim Zeigen geblieben wäre, aber ich sollte sie auch noch selber auf Papier malen. Dieser ganze Unsinn dauerte ganze vier Jahre und ich durfte kaum noch das machen, was mir Spaß bereitete.
Allerdings fiel anderen Leuten in dieser Zeit noch etwas anderes an mir auf. Dieses kleine Mädchen mit den schwarzen Haaren und den braunen Augen war ganz anders. Während andere Kinder schrien und kreischten, mit hochrotem Kopf auf Möbel und Einrichtungen einschlugen, saß ich immer wie völlig unbeteiligt daneben. Auch hatte man sie nie weinen sehen. Irgendwas stimmte mit dem Mädchen nicht. Als meine Mutter darauf angesprochen wurde, konnte sie sich auch nicht daran erinnern, mich weinend oder schreiend gesehen zu haben. Es kam einfach nie vor.
Mutti schleifte mich als Nächstes zu meinem Kinderarzt. Der stellte mich einmal auf den Kopf, um danach festzustellen, dass mir nicht das Geringste fehlte. Körperlich war ich kerngesund. Aber wenn man gerade da war, spricht ja nichts dagegen das Kind gleich noch gegen irgendwas zu impfen. Also Spritze in die Hand, und dann rein damit in den Oberarm. Erst dabei fiel auch dem Arzt auf, dass mit dem Mädchen auf der großen Liege etwas nicht in Ordnung war. Jedes Kind reagiert zwar anders auf Spritzen und Nadeln in der Haut, aber eines haben sie alle gemeinsam, sie beginnen zu weinen. Nur das kleine Mädchen zeigte sich völlig unbeeindruckt und ließ alles ohne einen Ton über sich ergehen. Also gleich noch einmal. Nächste Spritze ab in die Armbeuge und ein bisschen Blut aus den Adern geholt. Aber auch hier zeigte ich keine erkennbare Reaktion.
Viele Ärzte später stand dann die Diagnose fest. Die kleine Catharina litt unter einer besonderen Krankheit, die man in Fachkreisen Alexithymie nennt. Umgangssprachlich nannte man das auch Gefühlskälte. Im alten Griechenland bezeichnete man es auch als Ataraxie, ein Zustand, in dem es einem völlig gleichgültig war, was um einen herum passierte. Catharina konnte man nicht aufregen, egal was man auch anstellte. Das war für die junge Mutter und die Großeltern ein großer Schock. Das nächste Problem sollte aber noch um einiges heftiger ausfallen. Ich brachte die ersten vier Jahre auf der Grundschule zu Ende und wechselte dann auf eine Gesamtschule, um noch mehr zu lernen.
Irgendwann begannen mich meine Mitschüler zu ärgern, merkten aber ziemlich schnell, dass es unsinnig war, so etwas zu versuchen. Das machte nur Spaß, wenn sich das Mädchen aufregte oder eine Reaktion darauf zeigte. Ich zeigte aber keine der allgemein üblichen Wirkungen darauf, sondern blieb völlig ruhig und entspannt. Auch konnte man an meinem Gesicht nichts ablesen, was auf Gefühle hindeutete. Das brachte also keinen Spaß für die anderen und man ließ mich in Ruhe. Trotzdem schaffte ich es irgendwann, Freundschaften zu schließen. Die Schule war mir eigentlich egal aber es machte mir Freude mich mit meinen Freundinnen zu unterhalten.
Meine Großeltern starben dann auch irgendwann kurz nacheinander und Mutti hatte eine Menge zu tun. Sie musste sich um die Beerdigungen kümmern und ich hörte sie sehr oft etwas tun, was mir nie passieren würde. Abends im Bett heulte sie die Kissen voll. Ich fühlte zwar auch Trauer um meine liebe Omi und den lustigen Opa, konnte es aber nicht zeigen. Meine Mutter machte das fast wahnwitzig. Während sie jeden Tag am Weinen war, zeigte ich nicht ein bisschen Mitgefühl. Innerlich zwar schon, aber an meiner Miene konnte man das nicht ablesen. Alles war wie immer für mich. Allerdings begann Mutti mit etwas anderem. Sie betäubte ihren Schmerz immer öfter in Alkohol. Nach der Arbeit begann sie Bier zu trinken und erst am späten Abend hörte sie wieder damit auf. Sie war zu dieser Zeit sehr launisch und auch nicht mehr wirklich gut auf mich zu sprechen. Ich war zwar noch ihre Tochter, aber sie zeigte mir eigentlich nur noch die kalte Schulter, schrie mich an wie ein Irre oder ignorierte mich einfach.
Die Wirkung auf mich beeinflusste das eigentlich kaum. Tief in meinem Inneren war es mir zwar nicht völlig egal wie sie mich behandelte, aber nach außen hin konnte ich es einfach nicht zeigen. Als ich dann älter wurde und sich langsam die Verwandlung vom Mädchen zur Frau einsetzte, fingen ganz andere Probleme an. Ich wusste einfach nicht, was mit mir los war. Meine Freundinnen in der Schule begannen sich langsam ihrem Alter entsprechend für die Jungs zu interessieren. Sie versuchten, mir zu entlocken, welcher Mitschüler mir gefiel. Ich konnte es aber nicht benennen. Da passierte einfach nichts. Die Mitschüler waren mir völlig egal. Es war keiner dabei der mich interessierte oder den ich irgendwie toll fand.
Meine Freundinnen gingen die ersten Beziehungen ein, machten ihre ersten zarten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht und ich stand wie ein Stein daneben. Die Jungs auf der Schule hielten auch einen gewissen Abstand zu mir. Es war einfach für sie nicht zu erkennen, ob ich irgendetwas für sie empfand. Einige versuchten zwar, bei mir zu landen, und machten sich dafür auch regelmäßig zum Affen, aber sie blitzten alle ab. Eine Freundin von mir hatte eine besondere Schwäche für jeden Einzelnen. Solange er einen geraden Satz herausbrachte, war sie von ihm begeistert. Dabei war es ihr auch völlig unwichtig, wie er aussah oder wie er sich benahm. Wenn da Testosteron durch die Blutbahn floss, war er für sie genau richtig. Mit mir passierte allerdings etwas völlig anderes. Ich begann meine wenigen Freundinnen auf einmal mit anderen Augen zu betrachten.
Das, was sie in den Jungs sahen, entdeckte ich im Stillen bei ihnen. Ich genoss es regelrecht, wenn wir uns zur Begrüßung in den Arm nahmen. Das war für mich im geheimen das Schönste am ganzen Tag. Sie bemerkten das natürlich nicht, denn mein Gesichtsausdruck war immer der gleiche. Eine davon gefiel mir besonders. Sie hatte sehr hübsche leicht grüne Augen und ein wundervolles Lächeln. Emma hieß sie und war erst seit Kurzem in Bochum. Ihre Eltern waren von Dortmund nach Bochum umgezogen, weil ihr Vater eine besser bezahlte Arbeit gefunden hatte. Ihr schien es auch nichts auszumachen, das ich ganz anders war. Während sich die anderen Freundinnen ihren geliebten Jungs widmeten, blieben wir beiden meist alleine zurück.
Im Laufe der Zeit wurde Emma meine beste Freundin. Wir sprachen über alles Mögliche, was die Mädchen und jungen Frauen damals interessant fanden. Musik, Mode, in ihrem Fall auch ein oder zwei Jungs, allerdings war sie viel zu schüchtern um sie anzusprechen. Es verging kaum ein Tag, an dem wir nicht wie zwei Glucken aufeinander saßen. Die Jungs fand ich nicht anziehend, dafür aber Emma. Mit der Zeit entwickelte ich sehr intensive Gefühle für meine Freundin. Immer öfter ertappte ich mich selbst dabei, davon zu träumen, sie einfach zu küssen. Das, was die Mädchen von ihren Freunden erzählten und wie sie sich dabei fühlten, traf in erschreckender Weise auf mich mit Emma zu. Das war alles völlig neu für mich und ich konnte es nicht zuordnen. Was stimmte mit mir denn nicht?
Während die anderen aus meiner Clique mit ihren Freunden erlebten, wollte ich mit Emma erleben. Ich hatte das dringende Bedürfnis, sie zu berühren, zu umarmen oder zu küssen. Die ganzen Jungs erzeugten dieses Gefühlschaos nicht in mir. Sie waren mir zusehends total egal. Meine Zeit verbrachte ich am liebsten mit Emma. Nach der Schule trafen wir uns bei ihr oder in der Stadt, hörten Musik oder kauften uns die Jugendzeitschriften, die man in dem Alter eben so liest. Schlauer wurde ich dadurch aber nicht. Alle Artikel in jeder Zeitschrift handelten von Frauen und Männern. Nirgendwo wurde mir erklärt, ob es diese Gefühle auch zwischen zwei Frauen oder Männern gab. War das einfach nicht vorgesehen oder sogar verboten? Ich versuchte mit meinen, damals noch begrenzten Mitteln irgendetwas, in dieser Richtung zu finden, aber auch die Bibliothek konnte mir meine Fragen nicht beantworten.
Kurz vor meinem vierzehnten Geburtstag wusste ich so ziemlich alles über menschliche Fortpflanzung, aber nichts über meine Gefühle zu Emma. Ihr fiel das aber, aufgrund meiner Krankheit, auch nicht auf, was ich für sie empfand. Ich durfte also weiter träumen, sie wie zufällig berühren und in den Arm nehmen. Um mir mehr Geld zu verdienen, weil mein Taschengeld sehr begrenzt war, durfte ich an Wochenenden auf den vierjährigen Sohn unserer Nachbarn aufpassen. Der kleine Karsten war ein quirliger Bursche. Wenn seine Eltern unterwegs waren und ich auf ihn aufpassen durfte, um mir ein paar Mark dazuzuverdienen war ein richtiger Sonnenschein. Er freute sich jedes Mal, wenn er mich an der Tür sah. Er wusste, dass seine Eltern lange weg waren, und freute sich auch darauf, viel länger, als gewöhnlich, wach bleiben zu dürfen.
Seine Eltern durften davon natürlich nichts erfahren, aber Karsten war clever und verlor keinen Ton davon. Wir machten viele Gesellschaftsspiele, versuchten uns an einigen Puzzles, deren Teile mit mehr Erfahrung auch kleiner wurden und spielten Karten. Dann machten wir es uns auf der Couch gemütlich und sahen fern. Irgendwann konnte er einfach nicht mehr die Augen offen halten und schlief ein. Dann hab ich ihn ganz vorsichtig in sein Bett getragen und zugedeckt. Seine Mutter war immer glücklich, wenn ich auf ihn achtete. Ihr raubte er den letzten Nerv mit seiner ständigen Fragerei und seinem Rumgerenne in der Wohnung. Mir machte das nicht das Geringste aus. Aufregung war für mich ein Fremdwort, das schaffte auch der Kurze nicht. Mir machte das sogar Spaß, auf ihn aufzupassen und die paar Mark, die ich dafür bekam, waren mir auch sehr recht.
Am 10. März, meinem vierzehnten Geburtstag trafen meine Freundinnen bei mir zu Hause ein. Meine Mutti hatte an diesem Tag gnädigerweise sogar auf Alkohol verzichtet, um nicht als schlechte Mutter dazustehen und sogar einen Kuchen für mich gebacken. Emma, die sowieso fast jede freie Minute mit mir verbrachte, war die Erste, die bei mir in der Tür stand. Sie schenkte mir einen selbst gebastelten Kalender und eine Musikkassette, die sie extra für mich gekauft hatte. Da wir alleine waren und ich mich dafür bedanken wollte, drückte ich sie an mich und gab ihr sogar einen kleinen Kuss auf die Wange. Sie schrieb diese große Gefühlsregung meinem Geburtstag zu und dachte sich nichts weiter dabei. Für mich allerdings war es etwas völlig anderes. Emma war für mich mehr, als nur eine Freundin, wie sie jedes Mädchen in dem Alter hat. Auch die anderen Gäste trafen nach und nach ein. Wir hatten viel Spaß und feierten ausgelassen meinen Geburtstag.
Der Tag sollte aber für mich noch etwas ganz Besonderes werden. Da ich wusste, dass Emma die Letzte sein würde, weil sie den kürzesten Weg nach Hause hatte, wollte ich sie endlich küssen. Nach und nach gingen die anderen, bis Emma und ich wieder alleine waren. Wir saßen in meinem Zimmer auf dem Bett, hörten ein bisschen Musik von der neuen Kassette und blätterten in einer Zeitschrift. Ich spürte sie ganz eng neben mir und bekam langsam den Mut, den ich brauchte. Nach einigen Minuten schenkte sie mir einen wirklich aufregenden Blick aus ihren grünen Augen. Ohne noch weiter zu zögern, zog ich sie näher zu mir und küsste ihre Lippen. Allerdings hielt das Glücksgefühl in meinem Innern nicht besonders lange an. Sie wich zurück, machte ein erschrockenes Gesicht und rannte dann zur Tür hinaus. Das erste Mal in meinem Leben hatte ich ihr gegenüber meine Gefühle gezeigt und sie ließ mich alleine.
Damit begann aber ein ganz anderes Drama, von dem ich noch keine Ahnung hatte, wie sehr es mich verletzen würde. Am nächsten Tag, vor der Schule wartete ich wie immer auf meine beste Freundin Emma. Ich erkannte sie schon von Weitem, aber sie lief, ohne mich eines Blickes zu würdigen, an mir vorbei ins Schulgebäude. Was am Tag zuvor noch meine beste Freundin war, ließ mich jetzt einfach stehen. Ich lief ihr hinterher und rief mehrfach ihren Namen. Sie beachtete mich nicht mehr. Sogar in der Klasse, in der wir direkt nebeneinandersaßen, beachtete sie mich nicht mehr. Der schlimmste Schlag folgte aber erst noch. Als unsere Lehrerin hereinkam, meldete sich Emma als Erstes und bat darum, sich umsetzen zu dürfen. Mir tat das furchtbar weh, konnte es aber natürlich nicht zeigen. Der Tag sollte aber noch viel schlimmer werden, als ich mir das hätte ausmalen können.
In der großen Pause stand ich alleine mit meiner Milch und dem Brötchen auf dem Schulhof. Meine ganze Clique, meine Freundinnen tuschelten mit Emma und hielten sich von mir fern. Ich war den ganzen Tag alleine und meine Freundinnen zerrissen sich hinter meinem Rücken den Mund über mich. Schlimmer konnte es eigentlich nicht mehr werden, dachte ich bei mir. Aber bereits am nächsten Tag wurde ich eines Besseren belehrt.