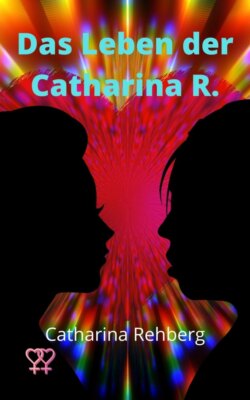Читать книгу Das Leben der Catharina R. - Catharina Rehberg - Страница 8
Kapitel 5
ОглавлениеErst dachte ich, wir stehen in irgendeinem zugigen Keller, aber das, was sie mir zeigte, war keine Wohnung oder ein Appartement. Es war ein einzelner Raum, der etwas von einem Kellerverlies hatte. Und auch hier schlug mir wieder dieser modrige Geruch in die Nase. Hier sollte man wohnen können? Spätestens nach dem ersten Aufwachen bekam man hier schon Depressionen. Da hätte ich meine aus Deutschland gar nicht erst mitbringen müssen. Die Einrichtung ließ dafür keine Wünsche offen. Ein Puppenbett wie aus einem Miniaturhaus, ein schwerer dunkler Schrank, sowie ein wackliger Tisch mit einem Stuhl davor. Die kleine Kochnische mit einem winzigen Kühlschrank und eine verdreckte Spüle an der Wand komplettierte das Loch. Ich blickte mich um auf der Suche nach einer Tür zum Badezimmer. Wenn schon wohnen, dann doch bitte auch mit einer Toilette und wenigstens einer Dusche. Da war aber weiter nichts. Nur die Eingangstür, die im Wind wackelte.
»Das Badezimmer ist am anderen Ende des Flurs«, erklärte sie mir, als wenn sie meine Gedanken erraten hätte.
»Und wann, sagtest du, kommen die Zuchthauswärter vorbei?«
»Gefällt es dir nicht?«, fragte sie mit leicht belustigtem Ton.
»Oh doch, natürlich! Ich verspüre das dringende Bedürfnis, meinen Kopf gegen die Wand zu werfen und mir eine Kugel in den Kopf zu ballern.«
»Spaß verstehst du auch keinen«, grinste sie mich an und ich konnte ihr ansehen, dass sie auf eine Gefühlsregung in meinem Gesicht wartete. Aber da war natürlich nichts zu erkennen.
»Vielleicht sollte ich etwas erklären. Ich bin krank und kann keine Gefühle zeigen. Auf ein Lachen wartest du also vergeblich.«
Sie machte ein sorgenvolles Gesicht. Dann sagte sie, »Ich hatte mich schon gewundert, weil deine Mimik die ganze Zeit aussah wie eine Maske. Zuerst vermutete ich Botox, aber dann wäre wenigstens ein bisschen was zu sehen gewesen.«
»Du könntest mir den Arm brechen, oder mich anzünden und würdest trotzdem nichts sehen.«
Ich erkannte Verständnis in ihren Zügen, als sie sagte, »Okay, das war wirklich nur ein Scherz. Hier will natürlich niemand wohnen. Aber falls du die billigste Wohnung auf der Insel suchst, weißt du jetzt, wo du sie findest. Dieses schmucke Heim kostet 100 Dollar im Monat!«
100 Dollar? Geschenkt wäre noch zu teuer gewesen. Ich wollte nur noch dort weg und eine, wenn auch kostspieligere Wohnung sehen, in der ich, wenn möglich, einige Monate zubringen konnte. Wir verließen die Bruchbude wieder durch den finsteren Gang nach unten. Als ich wieder in den Wagen klettern wollte, den sie unverschlossen stehen ließ, hielt sie mich zurück. Sie zeigte auf die andere Straßenseite und bat mich, ihr zu folgen. Dieses Haus sah schon wesentlich besser aus. Die Fassade war in einem leichten Gelb gehalten und der Weg zur Haustür war mit hellen Platten ausgekleidet. Das entsprach schon eher meinen Erwartungen. Doch kurz vor der Eingangstür bog sie nach rechts ab und zog mich hinter ihr her. Es handelte sich dabei um eine Einliegerwohnung mit separatem Eingang. Als sie die Tür öffnete und den Blick in die Wohnung ermöglichte, fühlte ich mich sofort zu Hause. Die Wohnung war hell und freundlich eingerichtet, besaß ein geräumiges Badezimmer, sogar mit Badewanne und machte einen sauberen Eindruck. Leider fand ich keine Küchenzeile und das war der große Nachteil. Mein Geld als Startkapital hatte, reichte einfach nicht, um mir eine Küche zu kaufen. Auch die monatliche Miete lag weit über meinem Budget. Ich konnte mir das einfach nicht leisten.
Wir brauchten noch zwei weitere Versuche eine Wohnung zu finden, in der ich bleiben konnte. Letztendlich entschied ich mich für eine Zweizimmerwohnung in einem Mehrfamilienhaus nahe der American University of the Caribbean School of Medicine, die sogar einen kleinen Balkon hatte. Der Ausblick erfreute mich. Das Meer war zu sehen, es gab ein paar schattenspendende Bäume und es war ruhig. Aber sie hatte bedauerlicherweise nicht nur Vorteile. Zum einen lag sie sehr weit ab von der Stadt und in der Nähe gab es keinen Supermarkt. Nächster Nachteil, sie lag auf der niederländischen Seite der Insel. Das bedeutete, ich brauchte auch noch ein Visum, um überhaupt dortbleiben zu dürfen. Und es tauchte gleich noch das nächste Problem auf. Wie bezahlt man eine Wohnung ohne Bankkonto. In meinem feinen Plan für die ersten Tage hatte ich nämlich genau das nicht bedacht. Sehr peinlich für eine Bankkauffrau. Der nächste Rückschlag ereilte mich dann in Form einer Erklärung. Wer auf der französischen Seite ein Konto eröffnen wollte, musste eine Wohnung sowie mindestens drei Monate Strom und Wasserrechnung nachweisen.
Ich brauchte also eine andere Bank. Nämlich dort wo ich jetzt wohnte, und dafür braucht man ein unbegrenzt gültiges Visum. Meine Probleme häuften sich und ich hatte große Lust einfach alles hinzuschmeißen. Es kann doch nicht so schwer sein ein neues Leben anzufangen, aber irgendjemand warf mir ständig neue Knüppel zwischen die kurzen Beine. Anstatt einen Mietvertrag hatte ich jetzt eine Liste mit Punkten, die ich abarbeiten musste. Enttäuscht und müde fuhr ich wieder in mein Hotel zurück. Ich brauchte dringend eine Pause, und was könnte es da Schöneres geben, als ein paar Stunden am Strand zu liegen, Sonne zu tanken und ein bisschen im Meer zu schwimmen. Alleine der Gedanke heiterte mich schon auf. Es war November, in Deutschland kämpften sie mit Eis und Schnee und ich lege mich einfach an den Strand. Anstatt mich um meine Liste zu kümmern, zog ich mir meinen neu gekauften Bikini an und packte mir einige Handtücher ein.
Mit meiner Tasche machte ich mich auf den Weg zu dem großen Strand, wo auch die riesigen Kreuzfahrtschiffe vor Anker lagen. Das waren von meinem Hotel gerade mal ein paar Minuten zu Fuß. Trotz der vielen Sorgen, die an mir nagten, verbrachte ich einen schönen Nachmittag an dem Strand mit dem fast weißen Sand und dem türkisblauen Meer. In Bochum wäre ich um diese Zeit fast erfroren und hier schwamm ich im warmen Meer, gönnte mir noch ein großes Eis und etwas später am Abend auch noch ein leckeres Abendessen. An der Straße, die oberhalb des Strands parallel verlief, gab es ein nettes Restaurant. Da setzte ich mich an einen freien Tisch und bestellte mir Chicken Alfredo. Das war Hähnchenfleisch in einer Käsesauce mit anständig Knoblauch auf Nudeln. Ich hätte mich auf den Teller legen können, so lecker war das. Als die Sonne dann hinterm Horizont verschwand, was aufgrund der Nähe zum Äquator schon gegen 18 Uhr passierte, machte ich mich auf den Weg zum Hotel.
Die Dusche an dem Abend war eine Tortur. Dieser feine Sand kroch buchstäblich in die kleinste Ritze. Ich hatte ein eher ungewolltes Ganzkörperpeeling. Noch unangenehmer war allerdings das Scheuern des Sandes in meinem Intimbereich. Je mehr Wasser an mir herunterlief, umso mehr Sand fand sich an mir. Das nächste was ich nach der Körperpflege getan habe, war mir einen Plan für den nächsten Tag zurechtzulegen. Ich brauchte dringend ein Konto und ein Visum. Außerdem hatte ich immer noch nicht nach einem billigen Auto gesucht und meine neue Heimat immer noch nicht erkundet. Aber es gab auch etwas Positives. Den restlichen Abend habe ich vor dem Fernseher verbracht. Das hat mir enorm geholfen Englisch zu verstehen. Die ganzen Serien waren auf Englisch und ich konnte damit meine Sprachfähigkeiten verbessern.
Nach dem Frühstück am nächsten Tag machte ich mich auf den Weg zu der Obrigkeit. Ich brauchte unbedingt ein Visum für ein Konto, damit ich auch meine Wohnung bekam. Leider war ich dabei nicht wirklich so erfolgreich, wie ich mir das wünschte. Denn ein Visum gab es nur, wenn ich einen Job hatte. Was war das nur für ein dämliches Spiel? Alles war völlig verdreht. Nur wo sollte ich einen Job hernehmen? Die Bank wollte mich ja wegen meiner begrenzten Englischkenntnisse nicht einstellen. Ich brauchte aber einen Job damit es voranging. Auf dem Weg zurück kam ich am Hafen vorbei, wo gerade ein schönes Schiff anlegte. Es war die Horizon, die gerade vom Meer in den Hafen einlief. Da ich sonst nichts weiter tun konnte, sah ich mir das Schauspiel aus der Nähe an. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Menschen auf so einem Kreuzfahrtschiff ihren Urlaub verbrachten und wie viele auf eines davon passten. Der ganze Steg war überfüllt von Menschen, die sich erst langsam an Land bewegten.
Als sich die Reihen etwas lichteten, fiel mein Blick auf ein Büro vor dem viele Besucher noch immer warteten. Interessiert sah ich etwas genauer hin und entdeckte ein Schild auf dem stand Help needed. Ich brauchte doch einen Job und wenn die schon suchen sprach ja nichts dagegen sich da zu bewerben. Mehr wie schiefgehen konnte es ja nicht. Was hatte ich schon zu verlieren? Ich wartete bis der größte Andrang weg war und betrat dann das Büro. Eine helle Schönheit hinter dem Tresen blitze mich mit ihren strahlend weißen Zähnen an. Auf dem Namensschild auf ihrer Bluse stand der Name Rochelle. Die erste Frage die sie mir nach der freundlichen Begrüßung stellte war, ob ich mich bereits entschieden hätte.
»Ja, ich habe mich für einen Job entschieden«, sagte ich zu ihr.
Sie schenkte mir ein wunderschönes Lächeln und bat mich einen Moment zu warten. Sie musste erst den Geschäftsführer rufen der gerade unterwegs war. Für die Wartezeit bot sie mir einen Kaffee an, den ich gerne annahm. Überall an den Wänden hingen Angebote für Tagesausflüge auf der Insel. Die Preise kamen mir ziemlich gesalzen vor, aber das sollte mich nicht stören. Ich wollte ja Geld verdienen und nicht ausgeben. Nach etwa einer halben Stunde stellte sich mir ein älterer untersetzter Mann als Grant Atkins vor. Er trug kein Namensschild, dafür aber eine dicke Hornbrille mit Fensterscheiben als Gläsern. Was mir an ihm auffiel, war das rosafarbene Hemd, was er trug und ihm ziemlich um die Brust spannte. Er warf mir einen abschätzenden Blick zu und bat mich in sein Büro am Ende des Ganges. Ich dachte, ich würde erfrieren. In seinem Büro war es so kalt wie in einem Kühlschrank. Um den Job zu bekommen, versuchte ich ihn mit dem bisschen Englisch was ich konnte, zu überzeugen. Das spielte für ihn aber kaum eine Rolle. Er legte mehr Wert darauf, welche Fremdsprachen ich konnte. Als er deutsch als meine Muttersprache hörte, sah ich ein deutliches Grinsen über sein Gesicht huschen. Ich brauchte nur knapp zehn Minuten bis ich den Arbeitsvertrag in der Hand hatte. Mein erster Arbeitstag sollte der fünfzehnte November sein. Das hieß, ich hatte noch elf Tage Zeit meine Aufgaben zu erledigen.
Dann fiel mir auf, dass ich ja jetzt mit dem Arbeitsvertrag mein Visum bekommen konnte. Es war ja noch früh am Tag. Also kehrte ich wieder zur Verwaltung zurück und legte der Sachbearbeiterin den unterschriebenen Arbeitsvertrag vor. Nach nicht einmal zwanzig Minuten hatte ich mein unbegrenztes Visum, solange ich dort arbeitete. Ich konnte es kaum glauben, wie schnell ich jetzt meine Liste abarbeiten konnte. Mit dem neuen Visum besuchte ich die Bank, um ein Konto zu eröffnen und machte mich dann auf den Weg zu meiner Maklerin für den Mietvertrag. Dann erlaubte ich mir ein kleines Mittagessen. Nachmittags wollte ich meine Ersparnisse noch auf mein Konto einzahlen. Da war es definitiv sicherer als in dem kleinen Safe in meinem Hotelzimmer. Im Kopf überschlug ich kurz, was ich pro Tag eigentlich an Geld bräuchte. Was sollte ich auch großartig an Geld mit mir herumtragen. Hochgerechnet auf eine Woche kam ich auf knapp einhundert Dollar. Das würde mir für eine Woche als Bargeld locker reichen. Dann fiel mir erst auf, dass ich kaum noch Dollar hatte, dafür aber jede Menge Deutsche Mark. Ich hatte ja nicht wirklich viel Geld umgetauscht. Da ich sowieso gerade in der Nähe der Wechselstube war, nahm ich einen kleinen Umweg. Der aktuelle Umtauschkurs war für mich interessant. Das Glück schien mir zum ersten Mal seit vielen Jahren einen grandiosen Tag zu bescheren. Der aktuelle Kurs war höher als bei meinem ersten Umtausch und die Bank erhob weniger Gebühren als die Wechselstuben.
Plötzlich hatte ich deutlich mehr Geld eingeplant als ich tatsächlich brauchen würde. In Deutschland hatten Karsten und ich überlegt wie viel Geld ich benötigte um hier neu starten zu können. Unsere Berechnungen lagen bei mindestens fünf Monaten plus Auto und Miete. Jetzt hatte ich für über vier Monate zu viel Geld gesammelt als ich eigentlich brauchte. Ehrlich gesagt, wenn meine Krankheit mich würde strahlen lassen hätte ich den Vergleich mit der Sonne locker gewonnen. Zum ersten Mal spürte ich keine Depression mehr, sondern Glück und eine unglaubliche Freude. Dieses Gefühl wollte ich mir unter allen Umständen bewahren. Warum konnte es die ganzen vergangenen Jahre nicht so sein? Okay, das warum war eigentlich klar. Als Homosexuelle hatte ich einen extrem schweren Beginn in Deutschland. Hier wusste ja noch niemand was davon und ich wollte das auch Geheimhalten so lange es nur ging. Würde das hier jemand herausfinden, wäre mein Abenteuer schneller zu Ende als ein Spielfilm im Fernsehen. So weit sollte es unter gar keinen Umständen kommen. Ich war bereit meine eigene Sexualität bis an mein Ende zu verleugnen, wenn ich dafür nicht mehr leiden musste.
Philipsburg kannte ich jetzt schon ziemlich gut, aber meine Wohnung lag nicht in Philipsburg, sondern in der Nähe des Golfplatzes. Die Gegend kannte ich allerdings noch nicht. Ich sollte sie mir unbedingt genauer ansehen. Das sollte ich dringend noch erledigen bevor ich mein Hotel aufgab und in das Appartement zog. Allerdings gab es ja noch das Problem mit dem Auto. Meinen Mietwagen konnte ich ja nicht ewig behalten. Dieses ewig waren noch ziemlich genau vier Tage, dann müsste ich ihn für viel Geld verlängern oder einen gekauft haben. Es musste ja nichts Großes sein. Mit meiner kurzen Körperlänge reichte ja auch ein Kleinwagen. Das hatte auch den Vorteil, dass er nicht so viel Benzin brauchen würde. Davor drückte ich mich schon die ganze Zeit. Den Wagen sollte ich wirklich mal volltanken, aber die Spritpreise von Deutschland kannte ich ja noch. Da wurde es regelmäßig ziemlich teuer. In Bochum zahlte man für einen Liter Benzin damals schon 1,35 D-Mark. Die Benzinpreise an den Tankstellen hier lagen allerdings auch in diesem Bereich. Allerdings waren es Dollarpreise, also rein rechnerisch ungefähr die Hälfte.
Ich kehrte zurück in mein Hotel und nahm das Geld aus dem Safe. Dann setzte ich mich wieder in den Mietwagen und fuhr zu meiner Bank. Die Angestellte hinter dem Schalter staunte nicht schlecht, als ich bereits zum zweiten Mal an diesem Tag vor ihr stand. Ich übergab ihr meine Barmittel und bat sie es umzutauschen und auf mein Konto einzuzahlen. Das dauerte eine ganze Weile. Sie musste erst zweimal mühsam nachzählen, dann den Betrag umrechnen, die Gebühr abziehen und dann auf meinem Konto vermerken. Was ich allerdings toll fand, war die Kontokarte. Während man in Deutschland teilweise über zwei Wochen darauf warten musste, gab es sie hier gleich bei der Kontoeröffnung schon dazu. Den vierstelligen Code für den Automaten konnte man direkt vor Ort festlegen und schon 24 Stunden später brauchte man keinen freien Schalter mehr. Ich hätte niemals vermutet, dass die angeblichen Entwicklungsländer den Deutschen um Lichtjahre voraus waren. Noch dazu waren sie deutlich entspannter und freundlicher. Zeit hatte hier eine ganz andere Bedeutung.
Allerdings hatte das mit der Zeit nicht nur Vorteile, wie ich feststellen musste. Die Menschen waren zwar ruhig und umgänglich, aber wenn man Wartezeit hatte, konnte man irre werden. Die berühmten fünf Minuten, die man in Deutschland so gerne nannte, konnten hier auch gerne mal zwei Stunden bedeuten. Das war insbesondere dann extrem anstrengend, wenn man an einem Schalter stand und auf etwas warten sollte. Niemand mochte es, wenn man einfach mal eine Dreiviertelstunde blöd in der Gegend stand, weil man in der Zwischenzeit auch noch etwas anderes erledigen konnte. Das passierte mir in den ersten Tagen hier häufig. Immer wieder hatte ich Wartezeiten zu überbrücken, die mir schier endlos erschienen. In Deutschland war man es ja gewohnt alles sofort zu bekommen, und die zitierten fünf Minuten waren meist auch kürzer. Hier dehnten sie sich aus wie Kaugummi. Das ist für die ungeduldigen Deutschen nicht nur ungewohnt, sondern auch unendlich nervig.
Auf der Rückfahrt von der Bank zu meinem Hotel leuchtete bereits die Tankanzeige in meinem Hyundai. Ich musste dringend tanken, bevor ich mit ihm irgendwo liegen blieb. Am Ende der Simpson Bay, wo auch meine Bank ihre Filiale hatte, fand sich auch eine Tankstelle einer großen Kette. Gezwungenermaßen brauchte ich neues Benzin und überlegte schon, wie viel Geld mich das wohl kosten würde. Außerdem hoffte ich inständig, dass man in der Nähe der Zapfsäule auch solche übergroßen Plastikhandschuhe bekommen würde. Ich mochte es nicht, wenn ich mit dem Treibstoff in Berührung kam. Der Geruch war mir eigentlich egal, aber dieses Geschmiere an den Fingern war nichts für mich. Ich fuhr also an die Tankstelle und hielt an. Doch bevor ich mich aus dem Auto zwängen konnte, erschien schon ein freundlich lächelnder junger Mann neben meinem Fenster und fragte mich, wie viel Benzin ich haben wollte. Ich war baff. Man musste nicht selbst tanken, man wurde einfach betankt.
Um meine Barmittel ein bisschen beisammen zuhalten entschied ich mich für einen Betrag von 30 Dollar. Der junge Mann grinste mich weiter an und gab mir zu verstehen, dass er nicht glaubte, dass in den Tank meines Mietwagens so viel Sprit passte. Gut, er musste es wissen, immerhin war es sein Job und er hatte sicher schon tausende Autos betankt. Ich bat ihn darum, das Auto dann vollzumachen, aber bei 30 Dollar aufzuhören. Lächelnd nahm er den Hahn und steckte ihn in den Zugang meines Kleinwagens. Dann hörte ich auch schon das bekannte Geräusch, wenn Benzin in den Tank gepumpt wird. Aus meinem Seitenfenster erkannte ich die Zahlen, die sich erhöhten. Ich wunderte mich nur, warum der Preis im Gegensatz zum Sprit so langsam anwuchs. Bei knapp 17 Dollar blieb es dann auch und das Betanken war beendet. Ich hatte in meinem dummen Kopf wieder etwas übersehen. Der Preis auf der Anzeigetafel war pro Gallone angegeben. Eine Gallone waren immerhin fast vier Liter. Das musste ich erstmal verdauen. Ich bezahlte meine Rechnung bei dem jungen Mann mit 20 Dollar und rollte vom Gelände der Tankstelle.
Der Preis pro Gallone war halb so viel wie in Deutschland für einen Liter. Das hieß, ich bezahlte nur ein Viertel dessen, was ich kannte. Ich hatte mir völlig unnötig Gedanken gemacht. Keine schmierigen Finger durch das Benzin. Ich musste nicht den Wagen verlassen und bezahlte fast nichts für Benzin. Konnte es eigentlich noch besser werden? Scheinbar war das ein Tag in meinem Leben an dem alles funktionierte. Die Glücksfee musste heute direkt auf meiner Schulter sitzen. Schon den ganzen Tag lief alles wie am Schnürchen. In Deutschland hätte ich mir direkt einen Lottoschein gekauft. Hier belohnte ich mich stattdessen mit einem Eis und einem Kaffee mit herrlichem Ausblick auf das Meer. Jetzt brauchte ich nur noch einen Autohändler der mir etwas Billiges anbieten konnte. Dann erinnerte ich mich an das eine Autohaus was ich gesehen hatte als ich vom Flughafen zu meinem Hotel gefahren war. Der war nur wenig entfernt und ich entschied mich da mal vorbeizuschauen.