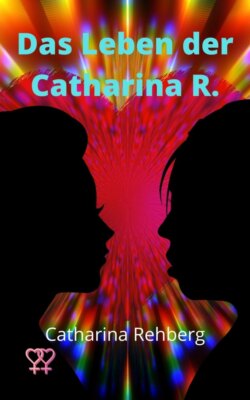Читать книгу Das Leben der Catharina R. - Catharina Rehberg - Страница 7
Kapitel 4
ОглавлениеDa saß ich also nun auf der kleinen Insel Sint Maarten vor dem Princess Juliana International Airport auf einer Bank in der Sonne und wartete darauf, dass sich mein Kreislauf wieder beruhigte. Die Zigarette in meiner Hand hatte sich schon selbst geraucht. Meine Beine zitterten und vor meinen Augen wurde es immer wieder kurz schwarz. Ich versuchte es mit leichten Bewegungen, um meinen Kreislauf anzuregen, damit es mir besser ging. Das dauerte fast eine viertel Stunde, bis ich wieder halbwegs auf dem Damm war. Erst dann wurde mir bewusst, wie schön es hier eigentlich war. Die Sonne schien, es war sommerlich warm und die Luft roch frisch nach Salz und ein bisschen nach Blumen. Vor allem war sie nicht so verstaubt, wie in Bochum, stellten meine Atemwege fest. Noch etwas anderes fiel mir auf. Nach meiner inneren Uhr müsste es schon fast wieder dunkel sein, aber die Sonne war erst kurz über ihren Zenit gewandert. Die Uhr an meinem Handgelenk vermeldete, es wäre 20 Uhr, aber die Uhr auf dem Parkplatz zeigte erst kurz nach 3 Uhr am Mittag. Ich hatte während des Fluges die Zeitumstellung komplett vergessen. Hier lag ich fünf Stunden hinter Deutschland zurück.
Das schönste, was ich dort auf der Bank erlebte, war ein junger Mann, der mich ansprach, um zu fragen, ob es mir gut geht. Ich erwähnte ihm gegenüber nur meine leichten Kreislaufprobleme, die ich nach dem Flug hatte. Seine Reaktion darauf war ein scheues Lächeln und die Frage, ob ich vielleicht etwas zu Trinken brauchen könnte. Ich verneinte und er nickte nur kurz und ließ mich alleine. Kurze Zeit später stand er wieder neben mir und servierte mir eine eiskalte Flasche Mineralwasser. Zuerst wollte ich sie nicht annehmen. Ich war mir sehr unsicher, ob das nicht vielleicht ein Versuch war mich zu betäuben und meine Reisekasse zu stehlen. Man konnte ja nie wissen, was er vorhatte. Allerdings war sie noch original verschlossen, denn der Verschluss war nicht angetastet. Er bemerkte mein zögern. Um mir zu demonstrieren, dass daran nichts manipuliert wurde, öffnete er die Flasche, ließ sich Wasser in die Hand laufen und trank es vor meinen Augen. Das überzeugte mich und ich nahm die Flasche an mich. Das kalte Wasser aus der Plastikflasche zeigte tatsächlich eine belebende Wirkung.
Natürlich wollte ich das Wasser auch bezahlen, aber das lehnte er ab. Warum sollte ich allerdings erst später erfahren! Für die ersten paar Tage meines neuen Lebens hatte ich mir ein günstiges Hotel mitten in Philipsburg, der Hauptstadt des niederländischen Teils der Insel gesucht. Das würde meine Basis werden, von der aus ich mein Leben hier aufbauen würde. Um flexibel zu sein, nahm ich mir ein kleines und günstiges Mietauto. Klein war er wirklich, aber für meine Zwecke vollkommen ausreichend. Außerdem wollte ich meine neue Heimat ja auch mal kennenlernen. Für den kleinen Hyundai bezahlte ich gleich eine ganze Woche. Der Verleiher war sogar so freundlich und half mir den großen schweren Koffer ins Auto zu legen. Hinter der Freundlichkeit vermutete ich einen psychologischen Trick, der mir einen schönen Urlaub bringen sollte. Dabei war ich gar nicht für einen Urlaub hier. Ich startete den kleinen Flitzer und fuhr der Straße in Richtung Philipsburg entgegen, wobei schleichen vielleicht der bessere Ausdruck war. Ich kam wirklich kaum voran, denn die Straße war total überlastet.
Direkt neben der Startbahn des Flughafens verlief die Straße geradeaus und ich stand im Stau. Was ich da sah, konnte ich kaum glauben. Auf der offenen Ladefläche eines Lastwagens saßen etwa 30 Menschen. Hinter dem Transporter fuhr ein Fahrzeug mit Blaulicht auf dem Dach und der Aufschrift Police. Damit wäre der Führerschein in Deutschland auf der Stelle eingezogen worden und die Menschen müssten nach Hause laufen. Aber hier? Die Männer auf der Ladefläche scherzten sogar noch mit den Beamten. Sie riefen sich über den Lärm einzelne Sätze zu und lachten. Aber die Polizisten taten nichts. Das war für mich absolut unglaublich und ich sah die Szenerie fassungslos vor mir. Dann erlebte ich noch etwas Beeindruckenderes. Auf der Startbahn zu meiner rechten wurde es furchtbar laut und der kleine Mietwagen dröhnte. Ein weiß glänzendes Flugzeug rauschte mit großer Geschwindigkeit an mir vorbei. Die vier Triebwerke unter den Tragflächen wirbelten den Sand auf der Startbahn auf. Plötzlich erhob sich dieser Koloss majestätisch in die Lüfte und drehte eine kleine Kurve nach rechts.
Nach etwa einer Viertelstunde Stillstand löste sich der Stau in Wohlgefallen auf und ich konnte weiterfahren. Der Lastwagen mit den Bauarbeitern darauf fuhr einfach los, die Beamten dahinter überholten und ich dachte, ich würde gleich wieder stehen, aber es passierte nichts dergleichen. Langsam kam ich der Stadt näher und ich genoss die Sonne auf meiner Haut. Das löste eine ganze Reihe schöner Gefühle in mir aus. Die Palmenblätter am Straßenrand bewegten sich leicht im Wind und ich erkannte den Grund für den Stau. Es war eine Brücke, die man nach oben ziehen konnte, um Schiffe in den Hafen fahren zu lassen. Aber was mich wunderte war, dass ich keine Ampel zu sehen bekam. Ich passierte drei Kreisverkehre, aber es gab keine Ampel. In Bochum wäre ich alle hundert Meter an einem roten Licht gestanden. Hier nicht einmal. Die Straße führte mich einen kleinen Hügel hinauf, die mir einen wunderschönen Blick über das Meer ermöglichte. Das Wasser zeigte verschiedene Farben und reflektierte die Sonne. Es war atemberaubend, und doch nur ein Vorgeschmack auf das, was noch folgte. Nach einigen weiteren Kurven an diesem Berghang führte die Straße mich weiter nach unten. Dann passierte ich eine langgezogene Linkskurve und sah eine lange Bucht mit weißem Sand. Davor das türkisblaue Meer und im Hintergrund drei riesige Passagierschiffe. Ich musste wirklich am Fahrbandrand stehen bleiben und dieses Bild in mir aufnehmen.
Als ich mich daran sattgesehen hatte, stieg ich wieder in meinen Mietwagen und setzte meinen Weg zu dem kleinen Hotel fort. Es lag mitten in der Stadt und bot mir das, was ich brauchte. Ein großes Bett für die kleine Catharina alleine, ein Badezimmer mit Dusche und WC und am einen kleinen Fernseher. Ich stellte meinen Koffer in den Schrank und legte mich aufs Bett. Die lange Anreise forderte ihren Tribut. Allerdings wollte ich alles, nur nicht Nachmittags einschlafen. Sonst wäre ich spätestens mitten in der Nacht wieder hellwach. Ich entschied mich für eine kurze Dusche und leichtere Kleidung. Mein Körper war von Zuhause ja die niedrigen Temperaturen gewohnt, aber hier hatte es fast 30 Grad. Dann verließ ich mein Zimmer und lief durch die Straßen. Es roch herrlich nach frischem Essen und die frische Brise vom Meer sorgte für etwas Abkühlung. Was mich erstaunte waren die Preise. An jedem Restaurant hing draußen eine Karte und dahinter standen Preise in amerikanischen Dollar angegeben. Leider hatte ich nur Deutsche Mark in der Tasche. Zu dieser Zeit war die Mark noch doppelt so viel wert wie der Dollar, beziehungsweise sogar noch ein bisschen mehr. Auf meinem weiteren Weg kam ich auch an einer Bank vorbei. Dann kam mir die Idee, ich könnte meinen Devisenumtausch ja auch gleich für eine Bewerbung nutzen.
In dem Gebäude war es richtig kühl und das Summen der Klimaanlage war dann doch etwas laut. Es sah völlig anders aus als die Bank, in der ich gearbeitet hatte. Alles war offen, es gab keine Panzerglasscheiben, nur einige Büros zu den Seiten, aber das auffälligste waren die beiden Sicherheitsmänner mit Waffen an der Hüfte. So etwas kannte ich nicht. Einer der beiden, fragte mich auch gleich, was ich wollte und ich musste feststellen, dass mein Englisch doch nicht so gut war wie ich dachte. Ich verstand den dunklen Riesen fast nicht. Dafür verstand er mich aber umso besser. Das Lernen hatte also doch einen positiven Effekt. Die Frage war nur, warum ich ihn kaum verstehen konnte. Die Lösung war eigentlich ganz einfach. Da ich die Wörter immer nur gelesen hatte und selber sprach, verstand ich nur mein Englisch. Er sprach aber mit einem amerikanischen Dialekt, verschluckte einige Silben und betonte anders. Das war mein großes Problem. Der Umtausch war gar nicht schwierig und ich durfte sogar den Filialleiter sprechen. Der war auch deutlich besser zu verstehen, allerdings waren meine Sprachkenntnisse für einen Job viel zu schlecht. Er gab mir zu verstehen, dass ich es gerne in einigen Wochen erneut versuchen durfte, aber mein Englisch musste deutlich besser werden.
Mit den erworbenen Dollars leistete ich mir ein leckeres Abendessen in einem Restaurant fast direkt am Strand. Ich suchte fast zwanghaft nach einem Haken bei der Bezahlung. Irgendetwas musste ich übersehen haben. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Essen fast nichts kostete. Als die Rechnung kam, stand aber wirklich nur der Betrag auf dem Zettel, den ich vorher schon ausgerechnet hatte. In Bochum gab es das nur in einer Currywurstbude, aber das hier war ein richtiges Restaurant. Mein nächster Weg führte mich in einen Supermarkt, denn ich brauchte noch Getränke. Mein Zimmer war nur zur Übernachtung mit Frühstück, also musste ich ein bisschen Verpflegung besorgen. Das Wasser aus dem Hahn sollte man nicht unbedingt trinken hatte ich gelesen. Es hieß man würde davon Magenprobleme bekommen, also verzichtete ich darauf. Die Preise waren aber deutlich günstiger als ich sie mir vorgestellt habe. Ich rechnete alles in die mir bekannte Währung um und war deutlich überrascht. Was ich noch brauchte, waren Zigaretten, die damals in Bochum noch vier Mark am Automaten kosteten. Hier kostete die Schachtel nur einen Dollar. Eine Stange gab es für ganze 10 Dollar. Da ich sowieso genug brauchte, nahm ich gleich mal zwei Stangen mit. Das nächste was mir auffiel, waren die zwei Preise an den Regalen. Dort stand neben den Dollarpreisen noch ein weiterer Preis in ANG angegeben. Diese Bezeichnung hatte ich überall erwartet, denn es war die eigentliche Währung. Der sogenannte Antillengulden. Aber das meistverwendete Zahlungsmittel war der amerikanische Dollar. Ausgewiesen wegen der vielen Besucher aus den Vereinigten Staaten. An der Kasse erwartete mich die nächste Überraschung, die ich nicht verstand. Hinter dem Kassenband stand ein junger Mann und packte meine Einkäufe fein säuberlich in Plastiktüten. Da ich nicht besonders viel gekauft hatte, übergab er mir die drei Tüten mit einem Lächeln und wünschte mir einen schönen Abend.
Als ich endlich wieder in meinem Hotel ankam, war ich wirklich müde. Ich fiel einfach nur noch in mein Bett und schlief wie ein Stein. Am nächsten Morgen wurde ich durch einen Vogel geweckt der vor meinem Zimmer auf einer Stromleitung fröhlich zwitscherte. Meine erste Aufgabe nach dem Frühstück war eine Wohnung zu besorgen. Möglichst günstig, da meine Geldmittel doch begrenzt waren und auf der französischen Seite, damit ich kein Visum benötigte. Meine Aufenthaltserlaubnis war auf drei Monate begrenzt, allerdings durfte ich mich ja unbegrenzt in Frankreich aufhalten. Das nächste was ich brauchte, war ein günstiges Fahrzeug und am besten einen Job. Ich startete mit einer Zeitung und durchsuchte sie nach den Wohnungsanzeigen. War eine blöde Idee, denn ich fand darin nicht eine einzige. Ich vermutete, es wäre der falsche Tag gewesen, weil man sie sammelte und nur an bestimmten Tagen abdruckte. Um diese Vermutung zu prüfen, fragte ich den Verkäufer. Er fing an zu lachen und erklärte mir, dass es keine Wohnungsanzeigen in den Zeitungen gab. Was hatte ich auch anderes erwartet? Vermietungen gab es nur an zwei Stellen. Einmal in jedem großen Supermarkt an den Anzeigenbrettern, oder über einen Immobilienmakler. Er empfahl mir letzteres, denn die geschriebenen Anzeigen in den Einkaufszentren waren meist überteuert oder mit versteckten Kosten behaftet. Also brauchte ich einen Makler. Den Weg gab er mir gleich noch mit und ich fragte mich, warum die Menschen hier alle so freundlich waren.
Aus Bochum kannte ich das anders. Die meisten Menschen kümmerten sich um ihre eigenen Belange, machten ein abweisendes Gesicht und reagierten beleidigt, wenn man ihnen eine Frage stellte. Die Antwort lieferte ausgerechnet das Kennzeichen meines Mietwagens. Oberhalb der Nummer stand darauf ›The friendly Island‹. Das erklärte auch warum alle Menschen die ich traf ausgesprochen freundlich waren. Überhaupt waren sie viel entspannter als die Bewohner meiner Heimatstadt. Ich folgte der Wegbeschreibung, sie ich von meinem Zeitungsverkäufer erhalten hatte und fand mich vor einem hell weißen Gebäude wieder, das in der Sonne glänzte. Darin fand ich aber nicht nur das Büro eines Maklers, sondern auch noch viele andere Geschäfte. Unter anderem eine Zoohandlung, einen zu klein geratenen Backshop und etwas, was ich bis dahin noch nie gesehen hatte, einen Telekommunikationsladen. Aber ich war wegen einer Wohnung hier. Für das Entdecken neuartiger Spielzeuge blieb noch genug Zeit.
Das Maklerbüro versteckte sich hinter einer dunklen Scheibe, neben der in einem Holzkasten einige Anzeigen aufgehängt waren. Ein kurzer Blick zeigte allerdings nur Häuser, die man für Summen kaufen konnte, die jenseits meines schmalen Budgets lagen. Ich betrat das Büro und sah mich zwei Schreibtischen gegenüber. Hinter dem rechten davon saß eine etwa 40-jährige Frau im Businesskostüm und blätterte in einem Ordner. Sie sah auf, und ich spürte sofort ihren prüfenden Blick auf mir. Es roch nach Papier und einem zarten Hauch eines eher holzigen Parfums. Die Dame erhob sich, kam mit einem freundlichen Lächeln auf mich zu und streckte mir ihre Hand entgegen. Sie bat mich Platz zu nehmen und fragte, womit sie mir helfen könnte. Blöde Frage, wahrscheinlich möchte ich Zigaretten kaufen und setzte mich deshalb zu einem Makler. Ich erklärte ihr kurz einige Eckdaten. Gesucht wurde eine kleine Wohnung oder ein Appartement, möglichst auf der französischen Seite der Insel, mit ein bisschen Einrichtung und für kleines Geld zur Miete. Mit jeder Bedingung wurde ihr Gesichtsausdruck ein wenig düsterer. An meinem Englisch erkannte sie, dass es nicht meine eigentliche Sprache war und fragte ganz direkt woher ich denn käme. Als ich ihr erklärte, dass ich bisher in Deutschland gelebt hatte und hier ein neues Leben anfangen wollte, wurde ihr Blick weicher und sie fing an zu grinsen. Zu meiner Verwunderung begann sie das Gespräch erneut, dieses Mal allerdings in meiner Muttersprache, mit deutlichem Akzent aus Berlin.
Man sollte es nicht für möglich halten, aber die Maklerin war vor Jahren schon aus Berlin Zehlendorf auf diese Insel gezogen und vertickte jetzt Wohnungen. Also erklärte ich ihr genau das was ich suchte erneut, allerdings in meiner Muttersprache. Sie erkannte meinen Dialekt und tippte auf Essen. Gar nicht weit weg geraten, dachte ich bei mir und nannte ihr Bochum als Heimatstadt. Sie nahm sich einen Block zur Hand und notierte die Angaben, die ich ihr gab. Computer gab es zwar schon, aber sie waren noch nicht so weit verbreitet. Auch in Deutschland in der Bank gab es damals noch keine. Die Sparbücher die ich schreiben musste wurden noch fein säuberlich von Hand geführt. Ich hasste es wie die Pest in diesen kleinen Heftchen zu schreiben und dann mit einem Lineal noch Linien zu ziehen. Sie griff sich einen dicken Ordner aus einem Regal und klappte ihn auf. Darin waren tausende Wohnungen aufgeführt. Zuerst nahm sie einen ganzen Stapel und schob ihn auf die andere Seite. Fast am Ende des Ordners waren wohl die Wohnungen, die meinen Anforderungen entsprachen.
Dann blickte sie auf, sah mir in die Augen und fragte: »Hast du heute noch was vor?«
Ich antwortete, »Nicht viel. Ganz oben auf meiner Liste steht eine bezahlbare Wohnung und wenn noch Zeit bleibt ein Fahrzeug.«
Sie notierte sich einige Daten auf ihrem Blatt, stand auf und sagte nur »Komm mit, wir finden eine Wohnung für dich!«
Wir verließen das Büro. Sie hängte ein Schild in die Tür, schloss ab und führte mich zu einem großen Geländewagen auf dem Parkplatz. Ich hatte doch einige Mühe auf den Beifahrersitz zu klettern. Dann saß ich endlich drin und sie startete den Motor. Den Blick den sie mir zuwarf, als ich meinen Gurt anlegte, konnte ich nicht einordnen. Sie lachte mich nur an und schüttelte den Kopf.
»Typisch Deutsch. Erst setzen und dann sofort den Gurt schließen. Das gewöhnst du dir ganz schnell ab.«
»Vorschrift«, erwiderte ich nur knapp.
»In Deutschland vielleicht, aber nicht hier. Keiner schnallt sich hier an und die Polizei interessiert es sowieso nicht.«
»Das hab ich bereits festgestellt als ich von Flughafen in mein Hotel gefahren bin. Aber wie kommt das?«
»Die Cops haben hier Besseres zu tun, als sich um den Verkehr zu kümmern. Es interessiert sie einen Scheiß, ob du mit 90 durch die Stadt jagst, angeschnallt bist oder so viel Alkohol geschluckt hast wie ein Kegelverein auf einem Ausflug. Solange du einen Führerschein hast, kannst du hier anstellen, was du willst.«
»Du verarschst mich doch!«
»Keineswegs. Du wirst den Verkehr bald kennenlernen. Und nur ein kleiner Tipp am Rande, du solltest es möglichst vermeiden freitags Nachmittags mit dem Auto unterwegs zu sein.«
»Okay, aber warum?«
»Freitags Nachmittags beginnt hier die Happy Hour. Die können weder gehen, noch sich artikulieren, aber fahren können sie noch. Mit den Blutproben könnte man eine Alkoholparty veranstalten. Die kippen sich mit Hochprozentigem zu, setzen sich in die Autos und machen sich auf den Heimweg. Dann sitzen sie zusammen und schießen sich ab. Das Wochenende verbringen sie dann im Delirium.«
Dann fuhr sie los und reihte sich in den fließenden Verkehr ein. Mitten auf offener Strecke bog sie in eine kleine Seitenstraße ab und beschleunigte. Das Schild zeigte eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h an. Ein kurzer Blick auf den Tacho verriet mir aber, dass sie mit 80 Sachen durch die kleine Seitenstraße bretterte. Plötzlich bremste sie stark bis auf Schrittgeschwindigkeit herunter, überfuhr eine Bodenwelle, um dann wieder zu beschleunigen. Wie durch Zauberei veränderte sich das Aussehen der Straße. Die Mittelstreifen waren nicht mehr weiß, sondern leuchteten in einem tiefen Gelb und auch die Seitenstreifen färbten sich in den gleichen Farbton. Ihr kurzer Kommentar verriet mir, dass wir soeben die Grenze überquert hatten und jetzt in Frankreich waren. Eigentlich erwartete ich Schlagbäume und Zäune an einer Grenze, aber die gab es nicht. Ein Ortsschild am Rand gab den Namen des Ortes bekannt. Ich las ›Marigot‹ als wir vorbeiflogen. Das war also die Hauptstadt des französischen Teils der Insel. Das hatte ich bereits über meine neue Heimat gelernt. Aber auch hier gab es keine Ampeln. Interessantes Konzept wie ich fand. Die Maklerin steuerte den schweren Geländewagen über einige kleine Nebenstraßen und hielt dann vor einem schäbig aussehenden Haus.
Besonders einladend war der Eingang nicht und als sie mit einem alten klobigen Schlüssel die Tür aufsperrte, wurde es nicht besser. Mir schlug ein Schwall muffig riechender Luft entgegen. Der erste Blick zeigte eine kleine Treppe aus Holz und Wände in einer sehr dunklen Farbe. Sie betätigte einen Schalter an der Wand und eine nackte Glühbirne flammte kurz auf, um dann sofort wieder zu erlöschen. Soviel zum Thema Licht. Vorsichtig stiegen wir im Dunkeln die Treppe nach oben und behielten eine Hand an der Wand. An der obersten Stufe angekommen führte eine Tür nach links wieder ins Freie. Dann standen wir auch schon vor der nächsten Tür in einem verschmierten braun gehalten und mit schiefen verbogenen Kupferzahlen darauf. Es sollte wohl mal eine 14 sein. Auch diese Tür öffnete sie und gab ihr einen Stoß, um den Raum dahinter zu zeigen.