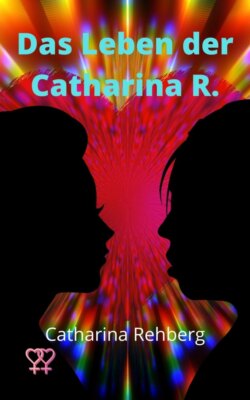Читать книгу Das Leben der Catharina R. - Catharina Rehberg - Страница 5
Kapitel 2
ОглавлениеAm 12. März erlebte ich meinen bis dahin schlimmsten Tag meines noch jungen Lebens. Vor Unterrichtsbeginn holte mich meine Klassenlehrerin von meinem Stuhl und brachte mich ins Lehrerzimmer. Der Gestank nach Kaffee und kaltem Rauch war abartig. In dem Raum hätte auch ein Affenkäfig aus dem Zoo nichts an der Luft ändern können. Vor mir saßen insgesamt vier Lehrer und der Direktor meiner Schule. Wie eine Strafgefangene wurde ich verhört, wie ich es hatte wagen können eine Mitschülerin zu küssen. Man beschimpfte mich als krank und abnormal. Diese fünf Erwachsenen vor mir redeten fast eine Stunde wie auf eine Schwerverbrecherin auf mich ein. Durch meine Krankheit zeigte sich natürlich keine Reaktion auf meinem Gesicht, was ihnen als Grund ausreichte, einfach weiter verbal auf mich einzuschlagen.
Jede andere wäre wie ein weinendes Häufchen in der Ecke gelegen und hätte darum gebetet endlich in Ruhe gelassen zu werden. Da sich auf meinem Gesicht absolut nicht die geringste Regung zeigte, von Reue oder einem schlechten Gewissen ganz zu schweigen, entschied man sich dazu, meine Mutter anzurufen und einen Termin für die kleine Catharina beim Schulpsychologen auszumachen. Meine Mutti fiel natürlich aus allen Wolken als man sie bereits morgens im Kaufhaus ans Telefon bestellte und ihr nahe legte ihre Tochter zum Psychologen zu schicken.
An Unterricht im klassischen Sinne war an diesem denkwürdigen Tag nicht mehr zu denken. Wer aber glaubt, dass Erwachsene die Schlimmsten sind und verbal auf junge Frauen einschlugen, hat noch nie die Gleichaltrigen kennengelernt. Sogar während des laufenden Unterrichts attackierten mich meine Mitschüler. Ganz vorne mit dabei meine beste Freundin Emma. Man glaubt gar nicht, wie schnell sich so etwas in der ganzen Schule verbreiten kann. Es dauerte gefühlt nur einige Sekunden, bis auch der letzte Schüler auf dem Schulhof über den kompletten Ablauf informiert war. Selbst die normalen Mobbingopfer, die es an jeder Schule gab, hatten an diesem Tag eine Auszeit und wurden in die Gemeinschaft aufgenommen. Ich war nur noch die kranke, völlig verrückte kleine Schlampe, die mit Vorliebe Mädchen küsst. Zu meinem besonderen Glück stellte sich auch noch die einzige Lehrkraft auf dem Schulhof, die als sogenannte Pausenaufsicht, Streitereien und Anfeindungen von Schülern untereinander unterbinden sollte, auf die Seite meiner größten Gegner.
Sogar die letzten Affen kamen aus ihren Löchern gekrochen und beleidigten mich auf das Übelste. Damals dachte ich noch, es würde vielleicht ein oder zwei Tage dauern, bis sie sich wieder beruhigen würden und mich in Ruhe ließen, aber auch nach einigen Wochen änderte sich nichts daran. Ich war bis zu meinem Abschluss das bevorzugte Opfer aller Attacken. Das bezog sich aber nicht nur auf die Schule, denn im Privaten ging es direkt weiter. Dass man mich nur noch als die Kranke bezeichnete, setzte sich die restliche Schulzeit fort. Ich durfte jede Woche an zwei Tagen nach der Schule zu einem Psychologen wandern, der mich heilen wollte. Abnormal war noch die harmloseste Bezeichnung, die ich zu hören bekam.
Meine Mutter zu Hause stand meinen Peinigern in nichts nach. Essen durfte ich alleine. Meine bis dahin liebevolle Mutter weigerte sich beharrlich, ihren Tisch mit einer Irren zu teilen. Es dauerte auch nicht mehr besonders lange, bis ich mir mein Essen selbst machen musste. Das fand seine Fortsetzung darin, dass ich meine Wäsche und alles andere alleine machen durfte. Ich war für meine Erzeugerin nur noch ein Klotz am Bein und sie ließ mich das auch jeden Tag spüren. Mein Taschengeld bekam ich einmal im Monat in einem Briefumschlag, den sie mir wie eine schlechte Angewohnheit auf dem Küchentisch liegen ließ.
Auch meine sonstige Einnahmequelle, die Babysitterabende bei Karsten im Nachbarhaus fielen weg. Seine Mutter wollte ihren Sohn nicht einer kranken Lesbe überlassen. Der Kleine selbst hatte aber an mir schon einen Narren gefressen. Er beschwerte sich lautstark über jede andere, die man ihm vor die Nase setzte. Ihm war es als Einzigem egal, ob man mich als krank bezeichnete. Der kleine Karsten, dieser Goldschatz, zeigte allen anderen, dass ich nur eine einfache junge Frau war, die nichts Böses getan hatte. Er war zu der Zeit noch im Kindergarten einige Straßen weiter und kannte meine Zeiten wann ich, wo anzutreffen war. Immer wieder drehte er es so, dass er genau dann auf dem Spielplatz seiner Mutter entwischte, wenn ich auf dem Weg nach Hause war. Dann rannte er, so schnell er konnte auf mich zu und drückte mich an sich. Das waren die einzigen schönen Momente, die ich noch hatte.
Dieses ganze Elend ertrug ich klaglos über ein Jahr. Meinen 15. Geburtstag feierte ich völlig alleine in meinem Zimmer auf dem Bett. Von meinem Taschengeld hatte ich mir ein Stück Kuchen geleistet, eine Kerze angezündet und den ganzen Nachmittag ein bisschen Musik laufen. Meine Erzeugerin, die betrunken auf dem Sofa vor der viel zu lauten Flimmerkiste lag, hielt es nicht für nötig einen Ton zu mir zu sagen. Ihre einzige Tochter hatte Geburtstag und ihr war es vollkommen egal. Sie ließ auch keine Gelegenheit aus, mir immer wieder Beleidigungen an den Kopf zu werfen. Selbst an meinem Ehrentag bezeichnete sie mich noch als menschlichen Abfall, den sie besser abgetrieben hätte.
Als ich dann alleine in meinem Zimmer saß und meinen Kuchen anstarrte, der mir nicht schmecken wollte, traf ich einen Entschluss. Ich war jetzt 15 Jahre alt, machte meine Hausarbeit alleine und musste mich, so gut es ging selbst versorgen. Was sollte mich also noch hier halten? Eben, es gab nichts mehr, was mich noch an diesem Ort festhielt. Meine Erzeugerin lag sowieso nur noch im Alkoholrausch auf dem Sofa herum und überließ mich mir selbst. Wieso sollte ich mir das eigentlich noch länger antun. Sie gab mir ja sowieso nur noch zu verstehen, dass ich unerwünscht war. Ich öffnete meinen Schrank und begann eine kleine Inventur. Die Kleidung, die ich hatte, packte ich in eine Tasche und meine persönlichen Wertgegenstände und kleine Erinnerungen, die ich behalten wollte, landeten in einer Tüte. Beides legte ich neben meine Schultasche und legte mich dann schlafen.
Am nächsten Morgen ging ich wie jeden Tag zur Schule, ließ mich wieder beleidigen und anfeinden, bis meine Stunden abgelaufen waren. Dann schrieb ich einen Zettel für den kleinen Karsten und machte mich auf den Weg. Ich wusste, dass er an diesem Tag auf mich am Spielplatz wartete. Wie immer rannte er fröhlich auf mich zu und schloss mich in die Arme. Ich sah dem Jungen tief in die Augen und steckte ihm meine Nachricht zu. Er verstand erst nicht, was das sollte, aber ich erklärte ihm, dass auf diesem Zettel meine neue Adresse stand. Karsten machte große Augen und hatte Angst mich nicht wieder sehen zu können. Er war aber der Einzige, den ich nicht alleine lassen würde. Karsten versprach mir, niemandem zu erzählen, wo ich war, und ich versprach ihm immer wieder an der Schule auf ihn zu warten. Dort hatten wir viel mehr Zeit und er brauchte nicht seiner Mutter zu entwischen.
Als ich wieder in die Wohnung kam, stank es wie immer nach Bier und billigem Fusel, den meine Erzeugerin in rauen Mengen in sich hineinschüttete. Die Begrüßung ließ nicht lange auf sich warten. Der menschliche Abfall, also ich, sollte verschwinden. Sie wusste gar nicht, wie schnell sich dieser Wunsch erfüllen sollte. Ich ging nur kurz in mein Zimmer, nahm meine Tasche und die Tüte und blickte noch ein letztes Mal an die Wand meines Kinderzimmers. Dann verließ ich die Wohnung und machte mich auf zu meiner neuen Adresse. Das war ein altes Abbruchhaus, das schon seit ich noch Windeln trug, etwas abgelegen stand. Irgendwann hatten wir das mal erkundet und es sollte meine neue Bleibe werden.
Betreten konnte man es nur über ein Loch in der Außenmauer. Die Fenster waren mit Farbe beschmiert und im unteren Stockwerk roch es muffig und deutlich nach Urin. Im oberen Stockwerk gab es einige Zimmer, in denen Obdachlose hausten. Die Räume, die leer standen, hatte ich mir schon einmal angesehen. Meine Wahl fiel auf ein kleines Zimmer an der westlichen Ecke mit einem Ausblick auf den verwilderten Garten hinter dem Haus. Dort begann ich mich häuslich einzurichten. Ein Obdachloser sah mir dabei interessiert zu und fragte mich, was ich denn hier wollte. Ich erklärte ihm, dass ich ab sofort in diesem Zimmer wohnen würde. Lothar, so nannte er sich, wollte mir erst nicht recht glauben, aber als er sah, dass ich mir eine Decke als Nachtlager ausbreitete und meine Schulsachen in die Ecke stellte, war er überzeugt.
Wir unterhielten uns noch einige Stunden. Er war sehr nett zu mir und sparte nicht mit guten Ratschlägen. Angst wäre hier nicht besonders hilfreich. Ich erklärte ihm ausführlich, dass ich unempfindlich für Angst war. Meine Krankheit Alexithymie verhinderte ein Angstempfinden. Aber es gab auch Erfreuliches zu hören. Ein anderer Obdachloser, der Harry hieß, und noch bis vor einigen Monaten hier gelebt hatte, war ein ehemaliger Elektriker und sorgte in einer Nacht und Nebelaktion dafür, dieses Haus wieder mit Energie zu versorgen. Heißt in meiner neuen Wohnung gab es sogar ein bisschen Strom für Licht und einen gemeinschaftlichen Herd, den sie vom Sperrmüll besorgten. Nur Wasser war ein kleineres Problem. Das musste über Kanister von einem Brunnen in der Stadt besorgt werden. Je länger ich mit Lothar redete, umso wohler fühlte ich mich in meiner neuen Bleibe.
Die erste Nacht war noch etwas unbequem und kühl. Schlaf bekam ich nicht gerade viel. Draußen war es bereits kurz vor Mittag, als ich mich aus meiner Decke schälte und in den Garten sah. Es war Anfang März und die Sonne war noch nicht stark genug für ein bisschen Wärme zu sorgen. Lothar war bereits wieder wach und rauchte einen scheußlich riechenden Zigarillo. Ich bat ihn, auf meine Sachen aufzupassen, während ich weg war. Er beruhigte mich mit der Aussage, dass hier nichts wegkommen würde, trotzdem nahm ich die Tüte mit meinen Wertsachen vorsichtshalber mit. Ich hatte eine dringende Verabredung mit dem kleinen Karsten und wollte ihn nicht enttäuschen. Gerade noch rechtzeitig erreichte ich die Grundschule, bevor der Unterricht zu Ende war. Als er mich vor dem Schulhof warten sah, blitzten seine blauen Augen. Seine Tasche mit den Schulsachen ließ er einfach fallen und rannte zu mir.
Auf der Steintreppe redeten wir länger miteinander. Er wollte wissen, was ich vorhatte und warum ich jetzt woanders wohnen würde. Ich versuchte, es ihm so gut wie möglich zu erklären. Für ihn war ich immer noch die große Catharina und er konnte nicht verstehen, warum mich alle für krank hielten. Das Problem war, dass ich es ihm selbst nicht richtig erklären konnte. Ich erzählte ihm, dass ich meine Freundin Emma geküsst hatte, und darauf die Hölle über mich hereinbrach. Für Karsten war das ganz normal. Mit seinem kindlichen Gemüt erklärte er mir, das es doch ganz normal sei, jemanden zu küssen, wenn man ihn mag. Welches Geschlecht spielte doch dabei überhaupt keine Rolle. Er küsste mich ja auch, weil er mich mochte. Er konnte noch nicht begreifen, was jetzt so schlimm an einem Kuss war. Ich begleitete ihn noch fast bis nach Hause. Dann machte ich mich wieder auf den Weg zu meiner neuen Behausung.
Dort wartete bereits Lothar mit einigen Freunden auf mich. Sie alle wollten die neue junge Bewohnerin kennenlernen. Sie waren alle überaus nett zu mir. Wilfried, ein anderer Bewohner des Hauses, versuchte zu erfahren, was mich in diese Gegend verschlagen hatte. Ich versuchte, ihm nur ein bisschen meiner Situation zu erklären, aber das genügte ihm nicht. Ihm war nur aufgefallen, dass ich ganz anders war als die anderen jungen Frauen, die sich sonst mal hierher verirrten. Es hatte keinen Zweck ihnen etwas vorzumachen. Sie waren schon viel zu alt und erfahren genug um mich aus der Reserve zu locken. Also begann ich zu berichten, was es mit meiner Flucht auf sich hatte und wie sich alles so weit entwickelte, bis ich schließlich hier in der Runde der alten Männer landete. Lothar begann laut zu lachen und die paar Zahnstummel in seinem Mund wackelten schon bedenklich. Jeder Einzelne von ihnen konnte mich nur zu gut verstehen. Nils, ein etwas jüngerer Bewohner, verdrückte ein paar Tränen. Er begann mich darüber aufzuklären, dass er, ebenso wie ich die fast gleiche Tortur überstehen musste. Sein Problem war aber seine Sprache. Man verhöhnte ihn Zeit seines Lebens als Stotterer. Es war ihm nicht möglich, langsamer zu sprechen, was dann den Sprachfehler bei ihm auslöste. Draußen wurde es bereits wieder langsam hell. Anstatt zu schlafen, hatten wir uns in der Runde angeregt unterhalten.
Aber die alten Männer versuchten auch nicht, mir meinen Weg auszureden. Sie unterstützen mich eher, meldeten aber einige Bedenken an. Ich war noch jung und unerfahren. Abstreiten konnte ich das schlecht als jugendliche mit 15 Jahren. Sie schlugen mir einen anderen Weg vor. Ich sollte erst einmal hierbleiben, aber trotzdem irgendwie meine Schule zu Ende bringen. Das Leben auf der Straße war, besonders in den Wintermonaten nicht gerade angenehm und viele sind schon daran gestorben. Darüber hatte ich mir in meinem blöden Kopf natürlich keine Gedanken gemacht. Der Frühling hatte gerade erst begonnen und dann käme der Sommer, aber spätestens im Oktober würde es wieder empfindlich kalt werden. Zumindest nachts war es im Spätjahr nicht gerade angenehm. Aber ich hatte ja meine Schulsachen bei mir, damit könnte ich ja lernen, ohne in die Schule zu müssen. Ich wollte es möglichst vermeiden, wieder den ganzen Tag beleidigt zu werden, nur weil mich mein eigenes Geschlecht anzog und mich von einigen Psychologen davon heilen zu lassen.
Wilfried zeigte mir dann einen anderen Weg auf. Ich sollte einfach nach den Sommerferien eine andere Schule besuchen. Meine neuen Freunde würden mir dabei helfen. Nils, der ungefähr so alt wie meine Erzeugerin war, würde sich als mein Vater ausgeben und das Aufnahmegespräch an der anderen Schule bestreiten. Alles, was wir dafür besorgen mussten, waren ein paar anständige Klamotten und ein bisschen Geld. Duschmittel könnte auch nicht schaden und einen vernünftigen Haarschnitt warf ich noch in die Runde. Meine neuen Freunde mussten lachen. Es war nicht einfach, seine Kleidung in Ordnung zu halten und regelmäßig zu duschen, solange es draußen noch kalt war. Hätte mir auch selbst einfallen können. Lothar bot sich an, Nils die Haare zu schneiden. Er konnte damit umgehen und brauchte nur einen vernünftigen Kamm und eben eine gute Schere. Die hatte ich aber zum Glück schon bei meinen Schulsachen.
Ich würde dann bis Ende der Woche nicht mehr in die Schule gehen, einen Entschuldigungszettel schreiben, weil ich erkrankt war und dann dieses Schuljahr noch überstehen müssen. Nur auf die Milch und das Brötchen auf dem Pausenhof musste ich verzichten. Taschengeld bekam ich ja nicht mehr, aber Lothar und die anderen würden mich schon noch irgendwie ernähren können. Sie bekamen über das Sozialamt einen gewissen Tagessatz an Geld. Kochen war ja in unserer Wohnung eingeschränkt möglich und Wilfried konnte auch damit ein bisschen umgehen. Nur musste ich das alles noch Karsten beibringen. Eigentlich wollte ich ihn ja nach der Schule täglich besuchen und mich mit ihm unterhalten. Immerhin war er der Einzige, der zu mir hielt und mich nicht verurteilte. Das war ich ihm einfach schuldig.
Karsten war mir nicht böse, wenn ich nicht jeden Tag vor der Schule auf ihn wartete. Seine einzige Frage war, auf welche Schule ich dann gehen würde. Das hatte ich aber noch nicht entschieden und musste ihn vertrösten. Obwohl er gerade mal in der ersten Klasse der Grundschule war, verstand er mich besser als jeder andere. Der Kleine war einfach großartig. Für diese eine Woche, die ich mir freigenommen hatte, durfte er sich aber täglich auf meine Besuche freuen. Karsten freute sich jeden Tag aufs Neue, wenn er mich da vor seiner Schule stehen sah. Er war zwar nur der Sohn meiner ehemaligen Nachbarin, aber in meinen Augen war er so was wie ein kleiner Bruder, der für alles, was ich machte, Verständnis aufbrachte.
Die nächste Woche begann für mich wieder der blanke Horror. Ich ließ Nils eine Entschuldigung für mein Fehlen schreiben und fälschte die Unterschrift meiner Erzeugerin. Meine Lehrerin akzeptierte den Zettel nach einem kurzen Blick und kümmerte sich dann um den Unterricht. In der Zwischenzeit hatte ich mich in dem Abbruchhaus schon eingelebt. Nur das Waschen, morgens bevor ich losmusste, war schrecklich. Ich hatte zwar das Badezimmer für mich alleine, aber das Wasser war eiskalt. Der Frühling hatte entschieden, noch ein bisschen länger auf sich warten zu lassen. Nachts lagen die Temperaturen nur leicht über dem Gefrierpunkt und das Wasser, das in dem Kanister im Badezimmer stand, könnte auch im Kühlschrank stehen. Ich verzichtete aus gutem Grund darauf, die Haare täglich zu waschen. Auf dem Schulweg hatte ich jedes Mal danach das Gefühl, als würden sie mir abfrieren. Allerdings waren meine Männer furchtbar lieb zu mir. Sie versuchten wirklich alles mir die Tage so angenehm wie möglich zu machen.
Wenn ich nach dem täglichen Horrortrip wieder nach Hause kam, stand Wilfried schon am Herd und hatte etwas zu essen für mich fertig. Nils und die anderen sparten von ihrem täglichen Geld vom Sozialamt immer wieder kleinere Beträge, damit ich mir auf dem Schulhof eine Milch kaufen und einmal in der Woche in einem Waschsalon meine Kleider waschen konnte. In der freien Woche war ich noch einmal in meinem früheren Umfeld, als meine Erzeugerin bei der Arbeit war. Ich nahm meinen Radiowecker mit, plünderte den Kühlschrank und suchte mir ein bisschen Geld zusammen, was sie in ihrem Schrank versteckt hatte. Außerdem genoss ich eine warme Dusche. Wenn ich schon mal da war, konnte man das auch ausnutzen. Dann fiel mir ein, dass ich nur ein Handtuch eingepackt hatte, als ich so überstürzt verschwunden war. Also steckte ich noch ein paar weitere ein und ließ den Föhn auch noch in meiner Tasche verschwinden.
Für ein paar Wochen ging es uns richtig gut. Lothar hatte sogar genug Geld zusammengespart, damit wir uns einen Wasserkocher kaufen konnten. Ab da konnte ich mich vor der Schule mit warmem Wasser waschen und brauchte die Haare nicht auszusparen. Allerdings brauchten wir ein bisschen mehr Geld. Ich konnte nicht die Männer in die Pflicht nehmen. Sie taten schon mehr als genug für mich. Ich musste ihnen ja auch mal was spendieren. Immerhin lebte ich ja nur auf ihre Kosten. Ich besorgte mir einen kleinen Job und verteilte donnerstags eine lokale Zeitung. Das brachte auch deutlich mehr Geld ein als mein früheres Taschengeld und den Nebenverdienst als Babysitterin für Karsten.
In den Sommerferien bereiteten wir uns auf den Besuch in der neuen Schule vor. Nils hatte neue Klamotten, einen vernünftigen Haarschnitt und war frisch rasiert. Seit wir genug warmes Wasser hatten, wuschen sich auch die Männer. Nur Wilfried verzichtete darauf, das Badezimmer zu benutzen. Er hatte eine andere Möglichkeit für sich gefunden. Hinter unserem Haus war versteckt zwischen einigen Bäumen ein Teich. Immerhin war es ja Hochsommer und er benutzte den kleinen Tümpel einfach als seine Badewanne. Das Aufnahmegespräch mit dem Schulleiter der neuen Schule lief problemlos und nach den Sommerferien war ich dann meine alte Schule los.