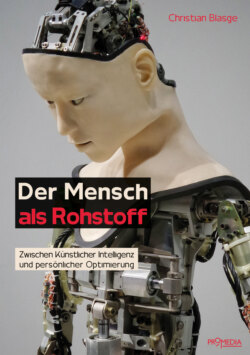Читать книгу Der Mensch als Rohstoff - Christian Blasge - Страница 8
1. Die Antiquiertheit des Menschen Günther Anders’ Ansichten über die Technik
Оглавление»Wenn es im Bewußtsein des heutigen Menschen etwas gibt, was als absolut oder als unendlich gilt, so nicht mehr Gottes Macht, auch nicht die Macht der Natur, von den angeblichen Mächten der Moral oder der Kultur ganz zu schweigen. Sondern unsere Macht. […] Die prometheisch seit langem ersehnte Omnipotenz ist, wenn auch anders als erhofft, wirklich unsere geworden. Da wir die Macht besitzen, einander das Ende zu bereiten, sind wir die Herren der Apokalypse. Das Unendliche sind wir.«4
»Unter den Mächten, die uns heute formen und entformen, gibt es keine mehr, deren Prägekraft mit der der Unterhaltung in Wettbewerb treten könnte. Wie wir heute lachen, gehen, lieben, sprechen, denken oder nichtdenken, selbst wie wir heute zu Opfern bereit sind, das haben wir nur zum allunbeträchtlichsten Teil im Elternhaus, in den Schulen oder in den Kirchen gelernt, vielmehr fast ausschließlich durch Rundfunk, Illustrierte, Filme oder durch das Fernsehen – kurz: durch ›Unterhaltung‹.«5
In den 1950er-Jahren warf Günther Anders die provokante Frage auf, ob der Mensch nicht mittlerweile hoffnungslos antiquiert, also überholt sei, da ihm die Technik den Rang abgelaufen habe. Diese Frage wird eingebettet in eine fundamentale Skepsis gegenüber dem »Gerät an sich«, womit Radio und Fernsehen, die sogenannte Maschinenmusik sowie Abbilder aller Art gemeint sind. Ich nehme Anders’ Diagnose zur kritischen Ausgangsbasis für die Betrachtung der Technik im 21. Jahrhundert.
Günther Anders wurde 1902 in Breslau geboren und wuchs in einer jüdischen Familie auf. Sein Vater war der bekannte Psychologe William Stern. Anders wurde 1923 bei Edmund Husserl promoviert und lernte 1925 in einem Seminar seine erste Ehefrau, die Philosophin Hannah Arendt, kennen. In den Jahren 1930−1932 arbeitete Anders an dem antifaschistischen Roman Die molussische Katakombe, der aufgrund der nationalsozialistischen Machtergreifung nicht erscheinen konnte und erst 60 Jahre nach seinem Entstehen, im Jahr 1992, publiziert wurde. 1933 emigrierten er und Arendt nach Paris. 1937 ließ sich das Paar scheiden, worauf Anders weiter in die USA floh. Im Exil blieb Anders ein Außenseiter und fand nie Anschluss an die dortige »scientific community«. Infolge finanzieller Engpässe musste er seinen Lebensunterhalt durch unterschiedliche Tätigkeiten – beispielsweise als Putzmann in den Requisitenkammern von Hollywood – bestreiten. Diese Erfahrungen schärften allerdings seinen Blick für die Charakteristika der modernen Zivilisation. Die erst langsam durchsickernde Wahrheit über die Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten sowie der Abwurf der Atombombe über Hiroshima gaben dem Leben und Denken von Günther Anders eine entscheidende Wende. 1950 kehrte er nach Europa zurück und ließ sich in Wien, der Heimatstadt seiner zweiten Frau (der Schriftstellerin Elisabeth Freundlich) nieder. Der Bau weiterer Atombomben und die Möglichkeit der Auslöschung der Menschheit durch einen globalen Krieg wurden für Anders zum bestimmenden Thema der nächsten Jahrzehnte. Anders starb in hohem Alter und bis zuletzt arbeitend 1992 in Wien.6 In einem seiner Werke bezeichnete er seine Tätigkeit als »Gelegenheitsphilosophie« – eine Philosophie, die die charakteristischen Aspekte ihrer Zeit zum Ausgang des Denkens nimmt.
Der Medien- und Technikphilosoph hat sich in den beiden Bänden seines Hauptwerkes Die Antiquiertheit des Menschen (Band 1 1956, Band 2 1980) intensiv mit der Seele des Menschen im Zeitalter der zweiten industriellen Revolution (Band 1) sowie mit der Zerstörung des Lebens in der dritten industriellen Revolution (Band 2) beschäftigt. Seine Ansichten über die Technisierung der Welt und deren Bedeutung für den Menschen sind bis heute einflussreich. Die Methode der Vermittlung seiner Gedanken beschreibt er selbst als »Übertreibung«. Es gebe Erscheinungen in unserer Welt, bei denen sich die Überpointierung und die Vergrößerung nicht vermeiden lassen, da sie ohne diese Entstellung kaum identifizierbar wären oder gar unsichtbar bleiben würden, so Anders. »Übertreibung oder Erkenntnisverzicht« – vor diese Alternative stellt er seine Leserinnen.
In seinem Werk verfolgt Günther Anders drei zentrale Thesen: (1) Wir sind der Perfektion unserer Produkte nicht gewachsen; (2) wir stellen mehr her, als wir vorstellen und verantworten können; und (3) wir glauben, alles, was wir können, auch zu dürfen, zu sollen, ja sogar zu müssen. Diese Thesen sollen Gegenstand der nächsten Seiten sein und als philosophisches Grundgerüst für weitere Überlegungen dienen.
Einer der bekanntesten Begriffe, mit denen man Anders in Verbindung bringt, ist die »prometheische Scham« des Menschen gegenüber den Dingen, die er selbst hergestellt hat. In der griechischen Mythologie galt Prometheus als ein Freund und Lehrmeister der Menschen. Einer Variante des Mythos zufolge fertigte er die Menschen aus Ton an und verlieh ihnen von verschiedenen Tieren je eine Eigenschaft – z. B. die Klugheit des Hundes. Überdies gab er den Menschen das Feuer zurück, das ihnen wegen Betrugs während einer Opfergabe für die Götter von Zeus genommen worden war. Während Prometheus stolz auf seine Kreationen sein konnte, da er ihnen stets überlegen blieb, drückt die prometheische Scham das Gefühl der menschlichen Unterlegenheit gegenüber seinen perfekt gestalteten Produkten aus, denen der Mensch als mängelbehaftetes Wesen nicht mehr beikommen kann. Anders bezeichnet diesen Zustand auch als das »prometheische Gefälle«. Im Angesicht seiner durchkalkulierten Produkte schämt sich der Mensch, geworden, statt gemacht worden zu sein. Er zieht in seiner Scham das Gemachte dem Macher vor – der verspürte Stolz wechselt vom creator zum creatum. In einer komplexer werdenden Welt von Maschinen wird der Mensch darüber hinaus zunehmend von seinen Schöpfungen assimiliert. Er fungiert nicht nur als Gerät neben Geräten, sondern als Gerät für Geräte. Die Folge ist für Anders das Vertauschen der Subjekte von Freiheit und Unfreiheit: Frei sind die Dinge, unfrei ist nun der Mensch.
Die erste Inferiorität des Menschen gegenüber den Maschinen ist das Scheitern im Vergleich zu ihnen, das sich in Minderwertigkeitsgefühlen äußert. Die zweite Inferiorität folgt aus der Tatsache, dass der Mensch sterblich und von der »industriellen Reinkarnation« ausgeschlossen sei. Anders bezeichnet dieses Phänomen als die »Malaise der Einzigartigkeit« des Menschen. Im strikten Sinn sind unsere Produkte nicht unsterblich. Die Haltbarkeit von Lebensmitteln ist begrenzt, auch Glühbirnen und Autos haben eine überschaubare Lebensdauer. Nicht selten sind es jedoch wir selbst, die unseren Produkten ein Verfallsdatum zuweisen, um die Absatzmärkte lebendig zu halten. Unsere eigene Sterblichkeit dagegen ist nicht unser Werk – sie kann nicht kalkuliert werden. In einem weiteren Sinn sind unsere Produkte dagegen tatsächlich »unsterblich« bzw. »industriell inkarnierbar« – nämlich dort, wo sie in die Serienproduktion gehen:
Als einzelnes hat zwar jedes Stück (diese Schraube, diese Waschmaschine, diese Langspielplatte, diese Glühbirne) seine Leistungs-, Verwendungs- und Lebensfrist. Aber als Serienware? Führt nicht die neue Glühbirne, die die alte ausgebrannte ersetzt, deren Leben fort? Wird sie nicht die alte Birne?7
Ein weiteres Beispiel stellt Hitlers Bücherverbrennung 1933 dar, als tausende Seiten von derjenigen Literatur, die dem Regime nicht genehm war, auf dem modernen Scheiterhaufen einer neuen Inquisition vernichtet wurden. Anders als im verheerenden Bibliotheksbrand im antiken Alexandria, durch den große Teile des damaligen Wissens verloren gingen, wurde bei der Bücherverbrennung des 20. Jahrhunderts keine einzige Seite endgültig verbrannt. Denn von jeder Seite gab es hunderte oder sogar tausend »Geschwister« in versteckten Sammlungen oder im Ausland, die ein, zwei Jahrzehnte später wieder reproduziert wurden.
Wie konnte man damals und wie kann man heute gegen die »Malaise der Einzigartigkeit« aufbegehren? Anders erkennt die Revolte gegen das Gefühl der Benachteiligung in einer Sucht, die in ihrem Ausmaß und in ihrer Intensität eine erstmalige Erscheinung darstellt und im frühen 21. Jahrhundert ihren Höhepunkt feiern wird. Diese Sucht ist ein Schlüsselphänomen, das in vielen Theorien unseres Zeitalters vorkommt. Die Rede ist von der Bildersucht oder, mit einem Terminus von Anders, der »Ikonomanie«. Die Rolle des Bildes war bereits im 20. Jahrhundert groß – heute ist sie so ungeheuerlich, dass wir in dem Versuch, uns die Welt ohne die unzähligen Bilder, Handyschnappschüsse, Kopien, Plakate, Filme (ganz abgesehen von den sozialen Netzwerken und dem Internet) usw. vorzustellen, mit leeren Händen dastehen. Als einen Grund für die Genese der Ikonomanie nennt Anders die Möglichkeit, durch Bilder die Chance zu erhalten, »Ersatzteile« von sich selbst zu schaffen und somit seine unerträgliche Einmaligkeit Lügen zu strafen.
Sie [diese Chance] ist eine im größten Stile von ihm [dem Menschen] durchgeführte Gegenmaßnahme gegen sein »mich gibt’s nur einmal«. Während er sonst von der Serienproduktion ausgeschlossen bleibt, verwandelt er sich eben, wenn photographiert, doch in ein »reproduziertes Produkt«. Mindestens in effigie gewinnt auch er dadurch multiples, zuweilen sogar tausendfaches, Dasein.8
Diejenigen unter uns, denen das multiple Dasein am eindrucksvollsten gelingt, sind nach Anders die von vielen beneideten Filmstars. Da sie unseren Traum, zu sein wie die Dinge und als Emporkömmlinge der Produktwelt zu gelten, am triumphalsten verwirklicht haben, werden sie sprichwörtlich vergöttert. Der Filmstar geht mit der Massenware eine unheilvolle Allianz ein.9 Wer Gelegenheit hat, Touristen aus den Industrieländern in Urlaubsorten zu beobachten, wird bemerken, in welchem Grad Einmaligkeit sie irritiert. Der Eiffelturm, die Chinesische Mauer oder die Pyramiden von Gizeh sind allesamt Unikate in einer Welt voller Serienprodukte. Seit der Entwicklung des Fotoapparats verfügen wir über ein probates Mittel, um eine sofortige Wiederherstellung unserer Seelenruhe zu ermöglichen: Mit seiner Hilfe können wir das Einmalige, sollte es uns durch seine Schönheit oder Unklassifizierbarkeit allzu stark verwirren, mit einem Klick zu einem weiteren Objekt transformieren. In diesem Vorgang wird der bestimmte Artikel (der Turm von Pisa) in einen unbestimmten verwandelt (eines von unzähligen Bildern des Turms von Pisa) – in die Artikelform, die im Universum der Reproduktion ihren rechtmäßigen Platz einnehmen kann. Das Fotografieren kann nach Anders als Akt des »Aufnehmens« gedeutet werden – mit dem Bild hat man es nun geschafft, dieses oder jenes Objekt zu »haben«.
Haben, so scheint es uns, ist etwas ganz Normales im Leben; um leben zu können, müssen wir Dinge haben, ja, wir müssen Dinge haben, um uns an ihnen zu erfreuen. In einer Gesellschaft, in der das oberste Ziel ist, zu haben und immer mehr zu haben, in der man davon spricht, ein Mann sei »eine Million wert«: wie kann es da eine Alternative zwischen Haben und Sein geben? Es scheint im Gegenteil so, als bestehe das eigentliche Wesen des Seins im Haben, so daß nichts ist, wer nichts hat.10
Menschen, die sich vorwiegend in der seriellen Welt aufhalten, umgeben sich mit Reproduktionen bzw. Kopien von ursprünglichen Modellen. Nachbilder sind für sie eben das Wirkliche geworden.
So wenig sie dasjenige photographieren, was sie sehen – denn was sie sehen, das sehen sie nur, um es zu photographieren; und was sie photographieren, das photographieren sie nur, um es zu haben – so wenig ist ihnen das, was sie photographieren, das »Wirkliche«. »Wirklich« ist für sie vielmehr die Aufnahme, das heißt: die in das Serien-Universum aufgenommenen und zu ihrem Eigentum gewordenen Exemplare der Reproduktions-Serie.11
Wirklich scheint für sie nicht, tatsächlich dort zu sein, den Moment zu genießen, ein Verständnis für die Kultur zu entwickeln, die andersartige Architektur zu bestaunen oder die fremde Sprache zu hören, sondern allein, dort gewesen zu sein. Nicht nur, weil der Besuch des Fremden das heimische Prestige hebt, sondern weil nur Gewesenes, und nicht das flüchtige Gegenwärtige, einen sicheren Besitz darstellt. Während Erich Fromm konstatiert, dass nach dieser Auffassung offenbar »nichts ist, wer nichts hat«, macht nach Anders’ Diagnose »nur Gewesen-sein das Sein« aus. Sein bedeute demnach »Gewesensein und Reproduziertsein und Bildsein und Eigentum sein«12.
Den damals in den USA populären Jazz bezeichnet Anders als industriellen Dionysos-Kult. Der griechische Gott Dionysos galt in der Antike als Gott der Freude, des Wahnsinns und der Ekstase. Friedrich Nietzsche hat aus diesen Charakteristika ein eigenes Prinzip entwickelt: das »Dionysische«. Während das »Apollinische« (im Rekurs auf den Gott Apoll) sich in beherrschten, klaren und bildhaften Formen darstelle, gleiche das Dionysische einer Welt des Rausches. Es verweise auf einen orgiastischen, ekstatischen Zustand der Selbstvergessenheit, der sich für Nietzsche vor allem in der Musik ausdrückte.13 Übertragen auf den Jazz, stellt dieser Zustand für Anders ein Symptom des damaligen Zeitgeistes dar. Der Jazz trage die Kennzeichen einer dinglichen und automatisierten Gangart in sich – er sei ein alles zerstampfender Wiederholungsfuror, der Furor einer immer gleich laufenden Maschine. Kurz: »Maschinenmusik«. Die Maschinen geben den Bewegungsrhythmus vor, während sich der menschliche Leib ihm bei jedem Takt aufs Neue unterwerfen muss. Es komme zu einer Widerlegung des Leibes und seines Anspruches, über eigene Rhythmen zu verfügen:
Da nun aber der Leib, um seinen Konformismus mit der Maschine zu beweisen, diese Widerlegung mitvollzieht, ist, was der Tänzer tanzt, nicht nur die Apotheose [Vergottung, Verherrlichung] der Maschine, sondern zugleich eine Abdankungs- und Gleichschaltungsfeier, eine enthusiastische Pantomime der eigenen totalen Niederlage.14
Die Ekstase der Tänzer ist echt. Statt sie selbst sind sie »außer sich«, um mit dem Gott der Maschine eins zu werden: »Industrieller Dionysos-Kult«. Was würde der Gelegenheitsphilosoph wohl über die heutige Popindustrie sagen oder über den Disc-Jockey, der die Maschinenmusik so deutlich verkörpert wie kein anderer vor ihm?
Anders’ Analysen und Deutungen sind zeitgebunden und streitbar, aber doch in der Sache aufschlussreich, wie beispielsweise seine Überlegungen zum Arbeitsprozess am Fließband. An maschinisierten Tätigkeitsformen erkennt man, dass sich der Mensch in eine kraftraubende Gleichschaltung mit der Maschine begeben muss. Er wird sich an ihrem Tempo und Rhythmus orientieren – und ist ständig von der Angst beherrscht, nicht Schritt halten zu können. Die Arbeiterin soll in seiner wachsamen Selbstkontrolle einen Automatismus in Gang bringen. Sie muss sich zusammennehmen, um nicht als sie selbst zu funktionieren. Gerade diese Aufgabe scheint für Anders das entscheidende Paradox an einer solchen Arbeit zu sein. Denn in diesem Prozess erwächst die Zumutung, sich als Akteurin auszulöschen und die eigene Tätigkeit in einen automatischen Vorgang zu verwandeln sowie unter Kontrolle zu halten. Der Arbeiter mache sich auf diese Weise selbst zum Organ des Gerätes. Er lasse sich vom Gang der Maschine einverleiben, nehme seine eigene Passivmachung aktiv in die Hand und führe diesen Kreislauf selbstständig fort.
Da er unter Aufbietung aller Konzentrationskräfte zu versuchen hat, statt selbst Zentrum zu sein, sein Zentrum ins Gerät zu verlegen, muß er zugleich »er selbst« und »nicht er selbst« sein.15
Der an die Maschine angepasste Mensch bleibt sich selbst aber nicht vollständig fremd. Es kommt auch hier zu einer »Selbstbegegnung«. Die Begegnung mit sich selbst – seinem Körper und seinem Geist – findet jedoch nur durch ein negatives Ereignis statt: durch einen Moment, in dem der Konformismus misslingt und der Mensch sich als etwas Anstößiges, als Versager erfährt. Erst durch ein Versagen wird sich der Mensch somit seiner eigenen Identität wieder bewusst:
Nicht deshalb, weil es Selbstbegegnung gibt, wird »Identitätsstörung« erfahren; umgekehrt tritt Selbstbegegnung nur deshalb ein, weil es Störung gibt.16
Im Kapitel »Die ins Haus gelieferte Welt« untersucht Günther Anders Rundfunk und Fernsehen in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft. Er diskutiert seine These am Beispiel eines Gottesdienstes, der im Fernsehen ausgestrahlt wird, sodass eine Vielzahl an Menschen daran teilnehmen kann. Während des Betrachtens scheint es dem naiven Menschen, als ob er die Wirklichkeit und nicht bloß ein Abbild wahrnimmt. Die Inhalte des Gottesdienstes, die Musik und die Atmosphäre haben einen Einfluss auf den Beobachter – offenbaren aber eben auch eine andere, verborgene Tatsache: dass der Mensch an diesem gerade nicht teilnimmt, sondern allein dessen Bild konsumiert.
Dieser Bilderbuch-Effekt ist aber offensichtlich von dem »bezweckten« nicht nur verschieden, sondern dessen Gegenteil. Was uns prägt und entprägt, was uns formt und entformt, sind eben nicht nur die durch die »Mittel« vermittelten Gegenstände, sondern die Mittel selbst, die Geräte selbst: die nicht nur Objekte möglicher Verwendung sind, sondern durch ihre festliegende Struktur und Funktion ihre Verwendung bereits festlegen und damit auch den Stil unserer Beschäftigung und unseres Lebens, kurz: uns.17
Die Kritik, dass eine solche kritische Verallgemeinerung nicht akzeptiert werden könne, da es ausschließlich darauf ankomme, wie wir uns dieser Geräte bedienen, wird somit als Illusion entlarvt. Aufmerksamkeitsräuber, wie heutzutage das Smartphone, werden so konstruiert, dass sie nach ihrer ständigen Benutzung gieren bzw. diese anregen und Menschen bewusst in Abhängigkeit halten. Sie sind nicht wertneutral, sondern bringen den Menschen mit neuen Sachzwängen in Verbindung, sodass die Geräte vom Objekt zum Subjekt der Geschichte aufsteigen.
Gleichzeitig interessiert sich Anders für den eigentlichen Akt des Konsumierens von Bildern im Fernsehen. Was tut der Mensch eigentlich, wenn er da im Wohnzimmer allein oder mit der Familie oder Freunden vor dem Fernsehgerät sitzt und sich unterhalten lässt? Er gleicht, so Anders, einem unbezahlten Heimarbeiter für die Herstellung des Massenmenschen. Millionen von Menschen wird eine stereotyp hergestellte Ware präsentiert. Jeder Fernsehkonsument wird (ganz wie das Präsentierte) als ein »unbestimmter Artikel« behandelt, als jemand ohne individuelle Eigenschaften. Massenmenschen produziert man dadurch, dass man sie Massenware konsumieren lässt. Je einsamer sie sind, umso ausgiebiger findet der Konsum statt. Durch den Konsum von Massenware wird der Mensch zum Mitarbeiter bei der Produktion bzw. durch Umformung seiner selbst zum Massenmenschen. Konsum und Produktion gehen in diesem Verfahren eine trickreiche Symbiose ein. Jedermann ist gewissermaßen als »Heimarbeiter« angestellt und beschäftigt. Vollends paradox wird dieser Vorgang dadurch, dass die Heimarbeiter, statt für ihre Tätigkeit entlohnt zu werden, zudem für das Gerät und dessen Sendungen bezahlen müssen, durch deren Konsum sie sich in den Massenmenschen verwandeln.
Er zahlt also dafür, daß er sich selbst verkauft; selbst seine Unfreiheit, sogar die, die er mitherstellt, muß er, da auch diese zur Ware geworden ist, käuflich erwerben.18
Gustave Le Bon, dessen Psychologie der Massen (1895) bis heute zitiert wird, analysiert unter anderem, wie Menschen von Persönlichkeiten wie Napoleon, denen die Masse Charisma zuschreibt, bestimmte Meinungen eingeflößt werden konnten. Hierzu bedarf es großer Versammlungen und einer geschickt inszenierten Vorstellung, die nicht mit Inhalten operiert, sondern mit Emotionalisierung und die Menschen in eine Art Rauschzustand versetzt. Je größer die Masse, desto geringer ist der (kritische) Verstand.19 Bei Anders wird diese Methode der Einebnung von Individualität und Rationalität in den 1950er-Jahren von zu Hause aus vor den Geräten erledigt.
Massenregie im Stile Hitlers erübrigt sich: Will man den Menschen zu einem Niemand machen (sogar stolz darauf, ein Niemand zu sein), dann braucht man ihn nicht mehr in Massenfluten zu ertränken; nicht mehr in einen, aus Masse massiv hergestellten Bau einzubetonieren. Keine Entprägung, keine Entmachtung des Menschen als Menschen ist erfolgreicher als diejenige, die die Freiheit der Persönlichkeit und das Recht der Individualität scheinbar wahrt.20
Mit anderen Worten: Die Konditionierung des Menschen findet nun bei jedermann gesondert – gewissermaßen in Millionen Einsamkeiten – statt. Sie funktioniert deshalb so effizient, weil die Suggestion durch das Fernsehen »fun« macht: Dem Opfer bleibt auf diese Weise verborgen, was ihm eigentlich abverlangt wird. Und weil sie im privaten Wohnzimmer stattfindet, bleibt sie auch diskret. Welche Auswirkungen Radio und Bildschirm auf die Familie haben, subsumiert Anders unter dem Begriff des »negativen Familientisches«. Entgegen der damaligen öffentlichen Begeisterung für das Fernsehen21, erkennt er in solcher Art von Konsum das Potenzial, die Familie aufzulösen. Aufgelöst wird nicht die Familie als solche, aber was durch das Fernsehen von jetzt an dominiert, ist die wirkliche oder fiktive Außenwelt. Diese herrscht so unumschränkt, dass sie damit die Realität des Nahen und das gemeinsame Leben ungültig und phantomhaft werden lässt:
Wenn das Ferne zu nahe tritt, entfernt oder verwischt sich das Nahe. Wenn das Phantom wirklich wird, wird das Wirkliche phantomhaft.22
Der Fernseher sei ein »Erfahrungsverhinderungsgerät«. De facto sitzen die Familienmitglieder nun zum Fernseher ausgerichtet und die ganze Einrichtung des Wohnzimmers wird an das Gerät angepasst. Man sieht sich nicht mehr, man sieht sich nicht mehr an (höchstens versehentlich) und auch das Miteinandersprechen geschieht eher zufällig oder lediglich im Sinne eines Kommentars zur Phantomwelt des Fernsehens. Die Familienmitglieder sind nicht länger zusammen, sondern nur noch beieinander (oder nebeneinander) – »bloße Zuschauer«.
Die Metamorphose des zwischenmenschlichen Umgangs am »negativen Familientisch« hin zu einem zufälligen, versehentlichen Ereignis ist das eine Problem – ein anderes ist der Verlust des Sprechens. Zur einleitenden Verdeutlichung wird eine Kindergeschichte zitiert, die als Metapher für das dienen soll, was vor dem technischen Gerät passiert:
Da es dem König aber wenig gefiel, daß sein Sohn, die kontrollierten Straßen verlassend, sich querfeldein herumtrieb, um sich selbst ein Urteil über die Welt zu bilden, schenkte er ihm Wagen und Pferd. »Nun brauchst du nicht mehr zu Fuß zu gehen«, waren seine Worte. »Nun darfst du es nicht mehr«, war deren Sinn. »Nun kannst du es nicht mehr«, deren Wirkung.23
Überträgt man diese Pointe auf den Konsum von Rundfunk und Fernsehen, wird aus dem »Nun braucht ihr nicht mehr selbst sprechen« ein »Nun könnt ihr es nicht mehr.« Die Geräte nehmen uns das Sprechen ab und uns damit unsere Sprache weg. Sie berauben uns unserer Ausdruckfähigkeit, unserer Mitteilungsfähigkeit und unserer Sprachlust. Worte sind für die Fernsehgesellschaft
nicht mehr etwas, was man spricht, sondern etwas, was man nur hört; sprechen ist für sie nicht mehr etwas, was man tut, sondern etwas, was man erhält.24
Durch diese Sprachvergröberung, -verarmung und -unlust werden Menschen letztlich zu infantilen, unmündigen und nicht sprechenden Wesen. Die Sprache ist nicht nur der Ausdruck des Menschen, der Mensch ist auch das Produkt seines Sprechens. Oder mit Ludwig Wittgenstein (1889−1951) gesagt: »Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.«25