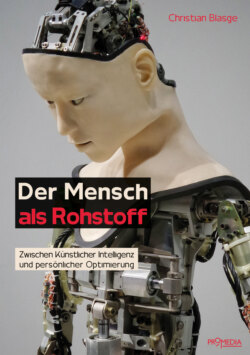Читать книгу Der Mensch als Rohstoff - Christian Blasge - Страница 9
Schwenk zur Gegenwart
ОглавлениеWenn wir die Überlegungen von Günther Anders unserer heutigen Zeit gegenüberstellen, können wir durchaus Parallelen und eine sich zuspitzende Entwicklung erkennen. Führen wir uns nur den Begriff des »negativen Familientischs« vor Augen: In wie vielen Familien haben (neben dem Fernseher) Smartphone, Tablet, Spielkonsole & Co. Erziehung, Gespräch und wechselseitigen Austausch übernommen? Diese technischen Geräte fungieren nicht nur als »Erfahrungsverhinderungsgeräte« dahingehend, dass sie uns vom echten Leben abhalten – sie bringen es auch mit sich, dass wir immer weniger persönlichen Umgang pflegen. Auch die »Ikonomanie« hat ein drastisches Ausmaß angenommen: Auf digitalen sozialen Plattformen jeglicher Art tummeln sich mittlerweile Milliarden Abbilder von Menschen. Die Vervielfältigung des Selbst ist zum Habitus eines modernen Lebensstils geworden. Und das, was Anders als »Maschinenmusik« bezeichnet, hat ebenfalls eine Steigerung erfahren: Heute existieren ganze Musikgenres, die vollständig ohne Menschen und Instrumente auskommen. Künstliche Intelligenzen wie Jukedeck komponieren in Sekundenschnelle neue Lieder, die von den von Menschen gemachten Produkten nicht mehr zu unterscheiden sind.
Manche seiner im Gewand der damaligen technischen Möglichkeiten formulierten Gedanken wirken für die heutige Leserin ohne Zweifel leicht antiquiert – und doch ist die Kernaussage essenziell. Es ist eine Tatsache, dass unsere moderne Gesellschaft über die erste und zweite industrielle bis zur dritten digitalen Revolution (Computerwesen, Internet, Smartphones usw.) kontinuierlich eine einseitige Symbiose mit der Maschinenwelt eingegangen ist. Solange Maschinen kein ausgeprägtes Bewusstsein besitzen, was sich in den kommenden Jahrzehnten eventuell ändern wird, fällt dieses Zusammenspiel unilateral aus. Die Maschinen brauchen uns nicht, wir in der westlichen, wohlhabenden Gesellschaft dagegen können uns ein Leben ohne diese technischen Hilfsmittel kaum mehr vorstellen. Neben den positiven Seiten des technologischen Wandels – rasche Informationsbeschaffung, ständige Erreichbarkeit und die blitzschnellen, weltweiten Kommunikationsmöglichkeiten – sind ebenso viele neue Herausforderungen und Belastungen entstanden. Die Reizüberflutung und das Überangebot an Möglichkeiten überfordern uns Menschen, die wir in diesen technologischen Transformationsprozess eingestiegen sind. Wenn von Transformation gesprochen wird, wird zugleich angenommen, dass der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. Das Gleiche betrifft die technologische Entwicklung. Wir befinden uns möglicherweise nach wie vor in einem Anfangsstadium, aber wohin soll die Reise überhaupt gehen? Diese Frage möchte ich zum Ausgangspunkt der nächsten Kapitel nehmen.
Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, benennt in einer seiner Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (aus dem Jahr 1917) drei Kränkungen der Menschheit. In diesen (aufeinander aufbauenden) Kränkungen wurde das Selbstverständnis des Menschen durch wissenschaftliche Erkenntnisse fundamental vor den Kopf gestoßen:
1 Die kosmologische Kränkung: Nach der Kopernikanischen Wende musste der Mensch akzeptieren, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist.
2 Die biologische Kränkung: Nach Charles Darwins Evolutionstheorie ist die wissenschaftliche Gemeinschaft zu dem Konsens gelangt, dass sich der Mensch aus dem Tierreich entwickelt hat.
3 Die psychologische Kränkung: Freud fügte diesen Kränkungen eine dritte hinzu. Danach entzieht sich ein beträchtlicher Teil des Seelenlebens unserer bewussten Kenntnis: »Das Ich ist nicht Herr in seinem eigenen Haus.«26Es wäre angebracht, der Menschheit aus heutiger Sicht eine weitere Kränkung hinzuzufügen: die Kränkung ihrer Intelligenz. Günther Anders spricht von »prometheischer Scham« und meint damit die aus seiner Unvollkommenheit herrührende Scham des Menschen gegenüber den von ihm geschaffenen Produkten. Diese Scham dürfte mittlerweile das Potenzial einer Kränkung erreicht haben.
4 Die intellektuelle Kränkung: Der Mensch gilt nicht mehr als die einzige intelligente Lebensform auf der Erde. Seine Schöpfungskraft hat dazu geführt, dass nicht nur seine Fähigkeiten, sondern auch seine kognitiven Kapazitäten von Maschinen abgelöst worden sind. Er ist sozusagen »nicht mehr allein«.
Sobald künstliche Intelligenzen in überwiegende Bereiche unseres Lebens eingedrungen sein werden, wird es zu einer Zäsur in unserer Selbstwahrnehmung kommen. Wir werden uns nicht länger als »Krone der Schöpfung« betrachten können. Vielmehr haben wir uns durch unsere Schöpfungskraft selbst abgelöst, indem wir in den biologischen Evolutionsprozess eingegriffen und diesen beschleunigt haben. Unsere individuelle Urteilskraft wird zu einem nicht unerheblichen Teil durch personalisierte Datensammlungen über unsere Vorlieben, Probleme und Fähigkeiten abgelöst werden, in denen bereits ein technischer Algorithmus berechnet hat, was wir als Nächstes tun sollen. Aus Effizienzgründen und Bequemlichkeit wird man diese »Erleichterung« mit offenen Armen in das eigene Leben integrieren. Menschen, die auf diese Hilfsmittel verzichten, dürften bald von ihren Konkurrenten abgehängt werden. Diese Grundeinstellung mag dazu führen, dass man sich den Verzicht beruflich, aber auch sozial nicht mehr leisten können wird. Man fällt zurück, man gehört nicht mehr dazu – man ist antiquiert. Dass künstliche Intelligenzen bestimmte Analyse- bzw. Beraterfunktionen übernehmen oder uns bestimmte Aufgaben abnehmen werden, ist nur ein Aspekt der Vielzahl an technologischen Neuerungen. In der philosophischen Denkrichtung des sogenannten Transhumanismus strebt man sogar eine körperliche Symbiose zwischen Mensch und Maschine an. Mit dieser Verschmelzung sollen die Grenzen, die uns einst die Natur gesetzt hat, überwunden werden. Gegenwärtig spricht man noch von konservativ-traditionellen Erweiterungen des menschlichen Körpers, die unser Leben erleichtern: Herzschrittmacher, künstliche Gelenke oder Dialysegeräte. Realistische Prognosen stellen jedoch bereits Implantate in Aussicht, die unsere Gedächtnisleistung steigern und unsere Vitalwerte aufzeichnen. Winzige Roboter sollen beschädigte Zellen und Gewebe im Körper reparieren oder Tumore vernichten. Transhumanisten beschwören sogar euphorisch die Wahrscheinlichkeit, in einigen Jahrzehnten technologisch so weit fortgeschritten zu sein, dass die menschliche Unsterblichkeit in greifbare Nähe rückt. Ob man dabei durch regenerative Maßnahmen im selben Körper verbleiben kann oder sein Bewusstsein komplett in einen neuen Körper transferiert – prinzipiell scheint nichts mehr unerreichbar zu sein.
Es zeichnet sich somit der Trend ab, dass der zukünftige Mensch nicht nur immer umfangreichere Symbiosen mit Maschinen bzw. künstlichen Intelligenzen eingehen (müssen) wird, sondern dass auch futuristische Modifikationen des eigenen Körpers keine Seltenheit mehr darstellen. In der Hoffnung, die vierte Kränkung der Menschheit überwinden zu können, wird der Mensch eine Allianz mit der überragenden Konkurrenz der Maschinen und den dahinterstehenden Konzernen eingehen müssen. Philosophisch gesehen bietet dieses Zukunftsszenario reichlich Stoff für Interpretation, Diskussion und Kritik. Schritt für Schritt muss das Verhältnis zwischen Mensch und Maschine aufgearbeitet werden.