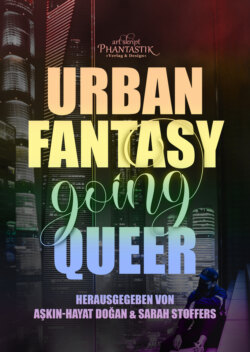Читать книгу Urban Fantasy going Queer - Christian Handel - Страница 14
Stone Butch Muse
ОглавлениеElea Brandt
Ich habe geschlafen. Ja, das klingt banal, aber es ist eine Sensationsmeldung. Seit Beginn des Entzugs habe ich kaum ein Auge zugetan. Jede Nacht war die Hölle. Der kalte Schweiß klebte an den Bettlaken, bescherte mir Schüttelfrost, bis meine Zähne aufeinanderschlugen. Die meiste Zeit war mir kotzübel, ich brachte nichts runter, höchstens die eine mickrige Tasse Kaffee am Morgen – und selbst der schmeckte scheiße. Die Medis helfen ein bisschen, mein Hirn fühlt sich jetzt an, als wäre es in Watte gepackt. Meine Gedanken sind träge und schwerfällig, aber sie kreisen nicht mehr ständig um Selbsthass und Weltschmerz. Könnte schlechter sein.
Ich rapple mich auf und dehne meinen schmerzenden Nacken. Mir tut echt alles weh, diese Klinikbetten sind hart wie Stahl. Das vergitterte Fenster erweckt den Eindruck eines Gefängnisses, auch wenn ich draußen direkt in einen Garten blicke, der die Klinik umringt. Das Grün tut gut. Die letzten Wochen habe ich nur auf Beton gestarrt, auf die rissigen Wände in meiner schmutzigen Bude im Frankfurter Bahnhofsviertel und auf die schmierigen Tresen billiger Kneipen. Das hier ist besser, definitiv.
Ich öffne das Fenster und lasse etwas kalte Luft hereinströmen. Ich bin froh, in einem Einzelzimmer zu liegen, gerade ist mir nicht nach Gesprächen. Ich weiß, dass sich das ändern muss, deswegen bin ich ja hier, doch zuerst brauche ich einen guten Plan. Es heißt immer, in der Therapie wäre Offenheit wichtig, aber wie soll ich das anstellen?
»Hi, ich bin Melete, meine Pronomen sind sie/ihr und ich bin eine Muse.«
Eine depressive, alkoholabhängige Muse, um genau zu sein. Soweit noch okay, aber dann kämen die Fragen und die unausweichliche Tirade von misogynen Vorurteilen. Erfolgreiche Männer und ihre Musen, ihr wisst schon. Zwinki-zwonki. Zur Klarstellung: Ich bin ein Profi und ich schlafe nicht mit meinen Klient*innen. Sex ist eh nicht so mein Ding und Männer auch nicht. Ich bin eine Stone Butch Muse. Aber egal, das ist eine andere Geschichte.
Ab da wird es jedenfalls kompliziert. Meistens erkläre ich den Leuten, ich sei eine Art Lifecoach. Das klingt modern und hip. Dass ich in der Lage bin, kreative Schwingungen zu spüren und zu verstärken, dass ich Menschen mit einem Fingerschnippen in einen Flow versetzen und zumindest für eine Weile die Zweifel aus ihren Gedanken vertreiben kann, behalte ich doch lieber für mich. Für die meisten klingt das entweder nach Zauberei oder nach Scharlatanerie.
Eigentlich ist es nichts von beidem, es ist vielmehr eine Mischung aus Begabung und Handwerk. Ich spüre die Emotionen und Schwingungen anderer Menschen. Ich kann sie fühlen, auf der Zunge schmecken und sogar riechen. Fragt mich jetzt bitte nicht, wie Hass riecht oder Angst. Ziemlich eklig, das kann ich euch sagen, aber es gibt nichts, womit ich das beschreiben könnte. Menschen mit besonderen Talenten und Begabungen ragen für mich aus der Menge heraus wie ein explodierendes Leuchtfeuer. Ich finde sie immer, irgendwie. Menschen, die Worte wie Geschosse nutzen, die außergewöhnliche Gemälde schaffen oder Melodien schreiben, die einem das Herz zerreißen.
Was danach kommt, ist im Grunde nur Neurologie und ein Hauch von Metaphysik. Ich vertiefe mich in mein Gegenüber und steuere bestimmte Frequenzen an, um die neuronale Aktivität zu beeinflussen. Das Cortisol steigt an, der präfrontale Kortex, der für rationales, strategisches Planen zuständig ist, fährt herunter und ich flute die Amygdala mit Lust und Dopamin. Aber ich will euch nicht mit physiologischem Blabla langweilen. Die Kurzfassung ist: Ich bringe Menschen dazu, ihr volles Potenzial zu entfalten. In der Theorie zumindest, denn in der Praxis – nun, ihr seht es ja. In der Praxis sitze ich im sterilen Zimmer eines psychiatrischen Bezirkskrankenhauses, kämpfe gegen das Verlangen nach einem Schluck Wodka und schleppe mich ins angrenzende Badezimmer für eine Dusche.
Ich drehe das heiße Wasser voll auf und lasse es auf meine Haut prasseln bis knapp an die Schmerzgrenze. Mein schwarzes Haar ist so raspelkurz, dass es binnen Sekunden trocknet. Das ist ganz praktisch. Ich reibe es mit Shampoo ein, stelle mich erneut unter den heißen Wasserstrahl und sehe zu, wie die Seife in einer milchig-weißen Bahn im Abfluss verschwindet. Das winzige Bad ist voll schwerer Dampfschwaden, als ich wieder aus der Dusche steige, der Spiegel komplett beschlagen. Besser so. Ich muss meine Augenringe nicht sehen, um zu wissen, dass sie da sind.
Gerade bin ich in T-Shirt und Jogginghose geschlüpft, da klopft es an der Tür und eine freundlich lächelnde Pflegekraft ruft mich zum Frühstück. Ich habe keinerlei Appetit, aber irgendwas werde ich schon runterwürgen, und wenn es nur eine Tasse tiefschwarzer Kaffee ist. Wenigstens sehen die anderen Patient*innen ringsum genauso fertig aus, wie ich mich fühle. Das beruhigt mich irgendwie. Andererseits sind die halt auch Menschen, keine übersinnlichen Wesen mit abgefahrenen Gimmicks wie ich.
Ehe ihr fragt: Nein, ich kann meine Fähigkeiten nicht an mir selbst anwenden. Das wäre ja auch albern. Ich bin Muse, keine Künstlerin. Ich schaffe nicht, ich kreiere nicht. Ich bringe andere dazu, etwas zu erschaffen und die Begabung zu entfalten, die in ihnen schlummert. Zumindest ist das der Plan. Die Wahrheit ist aber: Ich bin die beschissenste Muse aller Zeiten.
Es ist nicht so, als hätte ich im Laufe meiner Karriere nie irgendetwas zustande gebracht. Ich schätze, Mary Shelley ist euch ein Begriff, ja? Gut. Keith Haring? Oh, kommt schon, Achtzigerjahre Pop-Art? Diese bunten, eckigen Comic-Männchen? Geez. Dann vielleicht Israel Kamakawiwo’ole, diese Wahnsinnsstimme von Somewhere Over the Rainbow?
Okay, ich will nicht lügen, so geht es mir immer, wenn ich meine wenigen Erfolgsgeschichten erzähle, und es fuckt mich ab. Ehrlich. Ja, dann war ich vielleicht nicht die treibende Kraft hinter einem Mozart, einem Monet oder einem Johann Wolfgang von fucking Goethe, aber verdammt, meine Leute hatten Talent! Unfassbares Talent! Sie hatten nur das »Scheißpech«, eine Frau, schwul oder ein Native zu sein. Und, na ja, früh zu sterben.
Könnt ihr euch vorstellen, wie frustrierend das ist? Es gibt so viele unfassbar talentierte Leute da draußen und diese Menschen zu unterstützen und ihr Potenzial zu entfalten, fühlt sich erfüllend und großartig an. Und am Ende brandest du irgendwo gegen eine gläserne Decke. Die Verantwortlichen schwafeln irgendwas davon, dass nur Talent zählt, dass es ja gar nicht auf Geschlecht, Hautfarbe, was auch immer ankäme. Scheiße, verdammt, ich sehe Talent! Ich fühle es! Und ich weiß genau, wie viele talentierte Menschen nie den Glanz und den Ruhm bekommen haben, die sie verdienten, einfach, weil sie nicht dem Wunschbild der Mehrheitsgesellschaft entsprachen oder von ihr im Stich gelassen wurden.
Tja, meine Kolleg*innen waren schlauer als ich. Die haben sich die Talente herausgepickt, die erfolgversprechend waren. Die nicht am Hungertuch nagten und irgendwann die Entscheidung treffen mussten, ob sie Künstler*innen sein oder ein menschenwürdiges Leben führen wollen. Oder wenigstens solche, die nach ihrem Tod sprunghaft an Bekanntheit gewannen, weil die Welt einen gewissen Typus des »leidenden Künstlers« doch ganz charmant findet.
»Wir mischen uns nicht ein«, sagen sie immer. »Wir Musen inspirieren, wir entscheiden nicht.«
Die Erregung flirrt in meinen Fingerspitzen, ich kann kaum die Kaffeetasse halten. Sie sind so feige, allesamt. Klammern sich an ihren Status quo wie ein Alki an seine Flasche Schnaps.
Ja, toller Vergleich, Mel. Warum bist du noch gleich hier? Ach ja, weil du dich mit achtzigprozentigem Korn beinahe ins Koma gesoffen hättest. Super Nummer für eine Muse. Ehrlich. Aber scheiße, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann nicht so tun, als wäre mir das egal. Ich will mich nicht anpassen, ich will nicht zusehen, wie dieses Potenzial einfach verschwindet, weil sich die Welt entschieden hat, lieber eine kapitalistische Konsumhölle zu sein als ein kreatives Paradies. Ich bin es leid, mitzuerleben, wie Künstler*innen ihre Träume aufgeben, um ihre Rechnungen bezahlen zu können. Ich kann so nicht arbeiten, verdammte Scheiße!
Hilflosigkeit und Frust schnüren mir die Kehle zu und im selben Moment spüre ich eine Berührung am Arm.
»He, alles okay?«
Ich blinzle und blicke meine Mitpatientin an, die sich gerade mit einer Schale Müsli und einem Tee neben mich gesetzt hat. Sie ist Schwarz – vielleicht auch Mixed – und trägt Cornrows, die in zwei feste, geflochtene Zöpfe übergehen. Auf ihrem ausgeblichenen T-Shirt steht No fucks given. Sie ist mir jetzt schon sympathisch, aber das spielt im Grunde keine Rolle, denn allein ihre Anwesenheit lässt meinen Puls flirren. Da ist dieses Prickeln hinter meinen Schläfen und ich gebe mir Mühe, sie nicht anzustarren, obwohl die Kraft und die Intensität, die von ihr ausgehen, überwältigend sind. Es ist wie ein Klingeln in meinen Ohren, ein warmes, wunderschönes Gefühl, das meinen Brustkorb füllt und jede Faser meines Körpers durchdringt. Liebe kann sich nicht besser anfühlen.
»Ähm ja«, nuschle ich hastig, um nicht aufzufallen. »Geht schon. Bin nur ziemlich groggy.«
Die Aura, die sie umfängt, dringt in jede meiner Poren, als ich sie ansehe, und fast muss ich lachen. Hier. Ausgerechnet hier. Aber warum nicht? Künstlerisches Talent ist nichts, das man nur auf Universitäten, Kunsthochschulen oder Oscar-Verleihungen findet. Wenn man sich ansieht, wie viele kreative Genies im Laufe ihres Lebens Stress mit Alkohol oder Drogen hatten, dürfte die Trefferquote in Entzugskliniken gar nicht so niedrig sein. Aber hier, in diesem Kaff, irgendwo in der hessischen Provinz? Wie wahrscheinlich ist das?
Meine Sitznachbarin nippt an ihrem Tee und lächelt mitfühlend. »Ja, ging mir am Anfang auch so. Bist du schon lang hier?«
»Nein, ne Woche etwa. Ich bin Mel, übrigens.«
»Sharon. Freut mich.«
Mir liegt die Frage auf der Zunge, warum sie hier ist, aber ich schlucke sie wieder hinunter. Das geht mich nichts an. Also, es geht Mel, die Patientin, nichts an. Die Muse Melete vielleicht schon.
Ich verwickle Sharon in ein wenig Smalltalk. Essen, Zimmer, Wetter. Worüber man eben redet, wenn man den Elefanten im Raum nicht ansprechen will. Am Ende tut sie es aber doch.
»Warum bist du hier?«
»Alkohol«, brumme ich halblaut. »Und du?«
»Benzodiazepine«, antwortet sie. »Xanax und so, Beruhigungstabletten, du weißt schon.«
Ich nicke. Elvis war auch süchtig nach dem Zeug, Michael Jackson ist sogar daran gestorben. Da war ich aber nicht beteiligt. Das schwöre ich. »Dein erster Entzug?«
Ihre Antwort klingt ungewöhnlich heiter: »Hatte die Schnauze voll. Anfangs dachte ich, die Entzugserscheinungen wären immerhin besser als die Flashbacks, aber nope. Sind sie nicht.«
Wieder nicke ich nur. Ich weiß genau, was sie meint. Selbstmedikation. Den einen Kummer durch ein anderes Ärgernis eintauschen. Geht selten gut aus. Ich würde Sharon gerne fragen, welche Flashbacks sie quälen. Ob sie eine Überlebende ist. Aber eigentlich spielt es keine Rolle. Ich hasse das Klischee vom »leidenden Künstler«, diese romantisierte Vorstellung, kreative Menschen müssten Leid und Entbehrung ertragen, damit sie etwas Bedeutendes schaffen können. Bullshit! Als würden Existenzängste, psychische Belastungen und Minoritätenstress nicht jeden kreativen Impuls lähmen. Vor allem dann, wenn die Täter*innen selbst ganz oben in diesem Business stehen. Und dennoch, ich glaube daran, dass neurodiverse Menschen einen besonderen Zugang zu Kreativität haben. Einen, den die Welt oft nicht sieht, weil sie in ihren normativen Bahnen denkt. Aber ich sehe ihn.
»Außerdem«, fährt sie fort, »macht mich das Zeug komplett wuschig im Hirn. Früher hab ich immer Songs geschrieben, um runterzukommen, aber auf Xanax hab ich keine einzige Zeile zustande gebracht.«
Ich merke, wie meine Finger vor Anspannung kribbeln, und nehme zur Ablenkung einen weiteren Schluck Kaffee. Die Tasse zittert so sehr in meinen Händen, dass ich einen Teil davon verschütte. »Du bist … Musikerin?«
»Mehr oder weniger. Bin aus meiner alten Band ausgestiegen und wollte solo weitermachen, aber dann ging es mit den Benzos los und ich bekam nichts mehr auf die Kette.« Sie lacht, es klingt eine Spur zynisch. »Ich bin also eine ziemlich unnütze Musikerin.«
Passt gut, ich bin ja auch eine unnütze Muse. Trotzdem widerspreche ich ihr: »Unsinn. Ich wette, du warst ziemlich gut.«
»Woher willst du das wissen?«
»Intuition.«
»Und wenn schon.« Sie leert ihren Tee. »Das ganze Business ist scheiße. Die verlangen von dir, dass du deine Seele verkaufst — oder noch mehr —, für wenige Augenblicke Ruhm. Das große Geld machen sowieso die anderen. Das ist es nicht wert, daran kaputt zu gehen, weil ein paar Arschlöcher denken, sie könnten sich alles erlauben.«
Ich nicke bedächtig und weiß ganz genau, wovon sie redet. Unter dem Tisch kralle ich die Fingernägel in meine Oberschenkel, um die Wut zu unterdrücken, die in mir aufwallt. Ich kann mir lebhaft vorstellen, was Sharon durchgemacht hat. Warum sie zu den Tabletten gegriffen hat, um diese ganze Scheiße irgendwie zu ertragen. Es ist so verflucht unfair.
Die Frage gleitet mir unbedarft über die Lippen: »Kannst du was für mich singen?«
Sie gluckst. »Hier? Jetzt?«
»Nein, ich meine nur … irgendwann. Oder so.«
»Klar. Aber erstmal muss ich den ganzen Scheiß hier durchziehen.«
Ich nicke und nehme einen Schluck Kaffee. Ja, erstmal den Entzug beenden, weg von der Flasche, irgendwie wieder auf die Beine kommen. Die Welt wird sich nicht von heute auf morgen ändern, also muss ich das Beste daraus machen. Und vielleicht ist Sharon ein Anfang.
***
Mein erster Abend auf der Piste seit dem Entzug. Mittlerweile bin ich drei Monate trocken und gehe einmal in der Woche zu einer Selbsthilfegruppe beim Blauen Kreuz. Der Kaffee dort ist stark und, glaubt es oder nicht, ich finde es echt angenehm, offen mit Leuten reden zu können. Nicht ganz offen, schon klar, ich bin bei der Lifecoach-Nummer geblieben. Aber sich mal richtig auszukotzen, das tut gut. Die Leute dort verstehen einen wenigstens. Und die meisten sind noch übler dran als ich.
Auf dem Weg zum Cool Down nehme ich bewusst den Weg durchs Bahnhofsviertel, vorbei an den neon-bunt beleuchteten Hausfassaden und den engen Eckkneipen, in denen ich mir noch vor wenigen Monaten das Hirn weggesoffen habe. Ich muss mir beweisen, dass ich es kann. Dass dieser Ort keine Macht über mich hat. Es ist heiß und die Luft ist schwer wie Blei, es riecht nach Ozon, Abgasen und Gras.
Klingt absurd, ich weiß, aber ich liebe die Stadt. Sie hat diesen eigenen Rhythmus. Eine Kakophonie aus wummernden Bässen, hupenden Autos und lachenden Menschen. Niemand könnte so ein perfekt choreographiertes Durcheinander komponieren.
Ich erreiche das Cool Down wenige Minuten später. Der Geruch nach Schnaps hängt in der Luft, als ich eintrete, doch mein Suchtdruck hält sich zum Glück in Grenzen, obwohl hinter dem Tresen ein gut sortiertes Schnapsregal steht. Ich bestelle beim Barkeeper mit den schulterlangen Locs eine eiskalte Cola und stelle mich an einen der Stehtische.
Viel ist nicht los, zwei Dutzend Gäste vielleicht, und ich bin die einzige Weiße hier. Das Licht ist gedämpft, nur die kleine Bühne am anderen Ende des Saales ist erleuchtet.
Dort sehe ich sie wieder – Sharon. Es war nicht allzu schwer, sie ausfindig zu machen, auch wenn ich mich jedes Mal wie eine Stalkerin fühle. Sie hat den Entzug durchgehalten, obwohl es ihr dabei dreckiger ging als mir, und wir versprachen einander, Kontakt zu halten. Ich konnte nicht anders. In der Kreativtherapie habe ich sie singen hören und mir war sofort klar, dass ich meine nächste Klientin gefunden hatte. Ihre Stimme ist rau, scharf und dunkel, mit Ecken und Kanten, wie gesplittertes Glas, und genau deswegen unvergleichlich. Sie passt zu ihr. Sie singt wie eine Kriegerin, die sich auf die Schlacht einstimmt.
Ein Techniker justiert das Mikro und richtet die Scheinwerfer aus. Eine junge Frau in Jeans und Crop Top kündigt Sharon an. Dann wird es still.
Allein ihre Präsenz ist atemberaubend, aber vermutlich nehme das nur ich wahr. Ich konzentriere mich ganz auf Sharon, auf die Schwingungen, die von ihr ausgehen. Keine zarten Wellen, sondern mächtige Wogen, ein Sturm, der um sie tost, als sie zu singen beginnt. Ich schließe die Augen. Ihre Texte sind schmerzhaft, aber kraftvoll. Sie singt über systemische Gewalt und Willkür, über Einsamkeit und Solidarität. Ihre Lyrics fluten meinen Kopf mit Bildern und Farben, Gerüchen und Emotionen. Ich ertrinke schier darin. Ich sammle meine Konzentration. Zuerst tasten meine mentalen Fühler über das Publikum. Ich spüre Ergriffenheit, Anerkennung, Wut. Einer von ihnen langweilt sich. Pff. Banause.
Ich erreiche Sharon und es ist mir lange nicht mehr so leichtgefallen, die richtigen Frequenzen zu finden. Manchmal vergleiche ich meine Arbeit mit der einer Mischerin am Tonpult. Ich schiebe Regler auf und ab, drücke Knöpfe, finde die perfekte Komposition. Nur, dass diese Regler Gehirnwellen und die Knöpfe Synapsen sind.
Befriedigt spüre ich, wie meine Arbeit Früchte trägt. Die Macht in Sharons Stimme reißt nun alle im Raum mit sich. Schön, ich mag eine beschissene Muse sein, aber das, das nimmt mir niemand. Ich versinke in Sharons Songs und will an keinem anderen Ort der Welt sein. Gerade ist mir alles egal, der Drecks-Kapitalismus, das ganze verfickte System, alles. Ich will einfach nur das tun, wozu ich geboren wurde. Inspirieren. Ermächtigen. Empowern.
Sharon beendet ihren Auftritt mit donnerndem Applaus, und als sie wenig später aus dem Backstagebereich in die Bar kommt, überschlägt sich das Publikum mit Lob und Anerkennung. Sie schreibt Autogramme, einige fragen, wie man sie unterstützen kann.
Ich bleibe etwas abseits stehen. Die Euphorie ebbt ab und Zweifel schleichen sich ein. Was lässt mich glauben, dass es bei Sharon anders wird als bei allen davor? Wer weiß, ob ich nicht in einem halben Jahr wieder an der Flasche hänge, depressiv und frustriert von der Welt?
Die Antwort ist einfach: nichts. Außer meine schiere Überzeugung, dass Sharon es wert ist, aus meinem Schneckenhaus zu kriechen. Es geht hier nicht um mich, verdammt, es geht um sie. Wer bin ich, ihr diese Chance zu verweigern? Wer bin ich, mich feige zu verkriechen, wenn Menschen wie Sharon nur ihre Kunst haben, um sich auszudrücken, und für die eigenen Ideale zu kämpfen? Sharons Waffen sind ihre Lyrics, die wie Messer treffen, und ihre Melodien, die tief ins Mark dringen. Und scheiße, egal, was in ein paar Monaten sein wird, bei diesem Kampf will ich an ihrer Seite stehen.
Let the show begin.
-----------------------------------------------------------
Elea Brandt (sie/ihr) ist Fantasyautorin, Vollzeitgeek und queer-feministische Shitstormtrooperin. Die studierte Psychologin beendet gerade ihre Doktorarbeit über die Behandlung gefährlicher Straftäter und bewundert die Komplexität der menschlichen Psyche. Sie engagiert sich aktiv für mehr Diversität und Inklusion in der Phantastik und ist noch auf der Suche nach dem passenden Label für ihre eigene queere Identität. Fürs Erste fühlt sie sich aber unter dem Label »gray ace« sehr wohl. Sie lebt mit ihrem Verlobten, »dem Juristen«, in Nürnberg.
Website: www.eleabrandt.de
Instagram: www.instagram.com/eleawriting
Twitter: www.twitter.com/eleabrandt