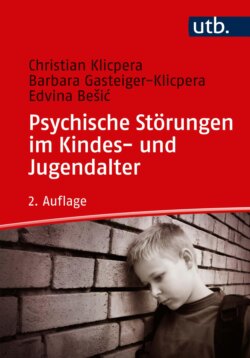Читать книгу Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter - Christian Klicpera - Страница 10
1.2 Neuere Geschichte der Klassifikation psychischer Störungen
ОглавлениеDie Klassifikation psychischer Störungen durch Kraepelin hat sich in den meisten Ländern relativ rasch durchgesetzt. Trotzdem haben verschiedene Staaten ihre eigenen Traditionen ausgebildet und etliche Denkschulen entwickelten eigene Klassifikationsansätze. Ein intensives Bemühen um die internationale Vereinheitlichung dieser Klassifikationen ist erstmals nach dem Zweiten Weltkrieg festzustellen. Eine internationale Expertengruppe der Weltgesundheitsorganisation (WHO) arbeitete ein Klassifikationssystem aus, in dem jede psychische Störung kurz beschrieben wurde.
In den 1950er-Jahren begann man, sich auf empirischer Basis mit der Frage der klinisch-psychologischen bzw. psychiatrischen Diagnostik auseinanderzusetzen. Diese Arbeiten zeigten, dass selbst bei Verwendung eines einheitlichen Klassifikationssystems große Unterschiede zwischen verschiedenen PsychiaterInnen bzw. PsychologInnen bestanden, die Klassifikation also wenig reliabel war (Kendell, 1978). Verschiedene Ursachen dieser geringen Übereinstimmung wurden identifiziert, etwa unterschiedliche diagnostische Präferenzen einzelner PsychiaterInnen, eine mangelnde Systematik bei der Informationserhebung, die unterschiedliche Bewertung und Gewichtung einzelner Symptome bei der diagnostischen Entscheidung oder die unterschiedliche Handhabung der Möglichkeit des Stellens einer Mehrfachdiagnose.
Weiters zeigte sich, dass auch zwischen verschiedenen Ländern systematische Unterschiede in der diagnostischen Praxis bestanden. Der bekannteste Versuch, diesen Unterschieden nachzugehen und die Ursachen dafür aufzuspüren, ist das UK-US-Diagnosen-Projekt (Cooper, Kendell, Gurland et al., 1972), in dem die Ursachen für die Tatsache eruiert wurden, weshalb in den USA die Diagnose einer Schizophrenie deutlich häufiger gestellt wurde als in England.
Aus den negativen Erfahrungen wurden Anforderungen an ein Klassifikationssystem abgeleitet, die auf eine möglichst große Reliabilität, aber auch auf eine bessere Brauchbarkeit der diagnostischen Kategorien hinzielten:
1. Reliabilität
Deren Notwendigkeit wurde besonders betont:
– Nur jene Unterscheidungen sind sinnvoll, die eine ausreichende Beurteilerübereinstimmung aufweisen, über die somit zwischen verschiedenen PsychologInnen und PsychiaterInnen eine hinreichende Verständigung erzielt werden kann.
– Angesichts der Pluralität der Konzeptionen psychischer Störungen und der vielfältigen Theorieansätze ergibt sich die Notwendigkeit, sich auf Einteilungen zu stützen, die weitgehend theorieunabhängig bzw. deskriptiv sind und Merkmale erfassen, über deren Vorhandensein bzw. Nichtvorhandensein ein Konsens erzielbar ist.
– Die Spezifität der intentionalen Definition muss möglichst groß sein. Je mehr Merkmale angeführt werden, desto größer ist die Notwendigkeit diagnostischer Regeln.
2. Deckungsumfang
In einem Klassifikationssystem sollten möglichst alle Formen psychischer Störungen erfasst werden. Zudem sollten die Schwierigkeiten aller PatientInnen diagnostizierbar sein, nicht nur jene von PatientInnen, die ein sehr typisches Störungsbild zeigen. Dies steht in gewissem Widerspruch zur Reliabilität, da die Übereinstimmung in den weniger klaren Fällen naturgemäß geringer ist.
3. Deskriptive Validität
Die Homogenität der diagnostischen Kategorien sollte möglichst groß sein, das heißt, es sollten nur Gruppen zusammengefasst werden, die tatsächlich viel gemeinsam haben.
4. Prädiktive Validität
Die Stellung einer Diagnose ist nur sinnvoll, wenn daraus Aussagen über den weiteren Verlauf, die angemessene Form der Behandlung und Ähnliches ableitbar sind.
Die letzten Jahrzehnte waren durch das Bemühen gekennzeichnet, diesen Anforderungen zu entsprechen und die Zuverlässigkeit sowie die Aussagekraft der Klassifikation psychischer Störungen zu erhöhen. Folgende Entwicklungen sind hervorzuheben:
– Statt allgemeiner Beschreibungen der hervorstechenden Merkmale psychischer Störungen wurden genaue, operationalisierte Kriterien formuliert, die eine einheitliche Entscheidungsfindung erlauben sollten. Dabei wurde nicht nur festgehalten, welche Symptome bzw. Merkmale als Kriterium für eine Diagnose vorhanden sein müssen, sondern auch, welches Gewicht diesen Merkmalen für die Diagnose zukommt und welche Bedingungen ausgeschlossen werden müssen, damit eine Diagnose gestellt werden kann.
– Bei der Diagnostik psychischer Störungen sind in vielen Fällen verschiedene Ebenen zu beachten – ein Teil der PatientInnen weist auch körperliche Krankheiten auf, bei anderen ist die Fähigkeit zum Zurechtkommen in der Umwelt durch kognitive Beeinträchtigungen, wieder bei anderen durch äußere Belastungen erschwert. Bei einem Teil entwickeln sich besondere Probleme bzw. Symptome vor dem Hintergrund einer bereits lang andauernden Persönlichkeitsstörung. Da sich zeigte, dass die Diagnostik zu einem Gutteil deshalb so uneinheitlich war, weil diese verschiedenen Ebenen nur zum Teil berücksichtigt wurden, wurden „multiaxiale“ Diagnosesysteme entwickelt.
– Die Klassifikation psychischer Störungen wird immer umfassender. Es besteht eine starke Tendenz zur Ausweitung dessen, was als spezielle Form einer psychischen Störung betrachtet wird. So hat sich die Zahl der diagnostizierbaren psychischen Störungen im offiziellen Diagnosesystem der amerikanischen psychiatrischen Vereinigung von der ersten (1952) über die zweite (1968) bis zur dritten Fassung (1980) von etwas über 100 auf über 180 und schließlich auf über 260 Störungen erhöht (Garfield, 1993). Dabei wurden statt des langsamen Prozesses einer allmählichen Durchsetzung neuer diagnostischer Kategorien die Komiteearbeit und die Mehrheitsentscheidung eingeführt. Allerdings wurde auch ein Mechanismus der empirischen Überprüfung eingebaut: die sogenannten Feldversuche, in denen neue Vorschläge zur Definition psychischer Störungen auf ihre Brauchbarkeit hin (z. B. Häufigkeit der Verwendung, Beurteilerübereinstimmung) geprüft wurden.
– Als ein weiterer Schwachpunkt in der Diagnostik psychischer Störungen wurde die Informationserhebung ermittelt. Im Wesentlichen stützt sich die klinischpsychologische Diagnostik auf die Informationserhebung mittels eines Gesprächs bzw. klinischen Interviews mit den PatientInnen. Um die Möglichkeit zu minimieren, dass Informationen deshalb nicht in die Diagnose eingehen, weil nicht danach gefragt wurde, sind in den letzten Jahren zahlreiche standardisierte psychiatrische bzw. klinisch-psychologische Interviews entwickelt worden – zum Teil mit Leitfäden, die genau definieren, wie die erhobenen Informationen bei der Diagnosestellung zu werten sind.
Diese Entwicklungstendenzen finden im amerikanischen Klassifikationssystem für psychische Störungen ihren klarsten Ausdruck. Die dritte Fassung dieses Systems, DSM-III (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, American Psychiatric Association (APA)), die 1980 herausgegeben und 1987 nochmals überarbeitet wurde (DSM-III-R, APA), hatte einen sehr großen Einfluss auf die heutige Konzeption von Klassifikationssystemen. In der vierten Revision, dem DSM-IV (APA, 1984), wurde bei kleineren Änderungen an den wesentlichen Komponenten festgehalten.
Das DSM-IV war multiaxial, mit folgenden fünf Achsen:
– Achse I beschrieb die klinischen Syndrome, die in 17 allgemeinere Kategorien eingeteilt wurden (z. B. affektive Störungen, Angststörungen, somatoforme Störungen, schizophrene Störungen). Neben der Art der Schwierigkeiten wurde auch der Schweregrad der Störung angegeben, wobei bei allen Syndromen zwischen einer leichten, mittleren und schweren sowie zwischen einer partiell und voll remittierten (rückgebildeten) Störung unterschieden wurde.
– Achse II beschrieb Entwicklungsstörungen bei Kindern und Jugendlichen – z. B. eine allgemeine Beeinträchtigung der kognitiven Entwicklung (geistige Behinderung), aber auch umschriebene Entwicklungsstörungen wie etwa Sprachentwicklungsstörungen – und Persönlichkeitsstörungen bei Erwachsenen (paranoide, schizoide, narzisstische, antisoziale und hypersensitive Störungen sowie Borderline).
– Auf Achse III wurden körperliche Krankheiten bzw. körperliche Zustände festgehalten, die gleichzeitig gegeben waren (ohne dass diese mit der psychischen Störung in einem ursächlichen Zusammenhang stehen mussten).
– Achse IV wurde der Schweregrad psychosozialer Belastungsfaktoren (auf einer Skala von 1 = keiner bis 6 = katastrophal) festgehalten, wobei zwischen akuten Ereignissen und länger anhaltenden Umständen unterschieden wurde. Die Belastungen, denen ein unterschiedlicher Schweregrad zugemessen wurde, wurden beispielhaft beschrieben, getrennt für Erwachsene und Kinder bzw. Jugendliche (z. B. wurde als Beispiel für ein katastrophales akutes Ereignis für Erwachsene der Tod eines Kindes oder der Selbstmord des Ehepartners angeführt).
– Auf Achse V wurde die derzeitige globale psychische, soziale und berufliche Leistungsfähigkeit sowie der höchste Stand der Leistungsfähigkeit im letzten Jahr auf einer Skala von 1 bis 90 eingestuft. Diese Skala sollte die Beeinträchtigung des Patienten auf einem hypothetischen Kontinuum zwischen Gesundheit und schwerster psychischer Krankheit angeben.
Zusätzlich können jene Bedingungen, die nicht als eigentliche psychische Störungen zu werten sind, aber Anlass für die Vorstellung in der klinischen Einrichtung sind (z. B. Eheprobleme, Arbeitsschwierigkeiten), mithilfe sogenannter „V-Codes“ angegeben werden.
Der große Einfluss des DSM-III bzw. seiner Nachfolger ist wohl v. a. auf die genauen Definitionskriterien zurückzuführen. Er ist zudem dadurch bedingt, dass bei der Veröffentlichung versucht wurde, das verfügbare Wissen über die Merkmale der verschiedenen Störungen, die Häufigkeit und den Verlauf sowie prädisponierende Faktoren für alle Störungen möglichst umfassend in einem Handbuch darzustellen.
Es ist jedoch zu betonen, dass im DSM-III mit einigen Grundzügen der älteren psychiatrischen Klassifikationen gebrochen wurde, v. a. mit der grundlegenden Polarität zwischen Neurosen und Psychosen. Am klarsten wird dies bei der Einteilung der Depressionen, die alle – unabhängig von den klassisch unterschiedenen Subformen – zu den affektiven Störungen gerechnet werden. Anstelle des älteren hierarchisch konzipierten Systems der psychiatrischen Klassifikation stehen nun verschiedene Störungen gleichsam gleichberechtigt nebeneinander. Dies hat dazu geführt, dass deutlicher geworden ist, dass ein Patient/eine Patientin gleichzeitig mehrere Formen psychischer Störungen haben kann und dass manche Störungen sogar sehr häufig gemeinsam auftreten, z. B. affektive Störungen und Angststörungen. Dabei stellt sich natürlich die Frage, welche Konsequenzen dies für den weiteren Verlauf der psychischen Störungen und für die Behandlung dieser PatientInnen hat. Trotz des großen Einflusses des amerikanischen Systems orientiert sich die offizielle Diagnostik in den meisten Ländern – auch in Österreich – an einem anderen System: der ICD („International Classification of Diseases“) der WHO (Dilling, Mombour, & Schmidt, 1991), deren gegenwärtig gültige Fassung die zehnte Version ist. Der Entwurf für die elfte Version wurde schon vorgestellt, das ICD-11 wird aber erst ab 2022 gelten. Trotz des Bemühens um eine genauere Fassung der diagnostischen Kriterien hat die ICD bisher auf eine Operationalisierung der diagnostischen Kriterien verzichtet, allerdings hat sie ebenfalls das Format einer mehrachsigen Diagnose angenommen, wobei die Achsen weitgehend jenen des DSM-IV entsprechen.
Das „Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen DSM-5“
Im Mai 2013 erschien die fünfte Ausgabe des Diagnostischen und Statistischen Handbuchs Psychischer Störungen ([DSM-5] APA, 2013). Die deutsche Übersetzung „Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer Störungen DSM-5“ wurde im Jahr 2015 veröffentlicht (Falkai & Wittchen, 2015). Die Änderungen im DSM-5 wurden aufgrund zahlreicher Kritik am DSM-IV vorgenommen. Die Kritik bezog sich überwiegend auf die kategoriale Anordnung von Störungen und die hohen Prävalenz- und Komorbiditätsraten, auf das Fehlen wichtiger Diagnosen und die häufige Vergabe der Diagnose „Nicht Näher Bezeichnete Störungen“.
Das DSM-5 stellt den Versuch einer stärkeren Harmonisierung von DSM-5 und ICD-11 dar. Es ist ein binäres, kategoriales Klassifikationssystem. Es ist deskriptiv und benennt explizite Kriterien anhand von subjektiv berichteten Symptomen.
Das Ziel der Überarbeitung bestand darin, dimensionale und störungsübergreifende Aspekte stärker zu berücksichtigen. Neu im DSM-5 ist daher ein dimensionaler Zugang zur Diagnostik. Gesundheit und Krankheit werden als Zustände auf einem Kontinuum betrachtet. Psychische Störungen werden nicht als klar abgegrenzte Krankheitsbilder gesehen, sondern als Ausdruck eines fließenden Übergangs von Gesundheit zu Krankheit, wodurch auch Komorbidität leichter berücksichtigt werden kann. Daher wurden neben kategorialen auch dimensionale Diagnosen eingeführt, das heißt, neben der Merkmalsbasierung sind auch operationalisierte Definitionen der Kriterien für psychische Störungen möglich (Skodol, 2012). Man kann hier von einem „zweigleisigen Vorgehen“ oder einer „hybriden“ Konstruktion sprechen. Das Ziel hierbei war es, die Kontinuität der bisherigen diagnostischen Praxis beizubehalten und gleichzeitig eine Grundlage für ein neues dimensionales Paradigma klinischer Persönlichkeitsdiagnostik zu schaffen. Somit können die kategorialen Diagnosen auf dimensionalen Einschätzungen, Funktionsniveau bzw. problematischen Persönlichkeitsmerkmalen basieren (Berberich & Zaudig, 2015).
Dieser neue Zugang wird in der Definition einer psychischen Störung im DSM-5 deutlich: „Eine psychische Störung ist definiert als Syndrom, welches durch klinisch signifikante Störungen in den Kognitionen, in der Emotionsregulation und im Verhalten einer Person charakterisiert ist.“ Und weiter: „Diese Störungen sind Ausdruck von dysfunktionalen psychologischen, biologischen oder entwicklungsbezogenen Prozessen, die psychischen und seelischen Funktionen zugrunde liegen.“ Schließlich wird auch das subjektive Leiden und die subjektive Einschränkung besonders betont: „Psychische Störungen sind typischerweise verbunden mit bedeutsamen Leiden oder Behinderung hinsichtlich sozialer oder berufs-/ausbildungsbezogener und anderer wichtiger Aktivitäten“ (APA, 2013).
Die wohl größte Veränderung im DSM-5 ist der Verzicht auf das multiaxiale Klassifikationssystem. Die Achsen I–III wurden in ein monoaxiales System integriert. Dies bedeutet, dass die psychischen Störungen sowie die Entwicklungs- und Persönlichkeitsstörungen gemeinsam in der Sektion II aufgelistet werden. Diese Sektion, in der die diagnostischen Kriterien und Codes aufgelistet werden, umfasst 22 Kapitel, darunter das Schizophrene Spektrum und andere psychotische Störungen, Bipolare Störungen, Depression, Angststörungen, Zwangsstörungen, Traumabezogene und Stressbezogene Störungen, Dissoziative Störungen, Somatische Symptome und dazugehörige Störungen, Essstörungen usw. Weiters wurde die Kategorie „Nicht Näher Bezeichnete Störungen“ aus DSM-IV durch Unspezifizierte Störungen und Andere Spezifizierte Störungen ersetzt. Damit sollte die Spezifität von Diagnosen erhöht und die Angabe von Gründen ermöglicht werden. In der Diagnosestellung werden im DSM-5 für einige Störungen auch Zusatzkodierungen für den Schweregrad und assoziierte Beschwerden ermöglicht.
Anstelle der Achse IV wurde die Z-Codierung der ICD-10 einbezogen. Zur Erhebung psychosozialer und umgebungsbedingter Probleme sowie des globalen Funktionsniveaus wurde die GAF-Scale durch den World Health Organization Disability Assessment Schedule (WHO-DAS) ersetzt. Er ermöglicht eine Einschätzung der Anpassung vs. Beeinträchtigung in folgenden Bereichen: soziale Beziehungen (Familie, Freunde/Freundinnen), Bewältigung sozialer Situationen, schulische/berufliche Anpassung, Interessen und Freizeitaktivitäten. Die Skalierung erfolgt von 0 (hervorragende Anpassung auf allen Gebieten) bis zu 8 (braucht ständige Betreuung). Die beschriebenen V-Codes des DSM-IV wurden beibe - halten.
Bemerkenswert ist, dass die Perspektive der Entwicklung über die Lebensspanne, aber auch kulturelle Aspekte und Genderunterschiede im DSM-5 besondere Aufmerksamkeit erfahren sollen und Merkmale wie Alter, Geschlecht und Kultur bei der Diagnosestellung berücksichtigt werden.