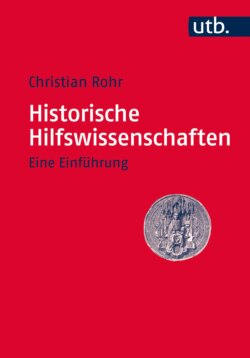Читать книгу Historische Hilfswissenschaften - Christian Rohr - Страница 12
3.2 Schriftliche Quellen und ihre Intention
ОглавлениеFür die Beurteilung und Einordnung einer schriftlichen Quelle sind zwei Faktoren unerlässlich: Zum einen ist nach der Intention des Autors zu fragen, die meist nicht ausdrücklich im Text erwähnt wird, sondern anhand von Hinweisen erschlossen werden muss. Zum anderen ist eine gattungsspezifische Beurteilung vonnöten, d. h. jeder schriftliche Quellentyp hat seine Eigenheiten, die als Richtlinie herangezogen werden müssen. Letzterer Aspekt wird weiter unten am Beispiel der Urkunden näher ausgeführt (Kapitel 4).
Der Kommunikationswissenschafter Friedemann Schulz von Thun hat zur Untersuchung von Gesprächen das Modell der Intentionsanalyse entwickelt, das sich – leicht adaptiert – auch sehr gut auf schriftliche Quellen der Vergangenheit anwenden lässt. [<<16] Demnach gibt es einen Sender einer Nachricht sowie einen oder mehrere Empfänger. Versteht man schriftliche Quellen als Nachrichten, so ist dies die einzige Überlieferung, die uns erhalten ist, während Sender und Empfänger in der Regel verstorben oder nicht greifbar sind. Nach Schulz von Thun haben Nachrichten insgesamt vier Seiten, die auf Sender und Empfänger rückschließen lassen und anhand des folgenden Beispieltextes exemplarisch vorgestellt werden.
Der italienische Humanist Leonardo Bruni (ca. 1370–1444) reiste im Spätherbst des Jahres 1414 als Sekretär des (Gegen-)Papstes Johannes XXIII. von Norditalien zum Konzil von Konstanz. In seinem Brief an den Humanistenfreund Niccolò Niccoli interessierte er sich vor allem für Land und Leute im Etschtal und für die Natur der Alpen.
„[…] Nach einer zweitägigen Reise durch dieses Tal [das Etschtal] erreichten wir Trient, eine Stadt, die sich durch eine ganz reizende natürliche Lage auszeichnet. […] Zurecht könnte es jemanden wundern, dass sich in dieser Stadt Männer, Frauen und die übrige Bewohnerschaft, die entweder Italienisch oder Deutsch sprechen, innerhalb einer einzigen Stadtmauer aufhalten. Denn so wie jeder entweder in einem Italien oder dem oberen Gallien zugewandten Teil der Stadt wohnt, so spricht er dementsprechend auch entweder unsere oder jene Sprache. Zudem glaube ich auch, dass es sich in den Versammlungen und öffentlichen Sitzungen dergestalt verhält, dass die einen in unserer und die anderen in barbarischer Sprache ihre Meinung abgeben – alles Bürger ein und derselben Stadt.
Nachdem wir von Trient einige Meilen aufgebrochen waren, wurden wir von einer eigenartigen barbarischen Sitte aufs Höchste beunruhigt. Es verhält sich nämlich folgendermaßen: Es gibt dort zahlreiche Burgen, die hoch auf dem Felsen über dem Fluss ragen und Adeligen gehören. Wenn diese nun eine größere Anzahl an Reisenden erblicken, lassen sie, wenn sich die Gruppe schon unterhalb ihrer Burg befindet, plötzlich von der Festung die Hörner erschallen; zudem erhebt eine möglichst große Anzahl an Menschen von den Mauern und Befestigungen ein barbarisches Geschrei und feindliches Geheule. Durch das unvermutete Ereignis fährt allen Menschen der Schrecken in die Glieder und es gibt wohl kaum jemandem mit so viel standhaftem Mut, dass er nicht schon aus Überraschung beunruhigt wird, besonders weil es sich um Örtlichkeiten handelt, die bewusst für die Räuberei ausgewählt sind. Jene Burgherren glauben, dass diese barbarische und schreckliche Sitte zum Schutz ihres Eigentums beiträgt und Menschen eher vom Unrecht ablassen werden, wenn sie schon erblickt und angeschrien wurden und dann meinen, dass sie beobachtet werden. Mir freilich wurde klar, durch ein feindliches Land zu reisen […].“
(Leonardo Bruni, Epistula 4, 3, Auszug; Übersetzung: Christian Rohr) [<<17]
1. Objektiver und subjektiver Sachinhalt: Unter dem objektiven Sachinhalt sind Informationen zu verstehen, die mit einiger Sicherheit als zutreffend eingestuft werden können, etwa durch den Vergleich mit parallelen Quellen. So kann man etwa dem Reisebericht die Aussagen „Nach einer zweitägigen Reise durch dieses Tal [das Etschtal] erreichten wir Trient“ oder „Es gibt dort zahlreiche Burgen, die hoch auf dem Felsen über dem Fluss ragen und Adeligen gehören“ als objektiv ansehen. Schreibt der Autor hingegen „Jene Burgherren glauben, dass diese barbarische und schreckliche Sitte zum Schutz ihres Eigentums beiträgt und Menschen eher vom Unrecht ablassen werden, wenn sie schon erblickt und angeschrien wurden und dann meinen, dass sie beobachtet werden“, so sind diese Aussagen als subjektiv einzustufen. In vielen erzählenden Quellen werden zudem Zahlenangaben häufig gerundet und sind mitunter stark untertrieben. Die Grenze zwischen objektivem und subjektivem Sachinhalt ist häufig fließend.
2. Selbstoffenbarung: Quellen verraten in der Regel zahlreiche Informationen über den Sender der Nachricht, mitunter auch „zwischen den Zeilen“. Wie steht der Sender zum Inhalt? Was sagt er über sich selbst aus? Aus dem Beispieltext ist etwa zu erfahren, dass der Autor Italiener ist, weil er von Italienisch als „unserer Sprache“ spricht. Er hat zudem deutliche Ressentiments gegenüber den „barbarischen“ Burgbewohnern im heutigen Südtirol, ein häufiges Merkmal humanistischer Autoren gegenüber Nicht-Italienern, analog zur Einschätzung der Nichtrömer durch die antiken Römer. Am Latein des Originaltextes ließe sich auch erkennen, dass der Mann hoch gebildet ist.
3. Beziehung: Zwischen dem Sender und dem Empfänger bzw. den Empfängern herrscht in der Regel eine Beziehung, die übergeordnet, untergeordnet, gleichrangig, belehrend, etc. sein kann. Im Beispielstext ist von einer Gleichrangigkeit von Sender und Empfänger auszugehen, doch sind belehrende Elemente durchaus enthalten.
Deutlicher wird eine Über- bzw. Unterordnung in Urkunden sowie allgemein im Verwaltungsbereich. Wenn ein Kaiser seine Urkunden mit der Nennung seines vollen Titels beginnt, der sich über viele Zeilen ziehen kann, dann drückt er damit seine ganze Machtentfaltung gegenüber seinen Untertanen oder anderen Herrschern aus (siehe im Kapitel 4.3.1 das Beispiel mit dem Titel Kaiser Josephs II.). Derselbe Herrscher schreibt hingegen an seine Familienmitglieder auf gleicher Ebene und beginnt daher seine Schreiben nicht mit dem Titel, sondern etwa mit „Mein lieber Bruder“. Umgekehrt machen sich Bittsteller noch kleiner gegenüber dem Herrscher, um damit auf mehr Gunst und Gnade hoffen zu können. Sie reden den Herrscher mit „Großmächtigster Kaiser“ etc. an und schreiben von sich als „Euer alleruntertänigster Diener“. Selbst die Unterschrift unter ein Bittgesuch wird häufig [<<18] nicht direkt unter den Text gesetzt, sondern klein am unteren Seitenrand, der freie Platz auf der letzten Seite vom Textende bis zur Unterschrift wird mit einem langen, sogenannten Devotionsstrich ausgefüllt. Damit wird die Unterordnung auch optisch deutlich erkennbar.
4. Appell: Je nach Quellengattung ist der Appell eines Textes deutlicher oder weniger deutlich erkennbar. Was soll der Empfänger an Informationen erhalten? Wie soll er sein weiteres Handeln darauf abstimmen? Leonardo Bruni warnt jedenfalls in seinem Reisebericht vor den schreckenerregenden Barbaren nördlich von Trient, die ihm das Gefühl vermitteln, durch Feindesland zu reisen. Am klarsten ist der Appell etwa in politischen Manifesten oder agitatorischen Flugblättern zu erkennen.
Schriftliche Quellen bilden somit nicht die Vergangenheit ab, sondern sie konstruieren ein Bild von der Vergangenheit, das durch zahlreiche Faktoren geprägt ist. Jede Quelleninterpretation – und die Intentionsanalyse ist nur ein Zugang von mehreren – muss daher danach trachten, diese Konstruktion zu hinterfragen und, wenn nötig, zu dekonstruieren. Es ist gerade bei Schriftquellen, in denen der Autor seine eigene Zeit oder seine eigene Umgebung auf eine andere projiziert, zu unterscheiden, was damit konkret über die beschriebenen Ereignisse und Menschen ausgesagt wird und was eher über die Zeit und das Umfeld des Autors. Wenn also Gaius Julius Caesar in seinem berühmten Bericht „De bello Gallico“ (Über den gallischen Krieg) von den Sitten und Göttern der Gallier und Germanen schreibt, dann sind darin mitunter mehr Vorstellungen seiner eigenen Welt repräsentiert als aus der der beschriebenen Völker.